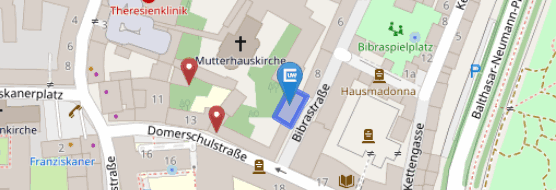„Der Auftakt einer Epoche: Konstantin und die Folgen“
30.10.2012Beginn der Rinvorlesung „Umbruch – Wandel – Kontinuität (312-2012). Von der Konstantinischen Ära zur Kirche der Gegenwart“ mit dem Vortrag von Prof. Dr. Franz Dünzl.
Zur Einführung in die Ringvorlesung der Kath.-Theol. Fakultät sprach Prof. Dr. Franz Dünzl am 31. Oktober 2012 zum Thema: „Der Auftakt einer Epoche: Konstantin und die Folgen“: Dass das Jahr 312, in dem sich Kaiser Konstantin durch die berühmte Schlacht an der Milvischen Brücke bei Rom die Macht über die Westhälfte des römischen Reiches sicherte, als Epochengrenze angesehen werden kann, begründete Dünzl durch die religionspolitischen Maßnahmen, die der Kaiser bald nach seinem Sieg in die Wege leitete. Das bislang verfolgte oder widerwillig geduldete Christentum wurde dadurch zunächst den anderen Kulten gleichgestellt und mit ähnlichen Privilegien ausgestattet, dann zunehmend begünstigt und als staatstragende Kraft in das System des römischen Reiches einbezogen. Diese Wende vollzog sich natürlich nicht voraussetzungslos und sie wurde unter der Herrschaft Konstantins auch nicht zum Abschluss gebracht; aber der Kaiser stieß einen Prozess an, durch den das Christentum im römischen Reich immer einflussreicher wurde, bis es am Ende des 4. Jh.s den Status der Staatsreligion erlangte. Von dieser Basis aus konnte es im Laufe von Jahrhunderten das Geschick Europas prägen und sich zu einer Weltreligion entwickeln.
Wichtige Weichenstellungen, die in die Zeit Konstantins zurückreichen, sollten die Zukunft des Christentums nachhaltig bestimmen: Die Christen 'kommen' im römischen Staat 'an', sie können sich nun als Beamte und Soldaten engagieren – langfristig entstehen ein christlicher Staatsapparat, ein christliches Heer im Dienst des jeweiligen Herrschers. Erst die Konfessionskriege des 16. und 17. Jh.s führen diese Identifikation von christlicher Religion und staatlichem Machtinteresse offenkundig ad absurdum. Neu und dauerhaft wirksam ist auch die Dominanz des Kaisers auf dem Gebiet der Religion – ein Phänomen, das keine genuin christlichen, sondern pagan-römische Wurzeln hat. Umgekehrt beeinflusst die Machtfülle der christlichen Kaiser zunehmend auch die Ausformulierung des Primatsanspruches der römischen Bischöfe. Die dominante Rolle des Kaisers gegenüber dem Christentum gründet in der traditionell römischen Herrscherpflicht, das Wohlwollen der Gottheit sicherzustellen und damit die Wohlfahrt des Staates zu garantieren. Für diese Aufgabe wird nun der christliche Kult in die Pflicht genommen – so lassen sich das Kirchenbauprogramm Konstantins, die Sakralisierung der Gotteshäuser, das Sonntagsgesetz von 321 und die Veränderungen im christlichen Liturgieverständnis erklären. Das alles bleibt nicht ohne Rückwirkung auf die religiöse Mentalität der Christen: Die staatstragende Funktion der Religion, das Reich zu stabilisieren und Gefahren abzuwehren, fördert eine Haltung der Intoleranz, die sich in der staatlichen Häretikergesetzgebung und später in der kirchlichen Inquisition niederschlägt – erst das II. Vaticanum wird dieser Intoleranz eine klare Absage erteilen.
So fällt die Bilanz der konstantinischen Ära gemischt aus: Den neuen, ungeahnten Entfaltungsmöglichkeiten der Kirche stehen die Nivellierung ihrer Ideale und die Versuchung zur Macht gegenüber – insofern ist das Ende der Konstantinischen Ära nicht nur als Verlustgeschichte, sondern auch als Chance für das Christentum zu begreifen.
(Text: FD)