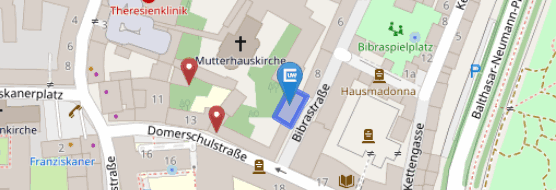Kanon des Monats
„Sede vacante nihil innovetur.“
„Während der Sedisvakanz darf nichts verändert werden.“
von Martin Rehak
„Only change is constant“ lautet die geläufige englische Adaption des geflügelten griechischen Wortes „πάντα ῥεῖ (dt.: alles fließt)“. So ist es auch im Leben der Kirche unvermeidlich, dass von Zeit zu Zeit bisherige Amtsinhaber*innen aus dem Amt scheiden und neue berufen werden.
Für eine faire Balance zwischen Bewahrung und Neuerung gilt dabei im kanonischen Recht seit Langem der Grundsatz der Veränderungssperre im Sedisvakanzfall.
Bereits im liber extra, der 1234 promulgierten Dekretalensammlung Papst Gregors IX. (1227–1241) war dieser Thematik ein eigener Titel gewidmet (vgl. X 3.9: Ne sede vacante aliquid innovetur). Dort hat Raymund von Penyafort, der kongeniale Redaktor des liber extra, drei einschlägige Dekretalen der Päpste Innozenz III. (1198–1216) und Honorius III. (1216–1227) versammelt.
Die erste Entscheidung (X 3.9.1) aus dem Jahr 1206 mit dem (sekundären) Rubrum „vacante sede status eius mutari non debet“ stellt einen Ausschnitt aus der rund 20 Jahre sich hinziehenden Auseinandersetzung zwischen dem Bistum Bath und der Abtei Glastonbury dar und hat einen dezidiert prozessrechtlichen Einschlag; zugleich stehen manifeste wirtschaftliche Interessen – gerechte Verteilung von Spenden und ausreichende Finanzausstattung für die Instandhaltung der Klosteranlage – im Hintergrund. Die Abtei war von Innozenz’ Amtsvorgänger Coelestin III. (1191–1198) mit dem Bistum vereinigt worden, so dass der Bischof zugleich das Amt des Abtes übernahm. Nach dem Tod des Bischofs klagte der Konvent gegen diese Regelung und verlangte die alte Unabhängigkeit zurück. In der Dekretale Novit ille entschied Innozenz III., dass ein Rechtsstreit hierüber nicht statthaft sei, solange der Bischofsstuhl vakant ist und daher die Rechte des Bischofs nicht authentisch vertreten werden können.
In der Dekretale Illa devotionis (X 3.9.2) mit dem Rubrum „beneficia spectantia ad collationem praelati non possunt conferri per capitulum sede vacante“ befand Honorius III., dass ein gewisser Magister R., seines Zeichens Dekan im Bistum Teano, zu Recht der Inhaber der Pfründe an der Kirche des Heiligen Leucius von Brindisi in Capua sei. Als das Domkapitel die Pfründe an einen Dritten vergeben hat, sei es hierzu nicht befugt gewesen, weil die Verleihung der fraglichen Pfründe allein dem Erzbischof von Capua zustehe. Das Domkapitel könne sich nicht damit herausreden, lediglich eine Ersatzvornahme getätigt zu haben; denn eine Sedisvakanz (der erzbischöflichen Kathedra) sei ersichtlich kein Fall von Nachlässigkeit und Pflichtvergessenheit (des Erzbischofs).
Mit der an den Bischof von Burgos gerichteten Dekretale Constitutis (X 3.9.3) mit dem Rubrum „sede vacante iudicium habitum contra ecclesiam non tenet“ schließlich hat Honorius III. die Linie seines Amtsvorgängers bekräftigt, dass Prozesshandlungen im Rechtsstreit mit einem Bistum unzulässig seien, solange der Bischofssitz vakant ist und daher die Rechte des Bistums nicht vom Bischof verteidigt werden können.
Wie dem Quellenapparat zum Kodex des kanonischen Rechts von 1917 zu entnehmen ist, gehört zu den mittelalterlichen Wurzeln des hier betrachteten Grundsatzes auch ein Kapitel aus dem liber sextus, der 1298 promulgierten Dekretalensammlung Papst Bonifaz’ VIII. (1294–1303). Im dortigen Titel de rebus ecclesiae non aliendis (VI° 3.9) findet sich die von Papst Innozenz IV. (1254–1261) verantwortete Dekretale Dudum (VI° 3.9.1), deren rechtliche Kernaussage der Kanonist Johannes Andreae (um 1270–1348) so auf den Punkt gebracht hat: „Perpetua alienatio, facta de rebus ecclesiae vacantis non praecedente tractatu et sine iusta causa, non valet.“ Erneut ist hier der tragende Grund der Entscheidung der Umstand, dass im Zeitpunkt der (ungültigen) Veräußerung für immer die betroffene Ortskirche sich nicht verteidigen konnte („Quia […] praedicta ecclesia, cum vacaret, legitimo caruit defensore, […].“ Zudem fehle im zu beurteilenden Sachverhalt das in solchen Fällen übliche Vertragswerk. Schlussendlich lasse sich die fragliche Veräußerung auch nicht mit der Erwägung stützen, sie sei notwendig oder nützlich gewesen („[…] praesertim cum evidens necessitas, quare fieri deberet, vel utilitas non subesset, […].“
Es bricht sich hier erkennbar die Spitzfindigkeit und konstruktive Kreativität eines geschulten Juristen (bzw. Kanonisten) Bahn, der Rechtssätze ungern unhinterfragt lässt, sondern das in ihnen verkörperte Gerechtigkeitsideal herausarbeitet und zugleich die (interessengeleitete) Dehnbarkeit der Norm erprobt. In der von Johannes Andreae gelegten Spur konnte daher etwa Heribert Jone, der namhafte Kommentator des pio-benediktinischen Kodex von 1917, feststellen: Veränderungen, die lediglich vorteilhaft sind, sind zulässig.
Denn die Bestimmung des can. 436 CIC/1917: „Sede vacante nihil innovetur“ – welche (im Widerspruch zu unserem Eingangsstatement) gänzlich unverändert in c. 428 § 1 CIC übernommen wurde – stellte ersichtlich ein Referat des alten Rechts dar, so dass gemäß can. 6 Nr. 2 CIC/1917 bei der Auslegung der Norm die bewährte Praxis und die Auffassung der anerkannten Rechtsgelehrten zu beachten war. Der Kanon folgte dabei in der redaktionellen Anordnung des Rechtsstoffs auf can. 435 § 2 CIC/1917, welche Norm wiederum mit einer abstrakteren Formulierung, aber unverändertem Sinn- und Regelungsgehalt in den jetzigen c. 428 § 2 CIC übernommen wurde.
Betrachtet man den unmittelbaren systematischen Kontext des c. 428 CIC, so wird deutlich, dass der erste Normadressat dieser Regelung der Diözesanadministrator ist. Er darf keine Entscheidungen treffen, die – mit den Worten des c. 428 § 2 CIC – potenziell geeignet sind, die rechtliche und wirtschaftliche Lage des vakanten Bistums zu beeinträchtigen oder die bischöflichen Rechte zu schmälern.
Den Spezialfall, dass der vakante Bischofsstuhl der stadtrömische ist, streift das kodikarische Recht nur kurz in c. 335 CIC und schärft ein, dass in diesem Fall in der Leitung der Gesamtkirche nichts verändert werden dürfe. Zudem wird in dieser Norm ebenso wie in c. 359 CIC darauf verwiesen, dass bei Sedisvakanz des päpstlichen Thrones die einschlägigen kirchlichen Spezialgesetze – aktuell die ursprünglich von Papst Johannes Paul II. (1978–2005) erlassene und von Papst Benedikt XVI. (2005–2013) modifizierte (vgl. dazu auch hier) Apostolische Konstitution Universi Dominici gregis – zu beachten sind. Das Prinzip der Veränderungssperre wird dabei durch die Bestimmung des c. 367 CIC flankiert, wonach – sofern im Einzelfall keine abweichende Anordnung getroffen wurde – das Amt eines päpstlichen Gesandten nicht durch die Sedisvakanz des Apostolischen Stuhls endet.
Im Kontext der synodalen Elemente der Kirchenverfassung wird der hier erörterte Rechtsgrundsatz auf der Ebene der Kirchenprovinzen indirekt durch c. 440 § 2 CIC verfochten, gemäß welcher Norm bei Sedisvakanz des Metropolitansitzes eine Provinzialkonzil nicht einberufen werden darf. Ebenso ist auf Bistumsebene eine vielleicht stattfindende Diözesansynode gemäß c. 468 § 2 CIC im Sedisvakanzfall suspendiert, bis der neue Diözesanbischof über ihre Fortsetzung oder ihren endgültigen Abbruch befindet. Der Priesterrat ist im Sedisvakanzfall von Rechts wegen aufgelöst (vgl. c. 501 § 2 CIC) und es schlägt die Stunde des Konsultorenkollegiums; sprich in Deutschland die Stunde der Domkapitel, die dessen Aufgabe übernehmen (vgl. c. 501 § 2 i.V.m. c. 502 § 3 CIC). Ebenso endet gemäß c. 513 CIC die Amtsperiode eines diözesanen Pastoralrats im Sedisvakanzfall vorzeitig.
Doch kommen wir noch einmal zurück zum Diözesanadministrator und seinen Befugnissen im Sedisvakanzfall. In seiner inneren Weisheit ist sich das kanonischen Recht durchaus der Problematik bewusst, dass ein stures Festhalten am „Sede vacante nihil innovetur“-Grundsatz für ein vakantes Bistum auch schädlich sein kann; insbesondere dann, wenn aufgrund ungebührlich langer Vakanz lähmender Stillstand bei wichtigen und eventuell auch dringenden Entscheidungen die Folge ist. Von daher finden sich im Kodex etliche Bestimmungen, die das traditionelle Begründungsmotivpaar der Notwendigkeit und Nützlichkeit in positive Rechtsnormen ummünzen.
Dies betrifft zum einen das Feld der Personalentscheidungen. So gestattet c. 272 CIC dem Diözesan-administrator, mit Zustimmung des Konsultorenkollegiums dann über etwaige Exkardinationen, Inkardinationen und Transmigrationen von Klerikern zu entscheiden, wenn die Sedisvakanz schon mindestens ein Jahr andauert. Ebenso ist ein Diözesanbischof (ohne dass das Konsultorenkollegium zustimmen müsste) gemäß c. 525 Nr. 2 CIC befugt, Pfarrer zu ernennen, wenn die Sedisvakanz länger als ein Jahr währt. Wie man sieht, ist der Zeitraum von einem Jahr ein wiederkehrender Topos, der zugleich anzeigt, welchen Zeitraum der Gesetzgeber für die Wiederbesetzung des Amts eines Diözesanbischofs – das ohne Zweifel ein der Seelsorge dienendes Amt darstellt, dessen Übertragung also gemäß c. 151 CIC keinen Aufschub duldet – offenbar als (noch) vertretbar ansieht.
Erwähnt sei schließlich noch c. 490 § 2 CIC, der ausnahmsweise auch dem Diözesanadministrator den Zutritt zum bischöflichen Geheimarchiv gestattet, falls ein echter Notfall vorliegen sollte.
Beweist nach alledem c. 428 § 1 CIC, dass der Aphorismus von der konstanten Veränderung unzutreffend ist und jedenfalls nicht das kanonische Recht betrifft. Beweist unser Norm vielleicht sogar die These einer Reformunfähigkeit der Kirche und ihres Rechts. In der Tat könnte sich der in c. 428 § 1 CIC niedergelegte Rechtsgrundsatz noch lange Zeit unverändert im kanonischen Recht erhalten, wenn und weil ihm zugleich jene gegenläufigen Rechtsnormen beigegeben sind, welche eine differenzierte Rechtslage und -anwendung ermöglichen, die verhindert, dass sich Vernunft und Wohltat in Unsinn und Plage (vgl. Goethe, Faust I, 1976) verwandeln. Darüber hinaus wird man das in c. 428 § 1 CIC zum Ausdruck kommende Beharrungsvermögen des Rechts womöglich als einen Hinweis darauf sehen können, dass gutes, bewährtes, richtiges Recht tatsächlich eine Funktion des transzendenten Ideals der Gerechtigkeit darstellt, so dass eine Veränderung des positiven Rechts ohne vorgängige neue Gerechtigkeitsparadigmen schlicht unlogisch, unverständlich und verkehrt wäre. Es ist also nicht nur der Wandel eine Konstante, die unser Dasein charakterisiert, sondern auch der Wunsch nach Gerechtigkeit. Doch was das im Einzelfall konkret und genau bedeutet, kann und muss fließend bleiben.
* * *
Der Lehrstuhl für Kirchenrecht der Katholisch-Theologischen Fakultät der Julius-Maximilians-Universität Würzburg ist seit dem 01.10.2023 bis auf Weiteres vakant. Der bisherige Lehrstuhlinhaber stellt sich einer neuen beruflichen Herausforderung an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Es ist beabsichtigt, die Reihe „Kanon des Monats“ alsbald an anderer Stelle wiederaufzunehmen und fortzusetzen.
Ein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle Frau Anna Krähe, Frau Katharina Leniger, Frau Dr. Jessica Scheiper, Frau Dr. Martina Tollkühn und Herrn Prof. Dr. Theodor Seidl, die als Gastautor*innen die Reihe mit ihren Beiträgen bereichert und eine seit Mai 2018 kontinuierliche monatliche Veröffentlichung neuer Beiträge ermöglicht haben.
Ein herzliches Dankeschön geht darüber hinaus an alle Leser*innen dieser Reihe für ihr Interesse und das gelegentlich von einzelnen Personen geäußerte Feedback. Bleiben Sie dem kanonischen Recht gewogen!
* * *
„Utpote Moderator facultatibus Ordinarii praeditus, Praelatus prospicere debet sive spirituali institutioni illorum, quos titulo praedicto promoverit, sive eorundem decorae sustentationi."
„Als der mit den Befugnissen eines Ordinarius ausgestattete Moderator muss der Prälat sich sowohl um die geistliche Bildung jener, die er aufgrund des vorgenannten Titels befördert hat, als auch um deren geziemenden Unterhalt kümmern.“
von Martin Rehak
in memoriam Winfried Aymans (1936–2023)
Vor ungefähr einem Jahr hatte Papst Franziskus mit dem Motu Proprio Ad charisma tuendum vom 14.07.2022 die von Papst Johannes Paul II. am 28.11.1982 erlassene Apostolische Konstitution Ut sit, in: AAS 75/I (1983) 423–425, und damit das Eigenrecht der Praelatura Sanctae Crucis et Operis Dei (kurz: Opus Dei) abgeändert (siehe dazu auch hier). Mit dem in italienischer (und in Bezug auf den neuen Text des Codex Iuris Canonici auch in lateinischer) Sprache verfassten Motu Proprio Le Prelature personali vom 08.08.2023 – promulgiert durch Veröffentlichung im L’Osservatore Romano vom ebenfalls 08.08.2023 und am selben Tag in Kraft getreten – hat Papst Franziskus nunmehr im kodikarischen Recht der Personalprälaturen (cc. 294–297 CIC) einige Präzisierungen vorgenommen, welche c. 295 §§ 1-2 CIC und c. 296 CIC betreffen.
In c. 295 § 1 CIC n.F. wird nunmehr zur Rechtsnatur einer Personalprälatur ausgeführt, dass diese einem öffentlichen (vgl. dazu c. 301 § 3 CIC), klerikalen (vgl. dazu c. 302 CIC) Verein päpstlichen Rechts (vgl. dazu c. 312 § 1 Nr. 1 CIC) mit Inkardinationsbefugnis (vgl. dazu bereits c. 265 CIC) gleichgestellt wird („Praelatura personalis, quae consociationibus publicis clericalibus iuris pontificii cum facultate incardinandi clericos assimilatur, regitur ...“). Ähnlich wie es sich gemäß c. 368 CIC bei Gebietsprälaturen (vgl. dazu c. 370 CIC), Gebietsabteien (vgl. ebd.), Apostolischen Vikariaten (vgl. dazu c. 371 § 1 CIC), Apostolischen Präfekturen (vgl. ebd.) und dauerhaft errichteten Apostolischen Administrationen (vgl. dazu c. 371 § 2 CIC) um Sonderformen von Teilkirchen handelt – Teilkirchen hier im Sinne des lateinischen Kirchenrechts, also nicht zu verwechseln mit den „‚Teilkirchen‘ oder ‚Riten‘“, von denen das Zweite Vatikanische Konzil in Dekret Orientalium Ecclesiarum über die katholischen Ostkirchen, dort Nr. 2, in: AAS 57 (1965) 76–89, hier 76, spricht –, handelt es sich also bei Personalprälaturen um eine Sonderform des kirchenrechtlichen Vereins. Damit findet etwa jene von Winfried Aymans – dem ausgewiesenen Kenner der Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils, des nachkonziliaren kirchlichen Verfassungsrechts sowie des kanonischen Vereinsrechts – vorgetragene Analyse der bisherigen Rechtslage ihre Bestätigung. Aymans hatte die Personalprälatur im Sinne des Kodex als einen „apostolischen Inkardinationsverband für Weltgeistliche“ (vgl. Aymans–Mörsdorf, KanR II, 746 f.) bezeichnet und zutreffend darauf hingewiesen, dass zwischen der Personalprälatur im Sinne des Kodex und der Praelatura Sanctae Crucis et Operis Dei deutliche Unterschiede hinsichtlich Zielsetzung und Binnenstruktur zu beobachten sind (vgl. ebd., bes. 754 f.).
Ebenfalls in c. 295 § 1 CIC n.F. wird die Beschreibung des Prälaten als eigener Ordinarius („Ordinarius proprius“) durch die Klarstellung ersetzt, dass der Prälat einer Personalprälatur als ein mit den Befugnissen eines Ordinarius (vgl. dazu c. 134 § 1 CIC) ausgestatteter Moderator handelt („… praeficitur Praelatus veluti Moderator, facultatibus Ordinarii praeditus, cui ius est …“). Dazu sei angemerkt, dass der Terminus „moderator“ unter anderem bereits aus dem kodikarischen Vereinsrecht bekannt ist und dort den Vereinsvorsitzenden (vgl. cc. 309, 317 §§ 1-4, 318 § 2, 320 § 3, 324 § 1, 329 CIC) bezeichnet, während im Ordensrecht unter dem „[supremus] moderator“ (vgl. cc. 592 §§ 1-2, 619 § 1, 622, 624 § 1, 625 §§ 1-2, 631 § 1, 647 §§ 1-2, 668 § 4, 684 § 1, 686 § 1 u. § 3, 688 § 2, 690 § 1, 691 § 1, 695 § 2, 697 Nr. 3, 698, 699 § 1, 726 § 2, 727 § 1, 743, 744 § 1, 745 CIC) zumeist spezifisch der oberste Leiter eines Religioseninstituts verstanden wird, wobei der Begriff aber auch – gehäuft im Recht der Säkularinstitute – sonstige Leiterinnen und Leiter (vgl. cc. 613 §§ 1-2, 615, 717 §§ 1-2, 719 § 4, 720, 724 § 2, 726 § 1, 738 § 1, 745 CIC) umfasst.
Mit dieser Neuumschreibung der Rechtsstellung des Prälaten korrespondiert der Einschub in c. 296 CIC n.F. am Anfang („Servatis can. 107 praescriptis, conventionibus …“), dem zufolge jene vertraglichen Bindungen, die interessierte Laien mit der Personalprälatur eingehen, nichts daran ändern, dass diese Gläubigen weiterhin gemäß c. 107 CIC aufgrund ihres Wohnsitzes dem örtlichen Pfarrer sowie dem örtlichen Ordinarius zugeordnet bleiben, welche gemäß c. 515 § 1 CIC der eigene Hirte sowie der eigene Ordinarius jener Gläubigen sind.
So bemerkenswert die eben beschriebenen Änderungen im Normtext der cc. 295–296 CIC sind, so bemerkenswert ist zugleich der Umstand, dass in c. 295 CIC weiterhin unverändert davon die Rede ist, dass der Prälat einer Personalprälatur das Recht habe, Alumnen
„titulo servitii praelaturae ad ordines promovere (dt.: auf den Titel des Dienstes für die Prälatur zu den Weihen zu befördern)“ (c. 295 § 1 CIC);
mit der Folge, dass er sodann verantwortlich ist für das spirituelle und materielle Wohl jener Alumnen,
„quos titulo praedicto promoverit (dt.: die er aufgrund des vorgenannten Titels befördert hat)“ (c. 295 § 2 CIC).
Was zunächst die Wendung „Beförderung zu den Weihen“ anbelangt, hat bereits Winfried Aymans erläutert (vgl. Aymans–Mörsdorf, KanR II, 741), dass damit die Befugnis des Prälaten umschrieben sei, Weiheentlassschreiben (vgl. dazu grundlegend c. 1015 § 1 CIC) für die Alumnen der Prälatur auszustellen. Zugleich hat Aymans richtig bemerkt, dass bei der Auflistung jener Amtsträger, die gemäß cc. 1018–1019 CIC zur Ausstellung von Weiheentlassschreiben berechtigt sind, die Prälaten einer Personalprälatur anscheinend vergessen wurden. Es ist bedauerlich, dass der gesamtkirchliche Gesetzgeber bei seiner jüngsten Änderung des CIC keine Notwendigkeit gesehen hat, auch außerhalb der cc. 294–297 CIC etwaige allfällige Klärungen zur Rechtsstellung des Prälaten einer Personalprälatur vorzunehmen und im Zuge dessen diesen augenscheinlichen redaktionellen Mangel zu beseitigen. Tatsächlich hätte hierfür gerade mit Blick auf das Opus Dei ein praktisches Bedürfnis bestanden, nachdem der Heilige Vater mit dem eingangs erwähnten Motu Proprio Ad charisma tuendum seiner Überzeugung Ausdruck verliehen hatte, dass angesichts des Gründungscharismas des Opus Dei eine Bischofsweihe für dessen Prälaten jetzt und in Zukunft nicht angemessen sei. Denn vor diesem Hintergrund ist offensichtlich, dass fortan der Prälat der Praelatura Sanctae Crucis et Operis Dei gar nicht mehr umhinkommt, für etwaige Alumnen seiner Prälatur andere Bischöfe um die Weihespendung zu bitten.
Was indes die Redeweise von einem Titel für die Beförderung zu den Weihen anbelangt, sei zunächst der rechtssprachliche Hinweis gestattet, dass „titulus“ im kodikarischen Recht in einer gewissen Bedeutungsvielfalt begegnet:
Die ursprüngliche Bedeutung der lateinischen Vokabel „titulus“ im Sinne von Aufschrift, Inschrift, Namensschild hat sich am ehesten in den cc. 304 § 2, 808, 1218 CIC erhalten.
In einer Weiterentwicklung dieses Grundgedankens meint „titulus“ auch den Titel im Sinne einer Auszeichnung, die einzelne Personen erhalten. Dabei handelt es sich teils um eine reine Ehrenbezeichnung (vgl. näherhin cc. 185, 402 § 1, 438, 1331 § 2 Nr. 5 CIC), teils wird „Titel“ als Synonym zu (akademischem) „Grad“ bzw. (beruflichem) „Abschluss“ verwandt (vgl. c. 660 § 1 CIC), und teils dürften beide eben genannten Aspekte gleichermaßen im Blick sein (vgl. cc. 1336 § 3 Nr. 5, 1336 § 4 Nr. 4, 1338 § 1 CIC).
In einem spezifisch juristischen Sinn ist „titulus“ etwa in cc. 168, 189 § 4, 388 § 3, 951 §§ 1-2, 1276 § 1, 1282, 1289, 1331 § 2 Nr. 4, 1407 §§ 1-2, 1411 § 2, 1497 § 2 CIC gebraucht und bezeichnet dort in einem allgemeinen Sinn den Rechtstitel, also mit anderen Worten den Rechtsgrund für ein subjektives Recht. Eine bekannte Unterkategorie – die historisch namentlich im Fall der Titelkirchen und Titeldiakonien der Kardinäle zugleich an die ursprünglichen Bedeutung von „titulus“ als Namensschild anknüpft – begegnet in Bezug auf Kardinäle und Bischöfe in cc. 350 §§ 1-5, 352 § 2, 357 § 1 CIC. Als eine weitere Unterkategorie ist der „Weihetitel“ anzusehen, wie er in c. 295 §§ 1-2 CIC auftaucht und sogleich noch eingehender zu diskutieren ist.
In einer Übertragung auf eine zwar auch rechtliche, aber mehr noch theologisch-spirituelle Ebene bezeichnet „titulus“ sodann in cc. 276 § 1, 573 § 1, 1008 CIC jene Rechtstitel im Sinne einer besonderen Legitimation zu innerkirchlichem Handeln, die gegenüber der Taufe und der dort vermittelten Gnade (vgl. dazu c. 204 § 1 CIC) als Rechtsgrund hinausgehend neu und anders sind, nämlich die sakramentale Weihe der Kleriker sowie die Profess der Ordensleute.
In cc. 224, 824 § 1-2, 1710, 1728 § 1 CIC schließlich meint „titulus“ schlicht und ergreifend eine Gliederungsebene bzw. einen Gliederungsabschnitt innerhalb des Codex Iuris Canonici.
Über den in c. 295 §§ 1-2 CIC erwähnten Weihetitel („titulus canonicus seu ordinationis“) ist zu sagen, dass sich hier über die Jahrhunderte hinweg insofern das altkirchliche Konzept der relativen Ordination erhalten hat, als bis ins 20. Jh. hinein zuletzt gemäß can. 980 § 2 CIC/1917 niemandem erlaubterweise die höheren Weihen gespendet werden durften, wenn nicht für die gesamte Lebenszeit des Neugeweihten durch den Weihetitel ein standesgemäßer Lebensunterhalt gesichert war. Damit bezeichnete der „titulus canonicus“ also – je nach Perspektive – den subjektiven Rechtsanspruch des Klerikers auf Unterhalt und zugleich jene konkrete Vermögensmasse, aus der nach der Weihe – genauer gesagt: nach der ersten höheren Weihe, d.h. der (nichtsakramentalen) Weihe zum Subdiakon – besagter geziemender Unterhalt fließen sollte.
Dabei wurden gemäß can. 979 § 1 CIC/1917 zunächst die klassischen Weihetitel des „titulus beneficii“, des „titulus patrimonii“ sowie des „titulus pensionis“ unterschieden. Allerdings hatte das Benefizium – also das zur Unterhaltung des Amtsinhabers mit einem bestimmten Kirchenamt (wie etwa einer Pfarrstelle) verbundene Vermögen – deshalb an Bedeutung im Weihetitelrecht eingebüßt, weil gemäß Kirchenrecht Benefizien nicht an Subdiakone, sondern nur an Priester vergeben werden konnten. Mit „titulus patrimonii“ bezeichnete man das (ererbte) Privatvermögen des Weihekandidaten, sofern es für einen lebenslänglichen Unterhalt ausreichend erschien. Unter dem „titulus pensionis“ verstand man etwaige Pensionsansprüche, die der Kleriker auf Lebenszeit gegenüber Dritten haben mochte. Als Ersatzformen für diese drei Weihetitel begegnet bereits in can. 981 §§ 1-2 CIC/1917 eine zentrale Besoldung seitens des Heimatbistums („titulus servitii dioecesis“) bzw. in Missionsländern durch „die Mission“ („titulus missionis“). Als eine juristische Förmelei könnte man insbesondere im Falle der Bettelorden den in can. 982 § 1 CIC/1917 erwähnten Weihetitel der Armut („titulus paupertatis“) betrachten; daneben begegnete in can. 982 § 2 CIC/1917 der ordensrechtliche „titulus mensae communis“ bzw. – rechtssprachlich den in can. 981 § 1 CIC/1917 erwähnten Titeln nachempfunden – der „titulus Congregationis“, der also die Verpflichtung der Ordensgemeinschaft, für das materielle Wohl ihrer Mitglieder zu sorgen, zum Ausdruck brachte.
Nachdem das Zweite Vatikanische Konzil im Dekret Presbyterorum ordinis über Dienst und Leben der Priester, dort Nr. 20,2, in: AAS 58 (1966) 991–1024, hier 1021, mit klaren Worten die Abschaffung oder wenigstens die grundlegende Reform des Benefizialsystems als hauptsächlichem Instrument der Priesterbesoldung gefordert hatte, wurde im Zuge der nachkonziliaren Reform des Kirchenrechts auch das hiermit in Zusammenhang stehende, als nicht mehr zeitgemäß empfundene Weihetitelrecht abgeschafft (vgl. cc. 1008–1054 CIC ex silentio).
Stattdessen ist das rechtliche Anliegen, das einst mit dem Instrument der Weihetitel verfolgt wurde, nunmehr hinreichend durch das Konzept der Inkardination gesichert, die ja nicht nur für den inkardinierten Kleriker (Priester oder Diakon), sondern auch für den Inkardinationsordinarius (Diözesanbischof oder Ordensoberer) mit Pflichten verbunden ist. Zugleich ist der Anspruch der Kleriker auf einen angemessenen Unterhalt auch ausdrücklich in den Katalog der Pflichten und Rechte der Kleriker aufgenommen worden (vgl. c. 281 §§ 1-3 CIC).
Und so kann man auch insoweit mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis nehmen, dass der Gesetzgeber bei der Neufassung des c. 295 CIC gleichsam minimalinvasiv vorgegangen ist und nur das abgeändert hat, was anscheinend mit Blick auf die tagesaktuelle Kirchenpolitik der Klarstellung bedürftig erschien. Die Gelegenheit zu einer umfassenden Bearbeitung aller mit c. 295 CIC zusammenhängenden kanonistischen Desiderate wurde hingegen verpasst. Denn bereits Winfried Aymans hatte über die Erwähnung eines Weihetitels in c. 295 CIC a.F. = n.F. nüchtern, apodiktisch und zutreffend geurteilt (vgl. Aymans–Mörsdorf, KanR II, 741): „Es handelt sich um einen Nachklang des altkodikarischen Rechts und ist nichts weiter als ein redaktioneller Mangel.“
„§ 1.Qui es instituto religioso legitime egrediantur vel ab eo legitime dimissi fuerint, nihil ab eodem repetere possunt ob quamlibet operam in eo praestitam.“
§ 2. Institutum tamen aequitatem et evangelicam caritatem servet erga sodalem, qui ab eo separatur.
„,§ 1. Wer rechtmäßig aus einem Ordensinstitut austritt oder aus ihm rechtmäßig entlassen wurde, kann für jegliche in ihm geleistete Arbeit von demselben nichts verlangen.
§ 2. Das Institut jedoch soll Billigkeit und evangelische Liebe gegenüber dem ausgeschiedenen Mitglied walten lassen.“
von Martin Rehak
Gemäß c. 654 CIC hat die Ordensprofess eine dreifache Funktion: Der Ordensmann bzw. die Ordensfrau versprechen durch ein öffentliches Gelübde (vgl. dazu cc. 1191 § 1, 1192 § 1 CIC) die evangelischen Räte der Armut, der Keuschheit sowie des Gehorsams zu befolgen. Die Kirche weiht sein bzw. ihr Leben in besonderer Weise Gott. Und er bzw. sie wird seiner bzw. ihrer Ordensgemeinschaft mit allen damit gemäß dem Kirchenrecht (einschließlich dem Eigenrecht der Gemeinschaft) verbundenen Rechten und Pflichten eingegliedert. Aus dieser Eingliederung erwächst für die Ordensgemeinschaft gemäß c. 670 CIC die Verpflichtung, in materieller Hinsicht für den Lebensunterhalt des Ordensmitglieds zu sorgen.
Diese Eingliederung kann durch verschiedene Tatbestände wieder gelöst werden, nämlich durch den Übertritt in ein anderes Institut des geweihten Lebens bzw. eine andere Gesellschaft des apostolischen Lebens (vgl. cc. 684–685 CIC); durch einen Austritt (vgl. c. 688–693 CIC); sowie durch eine Entlassung, auch Säkularisierung genannt (vgl. cc. 694–704 CIC). In der Praxis häufig, aber nicht notwendigerweise kann einem Austritt eine sogenannte Exklaustration vorausgehen (vgl. dazu cc. 686–687 CIC); dabei handelt es sich um eine vorläufige, zeitlich befristete Ausgliederung aus der Ordensgemeinschaft.
Im Falle einer endgültigen Ausgliederung erlöschen gemäß c. 692 CIC mit dem vom Ordensmitglied akzeptierten Austrittsindult bzw. gemäß c. 701 CIC mit der rechtmäßigen Entlassung die Verpflichtungen aus dem Gelübde sowie alle sonstigen aus der Profess hervorgehenden Rechte und Pflichten. Dazu stellt c. 702 § 1 CIC in Fortschreibung der Regelung aus can. 643 § 1 CIC/1917 klar, dass die Ausgliederung auch in finanzieller Hinsicht umfassend und abschließend sein soll. Das ehemalige Ordensmitglied kann keine Ansprüche gegenüber der Ordensgemeinschaft geltend machen. Dies ist letztlich eine Konsequenz aus dem Armutsgelübde, zu dessen konkreter Umsetzung c. 668 § 1 CIC vorsieht, dass Ordensmitglieder ein eventuell vor dem Ordenseintritt vorhandenes Privatvermögen einem Treuhänder zur Verwaltung übergeben müssen und nicht mehr für sich selbst nutzen bzw. Früchte ziehen können, während c. 668 § 3 CIC bestimmt, dass alles, was ein Ordensmitglied nach seiner Eingliederung erwirbt, für die Ordensgemeinschaft erworben wird. Vor diesem Hintergrund schützt c. 702 CIC das Vertrauen der Ordensgemeinschaft darauf, mit derartigen Erwerbungen wirtschaften zu können, ohne Rückforderungen befürchten zu müssen.
Auch wenn c. 702 § 1 CIC dies nicht ausdrücklich sagt, gilt nach allgemeiner Ansicht unter den Kanonisten auch spiegelbildlich, dass eine Ordensgemeinschaft von einem exkorporierten Mitglied nicht nachträglich ein Entgelt für besondere Aufwendungen (z.B. Kosten eines Hochschulstudiums, einer Ausbildung, oder von Heilbehandlungskosten) verlangen kann. Allerdings wird in der Literatur diskutiert, ob es hiervon auch Ausnahmen geben kann, die die Ordensgemeinschaft zu Rückforderungen berechtigen – etwa als Kompensation zur Nachversicherung nach staatlichem Recht (vgl. dazu sogleich) oder in Fällen, in denen das Ordensmitglied von Anfang an den Vorsatz hatte, nach einer Ausbildung auf Kosten der Ordensgemeinschaft diese wieder zu verlassen.
Der von c. 702 § 1 CIC für das Kirchenrecht aufgestellte Grundsatz wird In Deutschland – und ähnlich in Österreich – überlagert vom weltlichen Recht, genauer gesagt von den dortigen Regelungen zur Nachversicherung von zunächst versicherungsfreien Beschäftigten in der staatlichen Rentenversicherung. Insoweit ist es zunächst so, dass gemäß § 1 S. 1 Nr. 4 SGB VI auch Ordensleute im Ansatz versicherungspflichtig sind. Jedoch werden sie gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 SGB VI von der gesetzlichen Versicherungspflicht unter der Voraussetzung frei, dass „ihnen nach den Regeln der Gemeinschaft Anwartschaft auf die in der Gemeinschaft übliche Versorgung bei verminderter Erwerbsfähigkeit und im Alter gewährleistet und die Erfüllung der Gewährleistung gesichert ist“. Eine solche Anwartschaft haben Ordensleute in der Tat aufgrund des bereits erwähnten c. 670 CIC in Verbindung mit ihrem Gelübde und der damit einhergehenden Inkorporation inne. Für die Sicherung dieser Anwartschaft – oder anders gesagt: zur Stabilisierung des Systems der Versicherungsfreiheit von Ordensleuten – haben sich zahlreiche Ordensgemeinschaften in Deutschland im Solidarwerk der katholischen Orden Deutschlands e.V. zusammengeschlossen, um gegenüber dem Staat das Vorhandensein der erforderlichen Eigenmittel bzw. eine Gewährleistung der Altersversorgung von Ordensangehörigen notfalls über eine kirchliche Ausfallbürgschaft nachweisen zu können.
Im Falle der endgültigen Trennung eines Ordensmanns bzw. einer Ordensfrau von seiner bzw. ihrer Gemeinschaft verpflichtet § 8 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 SGB VI dazu, die bis dahin versicherungsfreien (vormaligen) Ordensleute nachzuversichern. Damit ist zunächst einmal gesagt, dass während einer bloßen Exklaustration, welche nur zu einer vorläufigen Trennung zwischen Ordensperson und Ordensgemeinschaft führt, eine etwaige Nachversicherung (noch) nicht durchzuführen ist. „Die Nachversicherung erstreckt sich auf den Zeitraum, in dem die Versicherungsfreiheit oder die Befreiung von der Versicherungspflicht vorgelegen hat“ (§ 8 Abs. 2 S. 2 SGB VI). Damit beginnt der Nachversicherungszeitraum regelmäßig am Tag der (ersten) Professablegung und endet am Tag der tatsächlichen Trennung von der Gemeinschaft. Nicht maßgeblich ist hingegen etwa das Datum, unter dem ein Austrittsindult ausgefertigt oder ein Entlassungsdekret wirksam wird. Besonderheiten können sich infolge der grundsätzlichen räumlichen Beschränkung des Geltungsbereichs des deutschen Sozialrechts gemäß § 3 SGB IV in den Fällen ergeben, in denen Ordensleute – etwa zwecks missionarischer Tätigkeit oder als Mitarbeiter:in an der Römischen Kurie – im Ausland tätig waren. Gemäß einer noch zur Reichsversicherungsordnung ergangenen Entscheidung des Bundessozialgerichts aus dem Jahr 1976 kann die Ordensgemeinschaft für die Zeit im Ausland auf freiwilliger Basis nachversichern, muss dies aber nicht. Die Nachversicherungsbeiträge sind von der Ordensgemeinschaft eigenständig zu berechnen und ohne weitere Aufforderung binnen dreier Monate ab Eintritt des Nachversicherungsfalls an den Rentenversicherungsträger zu überweisen. Danach kann auf die rückständige Zahlung ein Säumniszuschlag erhoben werden. Was die Höhe der Nachversicherung anbelangt, bestimmt § 181 Abs. 2 S. 1 SGB VI als Beitragsbemessungsgrundlage „die beitragspflichtigen Einnahmen aus der Beschäftigung im Nachversicherungszeitraum“. Dabei ist gemäß § 162 Nr. 4 SGB VI im Falle von Ordensleuten, die bis zu ihrem Austritt eine Anwartschaft auf Versorgung durch die Ordensgemeinschaft innehaben, die beitragspflichtige Einnahme reduziert auf die „Geld- und Sachbezüge, die sie persönlich erhalten“. Von daher ist auf Ordensleute in aller Regel § 181 Abs. 3 S. 1 SGB VI anwendbar, der als Mindestbeitragsbemessungsgrundlage einen Betrag in Höhe von 40 vom Hundert der jeweiligen Bezugsgröße garantiert, wobei § 18 SGB IV als Bezugsgröße das Durchschnittsentgelt der gesetzlichen Rentenversicherung im (in Bezug auf das jeweils nachzuversichernde Kalenderjahr) vorvergangenen Kalenderjahr festlegt. All dies führt dazu, dass ehemalige Ordensangehörige aus der Nachversicherung nur eine geringe Rente erwarten dürfen.
Vor diesem Hintergrund ist die weitere Bestimmung des c. 702 § 2 CIC durchaus auch hierzulande von Interesse. Die Norm gewährt zwar keinen einklagbaren Rechtsanspruch. Sie bildet aber gleichsam einen Ansatz, um einvernehmlich etwa ein Überbrückungsgeld auszuhandeln, das einem bedürftigen vormaligen Ordensmitglied als Starthilfe für einen Neuanfang im zivilen Leben dienen kann.
Die Norm steht in der Tradition des früheren can. 643 § 2 CIC/1917, der allerdings auf den speziellen Fall zugeschnitten war, dass eine Ordensfrau ohne Mitgift in einen Orden eingetreten war. Dabei diente – wie sich nicht zuletzt aus der in can. 551 § 1 CIC/1917 statuierten Pflicht der Ordensgemeinschaft zur Rückerstattung im Falle einer Rückkehr der Ordensfrau in die Welt ergibt – die Mitgift auch dazu, sich eine neue Existenz aufzubauen; oder in der Diktion des can. 643 § 2 CIC/1917, um auf sichere und angemessene Weise in die Heimat und zur Herkunftsfamilie zurückzukehren sowie für eine gewisse Zeit – bis zum Abschluss einer „Versorgungsehe“ (?) – ehrbar zu leben. In der Nachkonzilszeit hatte die Religiosenkongregation mit einem Rundschreiben vom 25.01.1975 an die Vorsitzenden der Vereinigung der Generaloberen in Rom angemerkt, dass die Prinzipien der Nächstenliebe, der Billigkeit, der Gerechtigkeit und der sozialen Verantwortung verlangen, als Ordensgemeinschaft auch denen zu helfen, die sie verlassen. Von daher formuliert c. 702 § 2 CIC nunmehr zu Recht den allgemeinen Rechtsgedanken, der bereits in can. 643 § 2 CIC/1917 zur Sprache gekommen war.
Da indes bei Trennungen zwischen Gemeinschaften und Individuen bisweilen negative Emotionen die Gesamtsituation belasten und einem fairen Ausgleich der jeweiligen Interessen entgegenstehen, wurde bereits von den Vorgängerorganisationen der jetzigen Deutschen Ordensoberenkonferenz eine Schlichtungsstelle eingerichtet, die gemäß einer Schlichtungsordnung in Konflikt- und Härtefällen zwischen den Parteien vermittelt.
Damit kann c. 702 CIC, bei dem einerseits der in § 1 geforderte „klare Schnitt“ und andererseits die in § 2 angeregte Barmherzigkeit eng beieinander liegen und auf einander bezogen sind, sowohl auf der Makroebene des gesamten Kanons als auch auf der Mikroebene einzelner Tatbestandsmerkmale (Stichwort: Rechtmäßigkeit der Trennung) auf seine Weise illustrieren, dass (Kirchen-)Recht gleichsam mehrdimensional ist und ihm neben der üblicherweise gescholtenen „Verhinderungsfunktion“ stets auch eine viel zu oft verkannte „Ermöglichungsfunktion“ eigentümlich ist.
„Officium ecclesiasticum sine provisione canonica valide obtineri nequit.“
„Ein Kirchenamt kann ohne kanonische Amtsübertragung nicht gültig erlangt werden.“
von Martin Rehak
Das Recht der lateinischen Kirche in der Gestalt des Kodex von 1983 zeichnet sich im Vergleich mit jenem des Kodex von 1917 aus durch einen engen Klerikerbegriff – Kleriker sind nur und alle, die eine sakramentale Weihe empfangen haben, vgl. c. 266 § 1 CIC; anders noch can. 108 § 1 CIC/1917: „Qui divinis ministeriis per primam saltem tonsuram mancipati sunt, clerici dicuntur (dt.: Als Kleriker werden diejenigen bezeichnet, die wenigstens durch die Erste Tonsur für den Dienst an Gott übereignet sind)“ – bei einem gleichzeitig weiten Kirchenamtsbegriff – Kirchenamt ist jeder Dienst, der kraft göttlicher oder kirchlicher Anordnung auf Dauer eingerichtet ist und der Wahrnehmung eines geistlichen Zwecks dient, vgl. c. 145 § 1 CIC; anders noch can. 145 CIC/1917: „§ 1. Officium ecclesiasticum lato sensu est quodlibet munus quod in spiritualem finem legitime exercetur; stricto autem sensu est munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica constitutum, ad normam sacrorum canonum conferendum, aliquam saltem secumferens participationem ecclesiasticae potestatis sive ordinis sive iurisdictionis (dt.: Kirchenamt im weiten Sinn ist jedweder Dienst, der zu einem geistlichen Zwecke rechtmäßig ausgeübt wird, in einem engen Sinn jedoch ist es ein kraft göttlicher oder kirchlicher Anordnung eingerichteter Dienst, der nach der Norm der heiligen Kanones übertragen wird, und der wenigstens eine gewisse Teilhabe an der kirchlichen Weihe- oder Jurisdiktionsgewalt mit sich bringt)“.
Dabei wird zumindest in Teilen des Schrifttums seit langem beklagt (vgl. zuletzt etwa Meckel, Konzil und Codex, Paderborn 2017, 179–233; Hallermann, Die Pfarrei weiter denken, Münster 2020, 263–267; Hofmann, Das Kirchenamt des Pastoralreferenten, Münster 2022, 231–235 u. passim), dass sich der deutsche Episkopat – anscheinend aus Gründen eines eigentümlichen, die Rezeption des geltenden Rechts hindernden Verhaftetseins in Traditionen – offensichtlich dazu außerstande sieht, insbesondere auf Gemeinderefent:innen und Pastoralreferent:innen den kirchenrechtlichen Amtsbegriff anzuwenden. Stattdessen wird konsequent von einem „hauptberuflichen pastoralen Dienst“ (vgl. Rahmenstatut [1987] für Gemeindereferenten/Gemeindereferentinnen in den Bistümern der Bundesrepublik Deutschland, Ziff. 1.1; Rahmenstatut [1987] für Pastoralreferenten/Pastoralreferentinnen in den Bistümern der Bundesrepublik Deutschland, Ziff. 1.1; ebenso Rahmenstatuten und -ordnungen für Gemeinde- und Pastoral-Referenten/Referentinnen, Ziff. 1.3.2 und passim) gesprochen. Und auch der Grundtext „Macht und Gewaltenteilung in der Kirche – Gemeinsame Teilnahme und Teilhabe am Sendungsauftrag“ des Synodalen Wegs, obschon er „klare kirchenrechtliche Begriffe“(hier, S. 27, vor Nr. 47) und „genaue Unterscheidungen“ (hier, S. 29, vor Nr. 50) einfordert, denkt augenscheinlich im Gegensatz von „Ämtern“, dessen Träger (nur) Geweihte sind, und „Diensten“, die auch ungeweihten Gläubigen offenstehen (vgl. hier, S. 30, Nrn. 51–52).
Einen erfrischend anderen – nach dem eben Gesagten wohl nicht der deutschen Theologie entspringenden – Akzent setzt in dieser Frage das am 20.06.2023 vorgestellte Instrumentum Laboris (Arbeitspapier) für die erste Sitzung der sechzehnten ordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode (vgl. dazu cc. 342–348 CIC, insbesondere aber c. 345 CIC), welche im Oktober dieses Jahres in Rom zusammentreten wird. Das Instrumentum Laboris ist so aufgebaut, dass auf ein Vorwort zunächst ein allgemeiner Teil mit Reflexionen über „eine Reihe grundlegender Eigenschaften oder Unterscheidungsmerkmale einer synodalen Kirche“ folgt; hieran schließen sich als besonderer Teil drei „Arbeitsblätter“ zu den als prioritär angesehenen Themenfeldern „Gemeinschaft“, „Sendung“ und „Teilhabe“ an, die zunächst Erkenntnisse aus den bisherigen Etappen des vorbereitenden Weges (auf nationaler und kontinentaler Ebene) zusammenfassen und hierzu etliche, in der Generalversammlung zu diskutierende Fragen formulieren. Dabei wird in B 2.2 die Aufmerksamkeit auf die „Taufämter“ (ital.: „Ministeri battesimali“, engl.: „baptismal Ministries“) gelenkt, also auf Ämter, die – in einer auf ihre Sendung ausgerichteten, „voll und ganz dienstamtlichen Kirche“ (ital.: „Chiesa tutta ministeriale“; engl.: „all-ministerial Church“) – theologisch auf der Taufgnade beruhen. (Anders als der Verfasser dieses Beitrags im ersten Moment irrig meinte, bezeichnet der Begriff des „Taufamts“ also nicht bzw. nicht exklusiv das Amt des außerordentlichen Taufspenders, vgl. dazu c. 861 § 2 CIC.) Das Instrumentum Laboris hält zur Theologie der „Taufämter“ fest:
„Ohne die Wertschätzung für die Gabe des Weihesakraments zu schmälern, werden die Ämter ausgehend von einer dienstamtlichen Auffassung der gesamten Kirche verstanden. Es ergibt sich eine sachliche Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils mit der Anerkennung der Taufwürde als Fundament für die Teilhabe aller am Leben der Kirche. Die Taufwürde wird leicht mit dem gemeinsamen Priestertum als Wurzel der Taufämter verbunden.“ (B 2.2., lit. a])
So verdienstvoll einerseits die unbefangene Verwendung des Amtsbegriffs für kirchliche Ämter, deren Träger Laien sind, ist, so bemerkenswert ist freilich auch, dass das Instrumentum Laboris die Taufämter weiter in drei Kategorien unterteilt, nämlich in eingesetzte Taufämter, außerordentliche Taufämter und faktische Taufämter. Dazu skizziert das Papier, dass es zum einen Ämter gibt, die spontan – gemeint wohl: ohne Zutun der Bischöfe – entstehen; zum anderen Ämter, die ohne eine förmliche Einsetzung in der Kirche anerkannt sind; sowie schließlich Ämter, die eine „Einsetzung“ – gemeint wohl: eine genauere kirchenrechtliche Konfiguration – und damit „eine besondere Ausbildung, Sendung und Stabilität erhalten“.
Insoweit geht der Amtsbegriff des Instrumentum Laboris also über den kirchenrechtlichen Amtsbegriff des CIC/1983 hinaus, denn das Kirchenamt im Sinne des kodikarischen Rechts kann nicht spontan entstehen, sondern bedarf der Einrichtung durch die Kirche, d.h. durch die kirchlichen Autoritäten (vgl. c. 145 § 1 CIC). Und ebenso kann sich nach kodikarischer Rechtslage niemand selbst spontan zum Amtsträger machen, sondern ist das Verfahren einer kanonischen Amtsübertragung zu beachten. Dies wiederum ist – wie c. 146 CIC unmissverständlich klarstellt – keine reine Förmlichkeit aus Gründen der äußeren Ordnung, sondern so wesentlich, dass die Gültigkeit (oder Ungültigkeit) der Amtsübertragung und damit die Rechtmäßigkeit der Amtsinhaberschaft davon abhängen.
Ein mittelfristiges Korrektiv gegen Wildwuchs im Bereich der Taufämter sieht das Instrumentum Laboris allerdings wohl darin, dass offene „Fragen durch eine intensivere synodale Arbeit in den Ortskirchen beantwortet werden“ (vgl. B 2.2, lit. c]) und sich „die für die Gemeinschaft notwendigen Taufämter durch Unterscheidung herauszukristallisieren“ (ebd.).
Auch in manch anderer Hinsicht lässt das Instrumentum Laboris aus kanonistischer Sicht aufhorchen und ist bisweilen recht erhellend.
Die Macher des Arbeitspapiers haben ersichtlich folgende Vision von Synodalität: Die Bischöfe (bzw. die Synodalversammlung hören (hört) auf das Volk Gottes („decision-making“) und würdigen (würdigt) dann den Glaubenssinn des Gottesvolkes in einem kollegialen Akt der Unterscheidung („decision-taking“), vgl. Vorwort, Ziff. 10; B 3.2, Ziff. 5; B 3.5, lit. e]); und passim. Insofern stehen zwar das Volk Gottes und die Bischöfe gewiss in einer „Beziehung“ – auch dies meines Erachtens eines der Schlüsselwörter des Instrumentum Laboris, welches negativ gewendet zugleich Verschiedenheit, Trennung und Abstand signalisiert. Jedoch wird damit glasklar und unmissverständlich eine Differenz zwischen Beratung und Entscheidung markiert; oder noch schärfer formuliert: Dem Volk Gottes wird implizit die (Kompetenz und) Zuständigkeit für die Unterscheidung der zuvor im „Gespräch im Geist“ formulierten Beiträge und Standpunkte abgesprochen. Es sind die Bischöfe, denen das „Charisma der Unterscheidung“ (vgl. B 2.5 lit. b]) zukommt. Oder nochmal anders und etwas gefälliger gesagt: Die „synodale und die hierarchische Dimension [sind] […] beide für die Kirche konstitutiv“ (B 3.2, lit. b]), wobei „es der Gemeinschaft leichter gelingt, die Legitimität von Entscheidungen anzuerkennen und sie zu akzeptieren, wenn die Autorität sie im Rahmen synodal geprägter Prozesse trifft“ (ebd.).
Etwas verwunderlich, aber hier nicht zu vertiefen, ist bei alldem die augenscheinliche Anwendung offenbarungstheologischer Kategorien („sensus fidelium“, vgl. dazu besonders B 2.5, Ziff. 5; B 3.2, lit. d]; ferner Vorwort, Ziff. 11) auf Fragen, die ganz überwiegend nicht die Glaubenslehre der Kirche, sondern disziplinäre und administrative Themen betreffen und insoweit als Instrumente der Erkenntnis zunächst einmal Vernunft und gesunden Menschenverstand verlangen. Völlig überhöht von der passiven Inerranz der Gläubigen her argumentierend indes B 3.5, lit. d):
„Wie könnte ein nicht-kollegialer Akt das unterscheiden, was der Geist der Kirche durch die Konsultation des Gottesvolkes sagt, denn dieses ‚kann im Glauben nicht irren‘ (LG 12)?“
Näherer Betrachtung wert ist dabei der Nachdruck, mit dem für die bischöfliche Unterscheidung die Qualität eines kollegialen Akts verlangt wird, vgl. dazu B 3.4, Ziff. 2; B 3.5, lit. d). Man hätte zu gerne Gewissheit darüber, ob dies eine eher rhetorische, oder eine (theologische und) rechtliche Ansage ist. Wäre letzteres der Fall, so könnten im Zuge der bischöflichen Unterscheidung von allen im Volk Gottes in den synodalen Prozess eingebrachten Meinungen und Ansichten nur jene Bestand haben, die auf dem jeweiligen (nationalen, internationalen, kontinentalen, weltweiten) Level von allen (!) Bischöfen einmütig (!) gebilligt werden. Eine bloße Mehrheit würde hingegen nicht genügen.
Zur Arbeitsweise der Synodalversammlung findet sich in B 1, Ziff. 48, die klare Auskunft:
„Die Synodalversammlung kann nicht als repräsentativ und gesetzgebend im Sinne eines parlamentarischen Gremiums mit seiner mehrheitsbildenden Dynamik verstanden werden.“
In B 2.3 wird die Frage aufgeworfen, was zu einer stärkeren Anerkennung und Förderung der Taufwürde von Frauen beitragen kann. Aufgrund jener „Pluralität der Erfahrungen, Standpunkte und Perspektiven“ (ebd., lit. d]), die bei den Kontinentalversammlungen zutage getreten sei, müsse man freilich „vermeiden, Frauen als homogene Gruppe oder abstraktes oder ideologisches Diskussionsthema zu behandeln“ (ebd.). Erst als vorletzte der aus dem bisherigen Prozess abgeleiteten Fragen für die Unterscheidung wird die Forderung der Mehrheit der Kontinentalversammlungen – die deutsche Übersetzung nennt, anders das italienische bzw. englische Original, explizit den Nahen Osten, Lateinamerika, Ozeanien und Europa – zur Diskussion gestellt, den Zugang von Frauen zum Diakonat neu zu überdenken.
Für eine Reflexion des Verhältnisses der Taufämter zu den Weiheämtern wird in B 2.4, Ziff. 8, gefragt, ob es möglich sei, „dass Laien insbesondere an Orten, an denen die Zahl der geweihten Amtsträger sehr gering ist, die Leitungsrolle in der Gemeinde übernehmen dürfen?“ Der Blick ins Gesetz – alte Juristenweisheit – erleichtert die Rechtsfindung, denn etwa c. 517 § 2 CIC gibt einen beachtlichen Hinweis darauf, dass dies jedenfalls nicht völlig abwegig ist, vgl. dazu aber auch hier.
Zwecks nämlicher Reflexion wird sodann ebd., Ziff. 9, gefragt, ob es möglich sei, „eine Reflexion dazu zu eröffnen, ob die Regeln für den Zugang zum Priesteramt für verheiratete Männer zumindest in einigen Bereichen überarbeitet werden können?“ Die verschachtelte – um nicht zu sagen: verdruckste – Formulierung lässt erahnen, dass es hier nicht um die leicht (und selbstverständlich mit „Ja“) zu beantwortende Frage geht, ob man de lege ferenda die Norm des c. 1042 Nr. 1 CIC abändern kann (vgl. dazu auch hier); sondern um die durchaus geringfügig komplexere Frage, ob dies in Abwägung allen Für und Wider opportun ist.
In den Überlegungen unter B 2.5 zur Neugestaltung des Bischofsamts werden die Bischöfe dazu aufgefordert, sich auf mehr Synodalität einzulassen, das heißt „gemeinsam als Volk Gottes zu gehen und einen synodalen Stil von Kirche zu fördern“ (ebd., lit. a]), „ohne die Teilhabe aller als Bedrohung ihres Leitungsamtes zu betrachten“ (ebd.). Zugleich lässt das Instrumentum Laboris – so die bescheidene Meinung des Verfassers dieses Beitrags – jedoch keinen Zweifel daran, dass nicht das Konzept des Bischofsamts, sondern allein die Modalitäten seiner Amtsausübung zur Debatte stehen (vgl. explizit ebd., lit. c]). Die Entscheidungsprozesse sind im Sinne einer „größeren Transparenz und Rechenschaftspflicht“ (ebd.; vgl. auch B 3.1, lit. d]) aus- bzw. umzugestalten, dies aber wohlgemerkt so, dass ein Abdriften in die „Mechanismen der politischen Demokratie“ (ebd.) vermieden wird. Denn es gilt:
„Ebenso wie die Vielfalt der Charismen ohne Autorität zur Anarchie wird, wird die Strenge der Autorität ohne den Reichtum der Charismen, Ämter und Berufungen zur Diktatur.“
Dazu wird der Synodalversammlung aufgetragen, eine Kriteriologie für den Fall zu entwickeln, dass ein Bischof sich bei seiner Entscheidung über den Ratschlag seiner Beratungsorgane hinwegsetzen möchte (vgl. ebd., Ziff. 4).
In B 3.1, lit. c) nimmt das Arbeitspapier das in der ersten Phase des synodalen Prozesses formulierte Desiderat auf, „insbesondere für Bischöfe stärker partizipative Auswahlverfahren einzuführen“.
Wiederholt und am eindringlichsten vielleicht in B 3.1, Ziff. 4, wird in einer besseren, für eine Kultur der Synodalität sensibilisierenden Ausbildung der Kandidaten für die Weiheämter der Schlüssel zu einer nachhaltig synodalen Kirche gesehen. Dazu wird ebd. sogar ein Austausch über „die Neuausrichtung der Curricula an den theologischen Fakultäten“ angeregt.
In B 3.2, Ziff. 2, wird die Synodalversammlung aufgefordert, jene Änderungen im Kirchenrecht zu benennen, die erforderlich sind, um das „Gespräch im Geist“ des Volkes nebst dem Zuhören der anschließend zur Unterscheidung berufenen Bischöfe zu institutionalisieren und zur normalen Praxis werden zu lassen.
Bezüglich weltlicher Modelle von Partizipation wird in B 3.2, Ziff. 8, eine Prüfung erbeten, ob diese für mehr Synodalität in der Kirche in Wahrheit förderlich oder hinderlich sind.
In B 3.3, lit. 3), wird an den Wunsch aus den Kontinentalversammlungen erinnert,
„kirchenrechtlich zu intervenieren, indem zwischen dem in den geltenden Vorschriften stark bekräftigten Autoritätsprinzip und dem Prinzip der Teilhabe wieder ein Gleichgewicht hergestellt wird; indem die synodale Ausrichtung der bereits bestehenden Institute gestärkt wird; und indem neue Institute geschaffen werden, insoweit dies für die Bedürfnisse des Lebens der Gemeinschaft notwendig erscheint, und indem über die effektive Anwendung der Vorschriften gewacht wird.“
Dem entsprechend wird die Synodalversammlung ebd., Ziff. 1, zu Betrachtungen darüber aufgefordert, inwiefern „sich die kirchenrechtlichen Strukturen und die pastoralen Vorgehensweisen ändern [müssen], um Mitverantwortung und Transparenz zu fördern?“
Erstaunlich ist, dass der Heilige Vater ausgerechnet von der Generalversammlung der Bischofssynode sich die gewiss von Ortskirche zu Ortskirche unterschiedliche Antwort auf die Frage erhofft, welche „Hindernisse (geistig, theologisch, praktisch, organisatorisch, finanziell, kulturell) […] der Umwandlung der derzeit kirchenrechtlich vorgeschriebenen Teilhabegremien in Organe mit effektiver gemeinschaftlicher Unterscheidung entgegen [stehen]?“ (B 3.3, Ziff. 3).
Eine etwas irreführende Übersetzung aus dem italienischen bzw. englischen Original begegnet in B 3.4, Ziff. 3. Papst Franziskus hatte in seiner Ansprache vom 17.10.2015 anlässlich der 50-Jahr-Feier der Errichtung der Bischofssynode, in: AAS 107 (2015), 1138–1144, erklärt: „Dobbiamo riflettere per realizzare ancor più, attraverso questi organismi, le istanze intermedie della collegialità, magari integrando e aggiornando alcuni aspetti dell'antico ordinamento ecclesiastico (dt.: Wir müssen nachdenken, um durch diese Organismen die Zwischeninstanzen der Kollegialität noch mehr zur Geltung zu bringen, eventuell durch Integration und Aktualisierung einiger Aspekte der alten Kirchenordnung)“. Nachdem das Instrumentum Laboris zunächst in B 3.4, lit. c), an dieses Statement erinnert, wird ebd., Ziff. 3, als zu diskutierenden Frage vorgeschlagen: „Quali elementi dell’antico ordinamento ecclesiastico è opportuno integrare e aggiornare per rendere effettivamente le Strutture Gerarchiche Orientali, le Conferenze Episcopali e le Assemblee continentali istanze intermedie di sinodalità e collegialità? (ital.); „What elements of the ancient ecclesiastical order should be integrated and updated to make the Eastern Hierarchical Structures, Episcopal Conferences and Continental Assemblies effective instances of synodality and collegiality?” (engl.). Es geht also darum, ob und ggf. welche Aspekte der antiken kirchlichen Rechtsordnung in aktualisierter Form in das geltende Kirchenrecht integriert werden können. In der deutschen Übersetzung kommt dieser Sinn nur ungenau zur Geltung, wenn gesagt wird: „Welche Punkte der alten Kirchenordnung sollten ergänzt und aktualisiert werden, um die ostkirchlichen hierarchischen Strukturen, die Bischofskonferenzen und die Kontinentalversammlungen effektiv zu Zwischeninstanzen für Synodalität und Kollegialität zu machen?“ Vielmehr kann der weniger aufmerksame Leser den Eindruck gewinnen, die Verfasser bzw. die Übersetzer des Arbeitspapiers würden das geltende Kirchenrecht bereits pejorativ als die „alte Kirchenordnung“ bezeichnen, bezüglich deren Ergänzungs- und Aktualisierungsbedürftigkeit nicht mehr das „Ob“, sondern nur noch das „Wie“ zu klären ist.
In B 3.5 wird als zentrale Frage für die Unterscheidung platziert, wie die Synodalversammlung das „Experiment“ (!) der Teilnahme einiger Nicht-Bischöfe bewertet. Diese Teilnehmer:innen werden ebd., Ziff. 3b, als „qualifizierte Zeugen“ bezeichnet, wobei die Qualifizierung als „qualifiziert“ meines Erachtens in einer erheblichen Spannung zu der mehrfach erinnerten Forderung steht, Synodalität mit größtmöglicher Inklusion zu verbinden und auf die Partizipation von Armen, Alten, Ausgegrenzten, Behinderten, Frauen, Jugendlichen, Kranken, Minderheiten und Ungebildeten (vgl. B 2.2., Ziff. 5; B 3.2, lit. a]; B 3.3, lit. b]) zu achten.
In der Gesamtschau all dessen ist wohl eine gewisse Skepsis angebracht, ob – zumal angesichts erster Auflösungserscheinungen, vgl. dazu hier, hier, hier, hier und hier – der deutsche Synodale Weg aus der Weltsynode – bildlich gesprochen – Honig wird saugen zu können und durch sie auf einmal römischen Rückenwind erhält, vgl. dazu aber hier. Jedenfalls wurde in den wenigen bisherigen Äußerungen der Protagonist:innen des Synodalen Wegs dieser Frage keine allzu große Aufmerksamkeit gewidmet, vgl. dazu hier, hier und hier. Aber sei dem, wie es ist. Die Kirchenrechtswissenschaft jedenfalls darf sich auf einen spannenden Herbst und eine intensive Synoden-Intersessio freuen, in der das Synodensekretariat – wie es in der Einführung zu den Arbeitsblättern heißt – bestrebt sein wird, jene
„notwendigen vertiefenden Studien, vor allem theologischer und kirchenrechtlicher Art, im Hinblick auf die zweite Tagung der Synodenversammlung im Oktober 2024 [zu] fördern.“
„§ 1 Cappellanus omnibus facultatibus instructus sit oportet quas recta cura pastoralis requirit. Praeter eas quae iure particulari aut speciali delegatione conceduntur,cappellanus vi officii facultate gaudet audiendi confessiones fidelium suae curae commissorum, verbi Dei eis praedicandi, Viaticum et unctionem infirmorum administrandi necnon sacramentum confirmationis eis conferendi, qui in periculo mortis versentur.“
„§ 1 Es ist notwendig, dass der Kaplan mit allen Befugnissen ausgestattet ist, die eine ordnungsgemäße Seelsorge erfordert. Außer dem, was durch das Partikularrecht oder durch besondere Delegation zugestanden wird, hat der Kaplan kraft Amtes die Befugnis, die Beichte der seiner Sorge anvertrauten Gläubigen zu hören, ihnen das Wort Gottes zu verkündigen, die Wegzehrung und die Krankensalbung zu spenden und denen das Sakrament der Firmung zu erteilen, die sich in Todesgefahr befinden.“
von Martin Rehak
In der neutestamentlichen Lesung des Pfingstsonntags berichtet der auctor ad Theophilum, dass die in Jerusalem versammelten Diasporajuden aus der ganzen Welt die Predigt der galiläischen Jünger Jesu in ihrer je eigenen Muttersprache verstehen konnten (vgl. Apg 2,1-13). Durch dieses Wunder des Heiligen Geistes konnte gemäß dieser Erzählung also die sprichwörtlich gewordene Babylonische Sprachverwirrung (vgl. Gen 11,1-9) zumindest partiell und vorübergehend rückgängig gemacht werden.
Die Sprache und damit das Problem der Verständigung mit Fremden ist auch Thema etlicher Kanones des kodikarischen Rechts, nämlich in cc. 249, 257 § 2, 518, 825 § 1, 826 § 2, 838 § 3, 928, 1471 u. 1474 § 2 CIC. Dabei eröffnet c. 518 CIC die Möglichkeit, für Katholikinnen und Katholiken fremder Zunge unter dem Gesichtspunkt ihrer Sprache Personalpfarreien zu errichten.
Für das Bistum Würzburg hat der Diözesanbischof als partikularkirchlicher Gesetzgeber am 5. Mai 2023 eine Ordnung für Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache in der Diözese Würzburg, in: Abl Würzburg 169 (2023) Nr. 5 vom 23.05.2023, 223–229, erlassen, die während der Pfingstoktav am 1. Juni 2023 in Kraft getreten ist. Diese Ordnung beruht – neben den Leitlinien für die Seelsorge an Katholiken anderer Muttersprache der Deutschen Bischofskonferenz vom 13.03.2003 sowie den von der Deutschen und der Polnischen Bischofskonferenz vereinbarten Richtlinien für die polnischsprachige Seelsorge in Deutschland vom 17.09.2001 – auf der Instruktion Erga migrantes caritas Christi (EMCC) des seinerzeitigen Päpstlichen Rates zur Seelsorge für Migranten und Menschen unterwegs vom 03.05.2004. (Dieser Päpstliche Rat wurde zwischenzeitlich von Papst Franziskus zusammen mit drei weiteren Päpstlichen Räten zum Dikasterium für den Dienst zugunsten der ganzheitlichen Entwicklung des Menschen verschmolzen, vgl. dazu Franziskus, Motu Proprio Humanam progressionem vom 17.08.2016, in: AAS 108 [2016], 968–972.)
Die Würzburger Ordnung ist auf der obersten Gliederungsebene in fünf Abschnitte (Präambel, Rechtliche Bestimmungen, Gemeinden für Katholiken anderer Muttersprache, Leitung und pastorale Kooperation der Gemeinde für Katholiken anderer Muttersprache, Seelsorge für Katholiken anderer Muttersprache außerhalb eigener Gemeinden für Katholiken anderer Muttersprache) strukturiert. Damit wird bereits auf dieser Ebene sprachlich signalisiert, dass es um die Organisation von (muttersprachlichen) Gemeinden und nicht um die Bildung von Personalpfarreien geht.
In der Präambel wird darauf aufmerksam gemacht, dass bezüglich der klassischen Grundvollzüge der Kirche die Pastoral mit Katholiken anderer Muttersprache vor allem die Dimensionen der διακονία (Nächstenliebe) sowie der κοινωνία (Gemeinschaft) betrifft. Dabei verwirklicht sich Gemeinschaft in einem weiten Sinn, der „Partizipation, Geschwisterlichkeit und interkulturelle Begegnung“ umfasst. Es gelte, die Spannung zwischen Beheimatung in der muttersprachlichen Gemeinde als Ort der Pflege der eigenen religiösen Kultur und Traditionen einerseits und den Wunsch nach Integration in die gemeindlichen (Pfarr-)Strukturen andererseits wahrzunehmen und für einen ständigen Austauschprozess zu nutzen, um so beidseitig kulturelle und ethnische Grenzen zu überwinden.
Im kurzen Abschnitt über die rechtlichen Bestimmungen wird auf die oben bereits genannten weiteren Rechtsquellen hingewiesen.
Der Abschnitt über Gemeinden für Katholiken anderer Muttersprache ist in fünf Punkte untergliedert. Demnach kann, falls dies aufgrund der jeweiligen Zahl der im Bistum lebenden Katholiken anderer Muttersprache angeraten ist, für diese eine eigene Gemeinde errichtet werden. Diese Gemeinde hat die Rechtsform einer „missio cum cura animarum“ im Sinne von Art. 7 EMCC, wobei im Deutschen der veraltete Terminus der „Ausländer-Mission“ vom Begriff der „muttersprachlichen Gemeinde“ abgelöst wird. Eine solche Gemeinde besteht nach ihrer Errichtung diözesanweit, wobei ggf. eine weitere Untergliederung in (rechtlich unselbstständige) Regionen denkbar ist. Die besagte Rechtsform ist rein kirchenrechtlicher Natur, so dass eine staatskirchenrechtliche Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts bzw. als Kirchenstiftung nicht in Betracht kommt und die muttersprachliche Gemeinde selbst auch nicht am weltlichen Rechtsverkehr teilnehmen kann. Ihr Vermögen ist vielmehr eine Kostenstelle im Haushalt des Bistums. Wenn eine derartige Gemeinde errichtet wurde, so gehören Katholiken, die die jeweilige Muttersprache sprechen und sich auf dem Territorium des Bistums Würzburg aufhalten, ohne weiteres kraft tatsächlichen Aufenthalts sowohl dieser Gemeinde als auch kraft Wohnsitzes, sofern gemäß cc. 100–107 CIC ein solcher begründet wird, der Pfarrei des Wohnsitzes an. Wie bereits in Art. 6 § 1 S. 2 EMCC vorgesehen, können diese Katholiken wählen, ob sie sich in pastoralen und kirchenamtlichen Angelegenheiten an die Wohnsitzpfarrei oder an die muttersprachliche Gemeinde respektive deren jeweiliges Personal wenden. Ebenso steht es ihnen frei, sich am kirchlichen Leben der Pfarrei und/oder der Gemeinde zu beteiligen. Die Nutzung der bestehenden pfarreilichen Infrastruktur durch muttersprachliche Gemeinden ist zwischen den muttersprachlichen Gemeinden und den Kirchenstiftungen vertraglich zu regeln, wobei dem bischöflichen Referenten für die muttersprachliche Seelsorge eine Aufsichtsrolle zukommt. Muttersprachliche Gemeinden bilden in der Regel einen gemeinsamen Pastoral- und Vermögensrat, dessen Mitglieder parallel zu den Kirchenverwaltungen gewählt, hilfsweise – wenn eine Wahl nicht durchführbar erscheint – nach vorheriger Bereitschaftserklärung vom Leiter der Gemeinde ernannt werden.
Im Abschnitt über die Leitung und pastorale Kooperation der Gemeinde für Katholiken anderer Muttersprache wird zunächst in drei Punkten der priesterliche Leiter („Missionar“) einer muttersprachlichen Gemeinde, seine Rechte und Pflichten, sowie seine Besoldung und Versicherung in den Blick genommen. Der leitende Priester muss demnach qualifiziert sein und für seine Tätigkeit die Erlaubnis seines Bischofs bzw. seines höheren Oberen besitzen. Bei der Findung geeigneter Priester ist gegebenenfalls das Auslandssekretariat der Deutschen Bischofskonferenz einzubeziehen. Die Ernennung zum Gemeindeleiter erfolgte auf bestimmte Zeit, in der Regel für fünf Jahre, wobei Verlängerungen möglich sind. Der Leiter einer muttersprachlichen Gemeinde hat gegenüber den ihm anvertrauten Gläubigen die Rechte und Pflichten eines Personalpfarrers, die er gemäß Art. 7 § 2 EMCC kumulativ mit dem Ortspfarrer bzw. den Teampfarrern im Pastoralen Raum ausübt und wahrnimmt. Dies schließt insbesondere die ordentliche Befugnis zur Trauungsassistenz in sich ein (vgl. dazu auch c. 1110 CIC). Ebenso sind die Leiter der muttersprachlichen Gemeinden verpflichtet, die üblichen pfarrlichen Matrikelbücher zu führen (vgl. dazu auch c. 535 CIC). Dabei bleibt das bisherige Inkardinationsverhältnis (vgl. dazu cc. 265-270 CIC) des Priesters, der mit der Leitung einer muttersprachlichen Gemeinde betraut wird, unverändert. Allerdings untersteht ein solcher Priester der Jurisdiktion des Bischofs von Würzburg, vertreten durch den Referenten für die Seelsorge von Gemeinden für Katholiken anderer Muttersprache in der Hauptabteilung Seelsorge als Dienstvorgesetzten. (Unzutreffend insoweit wohl übrigens der Verweis auf Art. 19 EMCC, richtig wäre meines Erachtens Art. 10 EMCC.) Die Regelungen über Besoldung und Versicherung zielen auf eine Gleichbehandlung mit den übrigen im Bistum inkardinierten Priestern bzw. im Rahmen von Gestellungsverträgen für das Bistum tätigen Ordensgeistlichen ab. In zwei weiteren Punkten wird sodann die Unterstützung des Leiters einer muttersprachlichen Gemeinde durch weitere Priester und pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die fragliche Muttersprache beherrschen, sowie die Kooperation in den Pastoralen Räumen und den Dekanaten angesprochen.
Im Abschnitt über die Seelsorge für Katholiken anderer Muttersprache, für die keine eigene muttersprachliche Gemeinde errichtet wird, bestimmt die Ordnung, dass der Bischof geeignete Kapläne mit der Wahrnehmung der Seelsorge betrauen kann. Dabei sind nicht die „Kapläne“ im umgangssprachlichen Sinne des Wortes (in etwa: Priester zwischen Priesterweihe und Zweiter Dienstprüfung bzw. erstmaliger Ernennung zu Pfarrer), sondern die Kapläne im kirchenrechtlichen Sinn im Blick, also gemäß cc. 564 ff. CIC jene Priester, die einen kategorialen Seelsorgeauftrag für eine bestimmte Gemeinschaft oder einen besonderen Kreis von Gläubigen innehaben. Im Zuge der diesbezüglichen Ausführungen beinhaltet die Ordnung auch ihren ersten und einzigen konkreten Verweis auf das kodikarische Recht: „[Diese Kapläne] haben die in c. 566 § 1 CIC genannten Befugnisse.“
Dabei handelt es sich im Einzelnen um folgende Befugnisse:
- Beichtvollmacht (vgl. c. 966 § 2 CIC), allerdings ähnlich wie in den Fällen der cc. 968 § 2, 969 § 2 CIC personal beschränkt, nämlich hier auf die dem Kaplan anvertrauten Gläubigen einer bestimmten Muttersprache im Bistum;
- Predigtbefugnis (vgl. c. 764 CIC);
- vorrangiges Recht (und Pflicht) zur Spendung der Krankensalbung (vgl. c. 1003 § 2 CIC);
- Recht (und Pflicht) zur Spendung der Wegzehrung (vgl. c. 911 § 1 CIC);
- Recht zur Spendung der Firmung in Todesgefahr (vgl. c. 883 Nr. 3 CIC).
Auch die drei genannten Rechte in Bezug auf Spendung der Sakramente gelten dabei nur in Bezug auf die dem Kaplan anvertrauten Gläubigen.
Von der Option, dem Kaplan partikularrechtlich weitere Vollmachten und Befugnisse einzuräumen, macht die Würzburger Ordnung keinen Gebrauch. Stattdessen wird klargestellt, dass ein Kaplan nicht über eine Trauungsvollmacht kraft Amtes verfügt, sondern diese ggf. durch Delegation (vgl. dazu c. 1111 CIC) vom Pfarrer des Ortes der Eheschließung erworben werden muss. Ebenso führt der Kaplan keine Matrikelbücher, sondern meldet einschlägige Amtshandlungen dem örtlichen Pfarrbüro, wo sie in das entsprechende pfarrliche Buch eingetragen werden. Denkbar ist, dass ein muttersprachlicher Kaplan für mehrere Diözesen ernannt wird, was hinsichtlich der genauen Modalitäten des Dienstes und der Besoldung genauere Absprachen zwischen den beteiligten Bistümern voraussetzt.
Die neue Würzburger Ordnung für Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache macht auf ihre Weise deutlich, dass die eine Kirche viele Völker und Sprachen in sich vereint, die so zugleich die katholische Vielfalt und Fülle veranschaulichen. Das pfingstliche Sprachwunder hingegen scheint ein einmaliges Ereignis gewesen zu sein. Und dennoch: Wäre es nicht wunderbar, wenn auch heute alle Christen – oder zumindest die deutschen Katholiken – zu einer Sprache des Glaubens fänden, in der jeder den anderen versteht?
„Salvo praescripto can. 1550, § 2, n. 2, ab obligatione respondendi eximuntur:
1° clerici, quod attinet ad ea quae ipsis manifestata sunt ratione sacri ministerii; civitatum magistratus, medici, obstetrices, advocati, notarii aliique qui ad secretum officii etiam ratione praestiti consilii tenentur, quod attinet ad negotia huic secreto obnoxia;
2° qui ex testificatione sua sibi aut coniugi aut proximis consanguineis vel affinibus infamiam, periculosas vexationes, aliave mala gravia obventura timent.“
„,Unbeschadet der Vorschrift des can. 1550, § 2, n. 2
sind von der Beantwortungspflicht ausgenommen:
1° Kleriker hinsichtlich dessen, was ihnen aufgrund ihres geistlichen Amtes bekannt geworden ist; Beamte, Ärzte, Hebammen, Anwälte, Notare und andere Personen, die zur Wahrung des Amtsgeheimnisses selbst aufgrund beratender Tätigkeit verpflichtet sind, hinsichtlich der dieser Schweigepflicht unterliegenden Angelegenheiten;
2° wer aus seiner Aussage für sich, seinen Ehegatten oder seine nächsten Blutsverwandten oder Verschwägerten Rufschädigung, gefährliche Belästigungen oder sonstige schwere Schäden befürchtet.“
von Martin Rehak
Am 7. Mai 2019 hatte Papst Franziskus das Motu Proprio Vos estis lux mundi (VELM), in: AAS 111 (2019) 823–832, erlassen, mit dem sowohl gemäß Art. 1 § 1 lit. a VELM für Sexualdelikte des kirchlichen Strafrechts – vgl. dazu nach der Reform des kirchlichen Strafrechts von 2021 die cc. 1395 § 3, 1398 – als auch gemäß Art. 1 § 1 lit. b VELM für die Vertuschung von Sexualdelikten des kirchlichen Strafrechts durch Bischöfe und bestimmte andere kirchliche Amts- und Würdenträger eine innerkirchliche Anzeige- und Meldepflicht eingeführt wurde. Gemäß seiner Schlussklausel trat das Motu Proprio am 1. Juni 2019 in Kraft und war zunächst auf drei Jahre ad experimentum approbiert, wurde aber auch nach Ablauf dieser Frist weiterhin angewandt (vgl. dazu jüngst beispielsweise hier). Nach einer Evaluation der Bestimmungen, in die auch die Bischofskonferenzen und die Dikasterien der römischen Kurie einbezogen wurden, hat der Heilige Vater am 25. März diesen Jahres eine aktualisierte Fassung erlassen (vgl. dazu hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier und hier), die am 30. April 2023 in Kraft getreten ist.
Das Motu Proprio Vos estis lux mundi war und ist durch einige wenige Bezugnahmen mit dem kodikarischen Recht verzahnt. Gemäß Art. 2 § 2 VELM war und ist bei der kircheninternen Bearbeitung einschlägiger Anzeigen das Amtsgeheimnis gemäß c. 471 Nr. 2 CIC zu beachten, um die Sicherheit, die Unversehrtheit und die Vertraulichkeit der Meldungen zu gewährleisten. Diese Norm verfolgt wohl hauptsächlich den Zweck zu verhindern, dass betroffene Personen gegen ihren Willen als solche geoutet werden; zugleich verringert sie im Falle falscher Verdächtigungen das Problem von Rufschädigungen nach dem Motto „aliquid semper haeret“. Art. 4 § 2 VELM enthielt und enthält eine Schutznorm zugunsten von Hinweisgebern (Whistleblowern), die – solange sie sich nicht selbst gemäß c. 1390 CIC wegen einer wider besseren Wissens falschen Verdächtigung strafbar machen – wegen ihrer Anzeigeerstattung in keiner Weise diskriminiert werden dürfen, so dass im Gegenteil etwaige Diskriminierungen des Hinweisgebers ihrerseits den Vertuschungstatbestand aus Art. 1 § 1 lit. b VELM erfüllen können. In weiteren Bestimmungen von VELM wurde aus gegebenem Anlass auf sonstige Normen des kodikarischen Rechts, nämlich in Art. 3 § 1 VELM zum Begriff des Ordinarius auf c. 134 CIC, in Art. 12 § 5 VELM zur Beiziehung eines kirchlichen Notars auf c. 483 § 2 CIC, in Art. 13 § 1 VELM zur Beiziehung qualifizierter Laien auf c. 228 CIC und in Art. 16 § 1 zur eventuellen Einrichtung eines Untersuchungskosten-Fonds auf cc. 116, 1303 § 1 Nr. 1 CIC, verwiesen.
Art. 3 § 1 VELM in der Fassung von 2019 hatte die Meldeplicht, die das Motu Proprio Klerikern und Ordensleuten auferlegte, so ausgestaltet, dass in den Fällen des c. 1548 § 2 CIC die Informationen über eine tatsächliche oder mutmaßliche Sexualstraftat des kanonischen Rechts und/oder deren Vertuschung von der Meldeplicht ausgenommen waren.
C. 1548 ist eine Norm des kanonischen Prozessrechts, näherhin aus dem Recht der Beweismittel und regelt in § 2 das Zeugnisverweigerungsrecht aus persönlichen und sachlichen Gründen, wie es auch konzeptionell ähnlich aus Bestimmungen des weltlichen Rechts (z.B. §§ 383, 384 ZPO, §§ 52, 53 StGB) bekannt ist. Dabei lassen sich in etwa drei Fallgruppen unterscheiden:
In der ersten Fallgruppe finden sich demnach Kleriker, die gemäß c. 1548 § 2 Nr. 1 Alt. 1 CIC vor kirchlichen Gerichten keine Auskunft über Sachverhalte geben müssen, die ihnen „aufgrund ihres geistlichen Amts bekannt geworden“ sind. Diese Formulierung ist von einer gewissen Unschärfe und Weite, was die genaue Abgrenzung der Reichweite des Zeugnisverweigerungsrechts (bzw. dann der Ausnahme von der Meldepflicht gemäß VELM/2019) erschwert. Kanonistisch klar ist lediglich, dass das Zeugnisverweigerungsrecht gemäß c. 1548 § 2 Nr. 1 Alt. 1 CIC offensichtlich weiter reicht als die Zeugnisunfähigkeit gemäß c. 1550 § 2 Nr. 2 CIC, welche ausdrücklich dem Schutz des Beichtgeheimnisses im Falle sakramentaler Beichten dient (vgl. dazu auch cc. 983, 1386 CIC). Zu Recht ist deshalb in der Literatur die Frage aufgeworfen worden, ob nun Informationen, die insbesondere im Rahmen einer geistlichen Begleitung erlangt wurden, der Meldepflicht unterliegen oder hiervon ausgenommen sind (vgl. Damián G. Astigueta, Lettura di Vos estis Lux Mundi, in: Periodica 108 [2019], 517–550, hier 534 f.). Darüber hinaus umfasst die Norm aber auch jene Fälle, in denen Sachverhalte, die ein Kleriker im Forum externum erlangt, einer beruflichen Schweigepflicht unterliegen. Damit war die Ausnahmeregelung letztlich so weit formuliert, dass sie potenziell geeignet war, den Sinn und Zweck von Vos estis lux mundi ins Leere laufen zu lassen und ad absurdum zu führen.
In der zweiten Fallgruppe geht es um sonstige Berufsgeheimnisträger, nämlich Beamte, Ärzte, Hebammen, Anwälte, Notare und andere Personen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit einer standesrechtlichen Schweigepflicht unterliegen. Nachdem das kanonische Recht jedenfalls keinerlei Ärzte und Hebammen betreffende Normen vorhält, lässt sich ohne weiteres argumentieren, dass das kanonische Recht hier implizit (auch) auf die jeweilige Rechtslage nach weltlichem Recht Bezug nimmt. Die Vorgängernorm des can. 1755 § 1 Nr. 1 CIC/1917 war insofern klarer formuliert und stellte ausdrücklich auf weltliche Amtsträger ab. Nach dem Wegfall dieser Präzisierung ergibt sich nun freilich auch für Beamte, Anwälte und Notare im Sinne des Kirchenrechts sowie für andere Personen, die nach Kirchenrecht einem Amtsgeheimnis unterliegen, ein Zeugnisverweigerungsrecht. Nachdem es zwar vorkommen kann, aber nicht der Normalfall ist, dass die der Meldepflicht unterliegenden Kleriker und Ordensleute zugleich einem Zivilberuf als Arzt, Hebamme, Rechtsanwalt etc. nachgehen und in diesem Kontext von Sexualstraftaten des kanonischen Rechts erfahren, dürfte diese Fallgruppe in der Praxis von Vos estis lux mundi kaum eine Rolle gespielt haben.
In der dritten Fallgruppe schließlich wird einem Zeugen dann ein Zeugnisverweigerungsrecht eingeräumt, wenn er aus seiner Aussage Nachteile für seinen Ehegatten oder seine nächsten Blutsverwandten oder seine nächsten Verschwägerten befürchtet. Insoweit wird in der Literatur teils die Auffassung vertreten, der Begriff des „nächsten Blutsverwandten“ bzw. des „nächsten Verschwägerten“ sei unbestimmt und der gemeinte Personenkreis müsse vom Gericht in Abwägung mit der Bedeutung der Zeugenaussage für das jeweilige Gerichtsverfahren jeweils neu festgelegt werden (vgl. MKCIC–Lüdicke, c. 1548 Rz. 6). Dieser Auffassung kann nur gefolgt werden, wenn man das lateinische „proximus“ hier nicht als Superlativ („nächster“), sondern als Elativ („sehr naher“) auffasst. Bei wörtlichem Verständnis der Norm kommen nämlich in Ansehung der cc. 108, 109 CIC als „nächste“ verwandte oder verschwägerte Person nur solche in Betracht, die mit dem Zeugen im ersten Grad der geraden Linie verwandt oder verschwägert sind, also die eigenen Eltern, Kinder, Schwiegereltern sowie Schwiegertochter bzw. Schwiegersohn. Nicht mehr „nächste“ Verwandte und Verschwägerte sind dagegen schon die Großeltern, Enkel, Geschwister, Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen nebst deren Ehepartnern. Für eine elativische Auslegung der Norm spricht auch hier der Vergleich mit der wesentlich präziser formulierten Vorgängernorm des can. 1755 § 2 Nr. 2 CIC/1917, die auf Verwandte und Verschwägerte in allen Graden der geraden Linie sowie (nach damaliger „germanischer“ Zählung) im ersten Grad der Seitenlinie – nach jetziger „römischer“ Zählung also in deren zweitem Grad (= Geschwister) – abstellte. Nachdem es zwar vorkommen kann, aber nicht der Normalfall ist, dass mutmaßliche Täterinnen oder Täter einer Sexualstraftat des kanonischen Rechts zugleich nächste Angehörige und Verschwägerte der der Meldepflicht unterliegenden Kleriker und Ordensleute sind, dürfte auch diese Fallgruppe in der Praxis von Vos estis lux mundi kaum eine Rolle gespielt haben.
Aufgrund dieser Unklarheiten in der Auslegung des c. 1548 § 2 CIC und angesichts der durch diesen Verweis eröffneten, unnötig weitreichenden Ausnahmen von der grundsätzlichen Meldepflicht ist es nicht verwunderlich, dass nach der Überarbeitung des Motu Proprio Vos estis lux mundi im jetzt geltenden Art. 3 § 1 VELM die Bezugnahme auf diesen Kanon gestrichen und die Ausnahmeklausel grundlegend neu formuliert worden ist. Sie lautet nunmehr:
„Salvo nel caso di conoscenza della notizia da parte di un chierico nell’esercizio del ministero in foro interno, … (dt.: Ausgenommen der Fall, in dem ein Kleriker in Ausübung seines Dienstes im Forum internum eine [im Sinne von Art. 1 VELM relevante] Information erlangt, …)“
In kritischer kanonistischer Würdigung wird man dies als einen Fortschritt würdigen können, der gleichwohl Anlass zu weiteren Anfragen gibt. Zum besseren Normverständnis und zur leichteren Normanwendung trägt nämlich bei, dass die eher abseitigen Fallgestaltungen aus c. 1548 § 2 Nr. 1 Alt. 2 und c. 1548 § 2 Nr. 2 CIC nunmehr keine Ausnahmen von der Meldepflicht mehr begründen.
Vielmehr greift die Ausnahme von der Meldepflicht nur dann, wenn die Information erstens in einer Situation des Forum internum und zweitens von einem Kleriker erlangt wurde.
Was das erste Kriterium anbelangt, ist damit zunächst geklärt, dass einschlägige Informationen dann, wenn sie im Forum externum erlangt wurden, ohne Weiteres meldepflichtig sind. Was nun den Begriff des Forum internum anbelangt, so ist dieser zwar im kanonischen Recht nicht legaldefiniert. Klar ist jedoch, dass er über das Beichtgeheimnis (forum internum sacramentale) hinaus einen weiteren, durch besondere Vertraulichkeit geschützten Bereich (forum internum extrasacramentale) umfasst. Letzterer dürfte etwa das besondere Vertrauensverhältnis zwischen Seminarist und Spiritual, aber darüber hinaus die in der Literatur diskutierte geistliche Begleitung im Allgemeinen und wohl auch sonstige Gespräche mit eindeutig seelsorglichem Charakter umfassen. Es ist insoweit also künftig dem Gewissen des einzelnen Klerikers anheimgestellt, ob er über meldewürdige Informationen, die er außerhalb einer Beichte im Forum internum erlangt, schweigt oder diese freiwillig weitergibt, weil er im Einzelfall den Interessen des Allgemeinwohls einen Vorrang vor der Vertraulichkeit der Seelsorgsbeziehung einräumt.
Was nun das zweite Kriterium anbelangt, wird man über dieses „Klerikerprivileg“ geteilter Meinung sein dürfen. Anscheinend hat der Gesetzgeber ohne groß nachzudenken die Vokabel Kleriker aus c. 1548 § 2 Nr. 1 Alt. 1 CIC übernommen. Dass es insbesondere in weiblichen Ordensgemeinschaften auch Nichtkleriker geben dürfte, die sich in Sachen geistlicher Begleitung (ihrer Mitschwestern oder nicht ordensangehöriger Dritter) engagieren, hat man dabei möglicherweise nicht bedacht.
Abgesehen davon, dass man sich über diesen mutmaßlichen Mangel an Geschlechtersensibilität wundern kann, ist das Resultat in der Sache – also rein kanonistisch und rechtspolitisch betrachtet – durchaus ambivalent: Einerseits führt dies dazu, dass das Forum internum zwischen einem Kleriker und einem Dritten stärker geschützt ist als das Forum internum zwischen einem Laienbruder bzw. einer Ordensschwester und einem Dritten. Ob es für diese Ungleichbehandlung einen sachlichen Rechtfertigungsgrund gibt, erscheint fraglich. Andererseits trägt dieses „Klerikerprivileg“ dazu bei, die Zahl der Ausnahmen von der allgemeinen Meldepflicht gemäß Art. 3 § 1 VELM gering zu halten. Das fördert wiederum den generellen Zweck des Motu Proprio, in Sachen sexueller Missbrauch in der Kirche für mehr Achtsamkeit, Verantwortungsübernahme, Transparenz und Rechenschaft der Täter und sonstigen Verantwortlichen zu sorgen.
Ob dies jedoch immer und in jedem Einzelfall dem wahren Interesse der beteiligten Dritten entspricht, sei dahingestellt. Handelt es sich bei der dritten Person um eine Täterin oder einen Täter, wird ihm faktisch die Möglichkeit genommen, auch außerhalb einer sakramentalen Beichte über seine Situation zu sprechen, ohne unmittelbar eine kirchliche (und ggf. auch weltliche) Strafverfolgung fürchten zu müssen. Handelt es sich bei der dritten Person um ein Missbrauchsopfer, so möchte diese Person möglicherweise nicht gegenüber einem größeren Personenkreis als Betroffene geoutet werden. In beiden Fällen sind also Belange des Allgemeinwohls und des Vertrauensschutzes gegeneinander abzuwägen.
Bei einer solchen Gemengelage unterschiedlicher Interessen wird deutlich, dass Rechtspolitik im Allgemeinen und die ideale Gestaltung von Regel-Ausnahme-Verhältnissen im Besonderen ein schwieriges Geschäft sind. Dabei mag alter Normbestand, wie im hier erörterten Beispiel etwa c. 1548 § 2 CIC, die Basis und einzelne Bausteine bilden. Die damit einhergehenden Schwierigkeiten legen freilich die Vermutung nahe, dass neues Recht auch neue Formulierungen benötigt, um gut zu funktionieren.
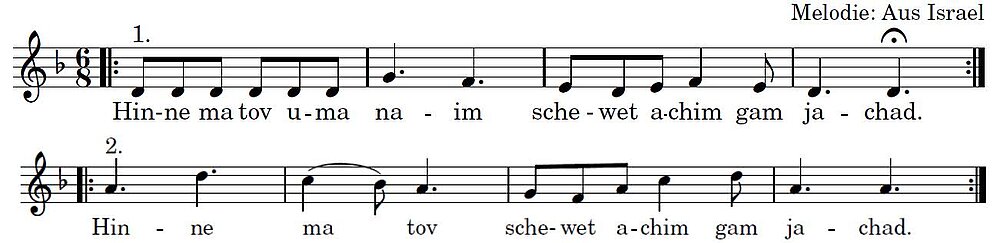
von Theodor Seidl
Eine weitere populäre Vertonung eines biblischen Textes in Kanonform aus dem modernen Israel[1] soll nach „Haschiwenu, Adonaj, elächa“ (Klgl 5,21) im letzten Jahr wieder an dieser Stelle vorgestellt, erklärt und gewürdigt werden. Es ist der zweistimmige Kanon „Hinne ma tov u-ma naim[2], dem als Text der erste Vers des Wallfahrtspsalms 133 im hebräischen Urtext zugrunde liegt:
hinne ma tov u-ma naim schewet achim gam jachad.
Der Text lautet in wörtlicher Wiedergabe:
„Siehe, wie schön, und (siehe,) wie lieblich ist das Wohnen von Brüdern wirklich zusammen.“
1. Zur Satzstruktur: Das Deiktikon hinne eröffnet den überrascht bewundernden Ausruf[3], der mit dem adverbiellen ma[4] und zwei Adjektiven (Prädikate) gebildet ist. Sie rühmen das einträchtige Zusammensein von Brüdern (Subjekt des Nominalsatzes: schewet achim gam jachad); dabei klingt beim Adjektiv tob die Billigungsformel des ersten Schöpfungsberichts an (Gen 1,4.10 u.ö.), beim Adjektiv na’im die Liebespoesie des Hohenlieds (Hld 1,16;7,7). Die sprachliche Ausdrucksform für das „wirkliche Zusammen der Brüder“ ist das komitative Adverb jachad, verstärkt durch den Fokuspartikel gam[5].
2. Die genauere semantische Füllung der zentralen Termini „Wohnen von Brüdern“ bleibt freilich offen[6], wie oft in der Poesie der Psalmen; dies ist ein Merkmal ihrer Zeitlosigkeit und ein Impuls zu ihrer subjektiven variablen Deutung.
Es bleibt offen, ob schewet als dauerndes „Wohnen“ oder als zeitbegrenztes „Sitzen“ zu deuten ist, ob also in Ps 133,1 die soziale Wohngemeinschaft auf Dauer oder die punktuelle kultische Feier oder ein aktuelles Festbegängnis staunend gewürdigt wird.
Ebenso bleibt offen, ob achim die Klein- oder Großfamilie[7], die soziale Gemeinschaft von Dorf bzw. Stadt oder die kultische (Tempel-)Gemeinschaft bezeichnet.
Diese Offenheit und Unbestimmtheit setzt sich in den im Psalm 133 folgenden Vergleichen der V. 2.3 fort:
„Wie herabfließendes Öl auf Bart und Gewand Aarons“ assoziiert den sich ausbreitenden Duft von Öl bei einem Festmahl; „wie herabfließender Hermonstau auf die Berge Zions“ lässt zunächst an die wichtige Quelle der Fruchtbarkeit des Landes denken, dann an die von der Kultgemeinschaft auf dem Zion ausgehende Segensfülle. In jedem Fall hat – das ist das tertium comparationis[8] – die innige Eintracht einer Brüdergemeinschaft positive Wirkung und umfassende Ausstrahlung auf andere menschliche Gemeinschaften oder auf die ganze Gesellschaft Israels.
Im Ausgang des Psalms (V.3) wird deutlich, dass bei den vorangegangenen Vergleichen auch der göttliche Segen gemeint ist, der sich vom Kult auf dem Zionsberg verbreitet und dessen Wirkung in einem „Leben auf die Dauer“ (V.3b) besteht.
So dürfte der situative Hintergrund von Ps 133 doch eher kultisch und nicht national[9] sein. Dann besingen die kühnen und nicht eindeutigen Bilder und Vergleiche dichterisch entweder die Einheit und Gemeinschaft der Feiergemeinde auf dem Zion, was die Zugehörigkeit zur Reihe der Wallfahrtspsalmen (Ps 120-134) rechtfertigte, oder die Eintracht der dortigen priesterlichen Gruppen, was die Erwähnung Aarons nahe legt.
3. Die Kanonvertonung bezieht die schwierigen Vergleiche der V.2.3 nicht mit ein und beschränkt sich auf den inhaltlich ebenso offenen V.1; schon damit lässt sie viel Raum für Assoziationen zur Identifizierung der bestaunten menschlichen Gemeinschaft.
Die Melodielinie der Kanonvertonung verbleibt im Tonraum einer Oktave (d – d‘). Im 1. Teil übersteigt sie den Quartraum nicht (d-g) und verharrt lange auf dem Grundton d.
Der 2. Teil schwingt sich über die Quint zur Oktave auf und erreicht den Höhepunkt auf dem Textausruf ma tov; die Melodie umspielt dann den Quintton a. Beide Teile werden wiederholt. Beim zweistimmigen Kanongesang dominieren Quint- und Quartklänge; nur in den Achteln des jeweils vorletzten Taktes ergeben sich kurz auch Terzklänge.
Ein wiegender 6/8-Takt ist der rhythmische Ausdruck der besungenen Einheit und Eintracht der „Brüder“.
4. Aus der neueren Wirkungsgeschichte von Ps 133 verdient seine Vertonung in den „Chichester Psalms“ von Leonard Bernstein (1965)[10] besondere Hervorhebung. Im 3. Satz des Werkes ist zunächst der introvertierte und auf Selbstbescheidung bedachte Ps 131 vertont. Als Gegengewicht fügt Bernstein das Lob der Gemeinschaft, den bewundernden Ausruf hinne ma tov u-ma naim aus Ps 133,1 an, der das Gesamtwerk beschließt. Der Komponist lässt diese Rühmung jeglicher menschlicher Gemeinschaft im schlichten homophonen Chor-Satz nahezu choralartig erklingen; dabei wird die steigernde Aussage gam yahad – „wirklich zusammen“ wiederholt. Mit einem „Amen“ in vierfachem piano schließt das Werk.
5. Eine dem hebräischen Urtext nahe Übersetzung von Ps 133 sei beigegeben[11]:
1a Siehe, wie schön,
b und (siehe,) wie lieblich ist das Wohnen von Brüdern wirklich zusammen.
2a (Das ist so) wie das edle Öl auf dem Haupt herabfließt auf den Bart, auf Aarons Bart,
aR das herabfließt auf den Saum seiner Gewänder / der herabfließt in seiner ganzen Größe[12].
3a (Das ist so) wie der Hermonstau,
aR der herabfließt auf die Berge Zions.
b Denn dort hat Jahwe den Segen befohlen, Leben auf die Dauer.
[1] Siehe die wertvolle Sammlung von Uehlinger, Christoph, Hebräische Lieder, Fribourg 1982.
[2] Im deutschen Sprachraum aufgenommen z.B. in die Liedersammlungen Kumbaya. Ökumenisches Jugendgesangbuch. Lieder und Texte, Zürich 1980; Uehlinger (s. Anm. 1), Nr. 12, S. S.15; Ökumenischer Kirchentag Berlin 2003 (Hg.), gemeinsam unterwegs. Lieder und Texte zur Ökumene, Stuttgart 2003, Nr. 34 um zwei deutsche Strophen erweitert; „In Gottes Namen fahren wir“. Lieder und Gebete für unterwegs, Stuttgart 62015, Nr. 6 mit einer zusätzlichen deutschen Strophe.
[3] Brockelmann, Carl, Hebräische Syntax, Neukirchen 1956, § 12 spricht von der „verwunderten Frage“.
[4] Die analoge Verbindung ma+Adjektiv/Verb liegt u.a. auch vor in Gen 28,17; Num 24,5; Ps 8,2; 119,97; Hld 7,2. Die Satzfolge in Num 24,5a-6d weist eine ähnliche kontextuelle Weiterführung mit vier Vergleichsätzen auf. Diese Formation eines erstaunten Ausrufs ist kaum Indiz für einen „Weisheitsspruch“, den Zenger (s. Anm. 6) 635.641 und vor ihm bereits Kraus (s. Anm. 7), 889f. für Ps 133,1 ansetzen.
[5] Terminologie nach Richter, Wolfgang, Wortarten im Althebräischen. Arbeitsblatt, München 1993.
[6] Überblick über die wichtigsten Lösungsvorschläge und ihre Diskussion bei Zenger, Erich, Psalm 133, in: ders./Hossfeld, Frank-Lothar (Hg.), Psalmen 101–150 (Herders Theologischer Kommentar zum Alten Testament), Freiburg 2008, 631–649.
[7] Von Kraus, Hans-Joachim, Psalmen. 2. Teilband (Biblischer Kommentar Altes Testament 15/2), Neukirchen 31966, 890 aus familienrechtlichen Gründen favorisiert.
[8] Mit Zenger (s. Anm. 6), 643; er spricht von der „doppelten Wirkmächtigkeit“, die die beiden Vergleiche ausdrücken.
[9] Wegen der Erwähnung des Hermon hat man in der Auslegungsgeschichte auch an die Einheit von Nord- und Südreich gedacht, so erstmals Norin, Stig, Ps 133. Zusammenhang und Datierung, in: Annual of the Swedish Theological Institute 11 (1978), 77–89, dazu Zenger (s. Anm. 6), 640.
[10] Dazu Seidl, Theodor, „Wacht auf, Harfe und Saitenspiel“ (Ps 108,3). Das Alte Testament in Kompositionen des 20. Jahrhunderts (Arbeiten zu Text und Sprache im Alten Testament 96), St. Ottilien 2013, 57–74.
[11] Satzgliederung nach Richter, Wolfgang, Biblia Hebraica transripta (BHt) (Arbeiten zu Text und Sprache im Alten Testament 33.11), St. Ottilien 1993, 534.
[12] Alternativübersetzung nach Keel, Othmar, Kultische Brüderlichkeit – Ps 133, in: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 23 (1976), 68–80, hier: 73.
„§ 2 Quae de rescriptis statuuntur praescripta, etiam de licentiae concessione necnon de concessionibus gratiarum vivae vocis oraculo valent, nisi aliud constet.“
„§ 2 Die für Reskripte erlassenen Vorschriften gelten auch für die Erteilung einer Erlaubnis und für die mündliche Gewährung von Gnadenerweisen, wenn nicht etwas anders feststeht.“
von Martin Rehak
In der Typologie des kanonischen Rechts versteht man unter einem Reskript im Allgemeinen einen schriftlich erlassenen Verwaltungsakt, mit dem die kirchliche Autorität auf ein Gesuch zwecks Gewährung eines Privilegs, einer Dispens oder eines anderen Gunsterweises reagiert (vgl. c. 59 § 1 CIC).
Kein Reskript im technischen Sinn ist dagegen das sogenannte Reskript aus der Papstaudienz („Rescriptum ex audienta“), mit dem Leiter der römischen Dikasterien gelegentlich Anordnungen verschriftlichen, welche der Heilige Vater mündlich – also im Wege des (in c. 59 § 2 CIC beiläufig erwähnten) „oraculum vivae vocis“ – erteilt hat. Zu diesen Reskripten eigener Art, bei denen es sich bisweilen weder um einen Verwaltungsakt noch um die Reaktion auf ein entsprechendes Gesuch handelt, hat Heribert Schmitz in einer Studie aus dem Jahr 1991 bereits alle wesentlichen Feststellungen getroffen (siehe Heribert Schmitz, Rescriptum ex Audientia SS.mi. Ein Beitrag zur Formtypik kirchlicher Erlasse, in: MThZ 42 [1991], 371–394).
Zu den immerhin 13 rescripta ex audienta, die Schmitz für den Zeitraum von 1969 bis 1990 recherchiert hat, sind allein im laufenden Pontifikat mittlerweile weit über 40 weitere dieser zunächst nur mündlich getroffenen Entscheidungen hinzugekommen:
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 24.06.2013, Prot. N. 5869/G.N., von Kardinalstaatssekretär Bertone SDB bzgl. Änderungen in der Ordnung des Fondo Assistenza Sanitaria (FAS), amtlich veröffentlicht: AAS 105 (2013), 637 = AAS 105 (2013), 713;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 09.07.2013, Prot. N. 005887/G.N., von Kardinalstaatssekretär Bertone SDB bzgl. familienbezogenen Leistungen, amtlich veröffentlicht: AAS 105 (2013), 715;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 30.11.2013, Prot. Nr. 2.831/P, von Kardinalstaatssekretär Parolin bzgl. der Anwendung des Regolamento Generale della Curia Romana auf das Institutum operum religionis (IOR; Vatikanbank), amtlich veröffentlicht: AAS 105 (2013), 1187;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 24.03.2014 von Kardinalstaatssekretär Parolin bzgl. einer Änderung der Regeln für die Gewährung einer Haushaltszulage, amtlich veröffentlicht: AAS 106 (2014), 297;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 03.11.2014 von Kardinalstaatssekretär Parolin bzgl. Amtsverzicht von Diözesanbischöfen sowie vom Papst ernannten Amtsträgern, amtlich veröffentlicht: AAS 106 (2014), 882–884;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 03.11.2014 von Kardinalstaatssekretär Parolin bzgl. Zuständigkeit für Beschwerden an die Glaubenskongregation bei Verfahren über schwerwiegende Straftaten, amtlich veröffentlicht: AAS 106 (2014), 885–886;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 10.01.2015 von Kardinal Abril y Castelló bzgl. Änderung der Statuten der Kardinalskommission zur Aufsicht über das IOR, amtlich veröffentlicht: AAS 107 (2015), 286;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 04.08.2015, Prot. N. 37.314/G.N., von Kardinalstaatssekretär Parolin bzgl. Änderung des Statuts des Arbeitsamts des Apostolischen Stuhles, veröffentlich: Communicationes 48 (2016), 53 f.;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 24.11.2015, Prot. N. 37.380/G.N., von Kardinalstaatssekretär Parolin bzgl. Änderung des Statuts des Arbeitsamts des Apostolischen Stuhles, veröffentlich: Communicationes 48 (2016), 55;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 12.12.2015 von Kardinalstaatssekretär Parolin bzgl. Errichtung einer Päpstlichen Kommission für die Aktivitäten des Gesundheitssektors der öffentlichen juristischen Personen der Kirche, veröffentlicht: Communicationes 47 (2015), 390 f.;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 22.01.2016 von Dekan Pinto bzgl. Ausbildung durch die Römische Rota und Fonds für kostenlosen Rechtsbeistand, veröffentlicht: Quaderni dello Studio Rotale 23 (2016), 47 f.;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 07.03.2016 von Kardinalstaatssekretär Parolin bzgl. Vermögensverwaltung bei Selig- und Heiligsprechungsverfahren, amtlich veröffentlicht: AAS 108 (2016), 494;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 11.05.2016 von Kardinalstaatssekretär Parolin bzgl. Erfordernis der Zustimmung des Apostolischen Stuhls für neue Ordensgründungen gemäß c. 579 CIC (vgl. dazu auch hier), amtlich veröffentlicht: AAS 108 (2016), 696;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 14.06.2016, Prot. N. 302.265/A, von Kardinalstaatssekretär Parolin bzgl. Änderung des Statuts des Arbeitsamts des Apostolischen Stuhles;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 11.10.2016 von Kardinalstaatssekretär Parolin bzgl. Ratifizierung des Übereinkommens zwischen dem Heiligen Stuhl und Italien in Steuerangelegenheiten nebst Ermächtigung zum Erlass von Durchführungsbestimmungen, in: AAS 108 (2016), 1285;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 28.11.2016, Prot. N. 318.607/A, von Kardinalstaatssekretär Parolin bzgl. konsolidierte Fassung der Ordnung über familienbezogene Leistungen, amtlich veröffentlicht: AAS 108 (2016), 1422;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 28.11.2016, Prot. N. 320.205/A, von Kardinalstaatssekretär Parolin bzgl. Änderung des Statuts des Arbeitsamts des Apostolischen Stuhles;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 05.12.2016 von Kardinalstaatssekretär Parolin bzgl. Änderung der Normen über das Päpstliche Geheimnis, amtlich veröffentlicht: AAS 109 (2017), 72;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 19.12.2016 von Kardinalstaatssekretär Parolin bzgl. Aufhebung der Präfektur für die wirtschaftlichen Angelegenheiten, amtlich veröffentlicht: AAS 109 (2017), 73;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 20.12.2016 von Kardinal Abril y Castelló als Erzpriester der Basilika S. Maria Maggiore bzgl. Änderungen der dortigen Kapitelstatuten, amtlich veröffentlicht: AAS 109 (2017), 74 f.;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 05.06.2017 von Kardinalstaatssekretär Parolin bzgl. des Schreiben von Papst Franziskus vom 05.09.2016 an Mons. Fenoy von der Seelsorgsregion Buenos Aires nebst der in Bezug genommenen Criterios básicos para la aplicación del capitulo VIII de Amoris laetitia als authentisches päpstliches Lehramt, amtlich veröffentlicht: AAS 108 (2016), 1074;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 12.02.2018 von Kardinalstaatssekretär Parolin bzgl. Aufhebung der Fondazione Pio XII per l’Apostolato dei Laici nebst Errichtung des Fondo autonomo Pio XII per l’Apostolato dei Laici, amtlich veröffentlicht: AAS 110 (2018), 426;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 27.02.2018 von Substitut Becciu, bzgl. Umbenennung des bisherigen Sekretariats für Kommunikation, amtlich veröffentlicht: AAS 110 (2018), 426 = AAS 110 (2018), 1006;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 26.06.2018 von Substitut Becciu bzgl. Kooptation der Kardinäle Parolin, Sandri, Ouellet und Filoni zu den Kardinälen der bischöflichen Klasse (vgl. dazu auch hier), amtlich veröffentlicht: AAS 110 (2018), 1006 f.;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 01.08.2018 von Kardinalpräfekt Ladaria SJ zur Änderung von Nr. 2267 Katechismus der Katholischen Kirche über die Todesstrafe, in: AAS 110 (2018), 1181 f.;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 22.07.2019 von Kardinalstaatssekretär Parolin bzgl. Errichtung eines Pensionsfonds für das Personal am Kinderkrankenhaus Bambino Gesù nebst Statuten, amtlich veröffentlicht: AAS 111 (2019), 1281;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 13.11.2019 von Dekan Pinto bzgl. Zuständigkeit der Rota Romana für Ehesachen aus den Ostkirchen, amtlich veröffentlicht: AAS 111 (2019), 2050;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 03.12.2019 von Kardinalstaatssekretär Parolin und Kardinalpräfekt Ladaria bzgl. Änderungen in den Normae de gravioribus delictis, amtlich veröffentlicht: AAS 112 (2020), 70 f.;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 06.12.2019 von Kardinalstaatssekretär Parolin bzgl. Aufhebung des sogenannten päpstlichen Geheimnisses bei Anzeigen, Prozessen und Entscheidungen wegen sexuellen Missbrauchs, amtlich veröffentlicht: AAS 112 (2020), 72 f.;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 01.02.2020 von Kardinalstaatssekretär Parolin bzgl. Änderung von Statuten und Geschäftsordnung von Caritas Internationalis (vgl. dazu auch hier), amtlich veröffentlicht: AAS 112 (2020), 323;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 17.02.2020 von Kardinalstaatssekretär Parolin bzgl. Errichtung der Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 18.03.2020 von Kardinalstaatssekretär Parolin bzgl. Inkraftsetzung von außerordentlichen und dringen Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 01.04.2020 von Kardinalstaatssekretär Parolin bzgl. Verlängerung der Maßnahmen gegen die Covid-19-Pandemie, amtlich veröffentlicht: AAS 112 (2020), 373;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 01.05.2020 von Substitut Peña Parra bzgl. Kooptation von Kardinal Tagle zu den Kardinälen der bischöflichen Klasse;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 11.05.2020 von Kardinalstaatssekretär Parolin bzgl. neuer Zuordnung des Centro Elaborazione Dati (CED; Rechenzentrum) des Apostolischen Stuhls zum Wirtschaftssekretariat, amtlich veröffentlicht: AAS 112 (2020), 594;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 15.06.2020, Prot. N. 491.977, von Kardinalstaatssekretär Parolin bzgl. Änderung der Normen über das Päpstliche Geheimnis, amtlich veröffentlicht: AAS 112 (2020), 633;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 22.07.2020 von Kardinalstaatssekretär Parolin bzgl. der Jurisdiktion der katholischen orientalischen Patriarchen auf der arabischen Halbinsel;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 11.10.2021 von Kardinalpräfekt Ladaria SJ bzgl. der Neufassung der Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis, veröffentlicht: Communicationes 53 (2021), 427;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 01.03.2022 von Kardinalstaatssekretär Parolin bzgl. Einfügung von Art. 10bis zum Bereitschaftsdienst in das Regolamento Generale della Curia Romana, veröffentlicht: Communicationes 54 (2022), 129;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 01.03.2022 von Kardinalstaatssekretär Parolin bzgl. Einfügung von Art. 10bis zur Gewährung von Elternzeit in die konsolidierte Fassung der Ordnung über familienbezogene Leistungen, veröffentlicht: Communicationes 54 (2022), 132;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 18.05.2022 von Kardinalpräfekt de Aviz bzgl. der Derogation von c. 588 § 2 CIC, veröffentlicht: Communicationes 54 (2022), 194 f.;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 15.06.2022 von Kardinalpräfekt de Aviz bzgl. der Gründung von öffentlichen Vereinigungen von Gläubigen mit Fernziel der Gründung einer Ordensgemeinschaft, veröffentlicht: Communicationes 54 (2022), 196;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 23.08.2022 von Papst Franziskus (?!) bzgl. Finanzverwaltung des Apostolischen Stuhls;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 02.09.2022 von Kardinalstaatssekretär Parolin bzgl. der Ordnung der Kontrollkommission für das Sanierungsvorhaben der Kaserne der Päpstlichen Schweizergarde;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 16.09.2022 von Kardinalpräfekt Czerny SJ bzgl. Aufhebung der Fondazione Populorum Progressio;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 30.09.2022 von Kardinalpräfekt Czerny SJ bzgl. neuer Zuordnung der Tourismusseelsorge zum Dikasterium für die Evangelisierung;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi vom 20.02.2023 von Kardinalpräfekt Roche bzgl. Reservation von Dispensen vom Motu Proprio Traditionis custodes (TC) vom 16.07.2021 (vgl. dazu auch hier).
Zu diesem Motu Proprio hatte die Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung mit Rundschreiben an die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen vom 04.12.2021 einige Zweifelsfragen beantwortet und zugleich klarstellende Erläuterungen veröffentlicht.
Gemäß Art. 3 § 2 TC ist der Diözesanbischof zuständig, für Gruppen von Gläubigen, die die Eucharistie gemäß dem Messbuch von 1962, also in der außerordentlichen Form des römischen Ritus, feiern möchten, geeignete Orte zu bestimmen; jedoch (gemäß einem Klammerzusatz) keine Pfarrkirchen und ohne Personalpfarreien zu gründen. Hierzu wurde gefragt, ob ein Diözesanbischof, wenn außer Pfarrkirchen keine sonstigen Gotteshäuser zur Verfügung stehen, er die Kongregation um eine Ausnahmegenehmigung bitten kann. Dies wurde im Rundschreiben von 2021 bejaht mit der Bemerkung, dass eine Ausnahme freilich nur dann bewilligt werden könne, wenn nach einer mit äußerster Sorgfalt durchgeführten Prüfung feststeht, dass die Nutzung eines anderen Gotteshauses statt einer Pfarrkirche nicht möglich ist.
Gemäß dem neuen Reskript aus der Papstaudienz verhält es sich nun so, dass Dispensen von Art. 3 § 2 TC, d.h. Dispensen zwecks Nutzung von Pfarrkirchen für Gottesdienste in der außerordentlichen Form sowie für die Errichtung von Personalpfarreien zwecks Messfeiern nach dem Missale von 1962 dem Apostolischen Stuhl reserviert sind. (Man versteht nun auch besser, was sich der Gesetzgeber möglicherweise gedacht hat, als er Art. 3 § 2 TC mit einem Klammerzusatz ausgestattet hat; anscheinend sollte so von Anfang an zum Ausdruck gebracht werden, dass das Eingeklammerte zwar dispensabel ist, aber mit Vorbehalt zugunsten des Apostolischen Stuhls…)
Gleichsam im Gegenzug zu der Klärung, dass Dispensen nicht Akte der Gesetzgebung, sondern der Verwaltung sind, hatte – wie es im Lichte der konziliaren Lehre vom Bischofsamt und der iure divino mit der Bischofsweihe vermittelten Vollmachten nur folgerichtig ist – bei der nachkonziliaren Reform des Kirchenrechts in Sachen Dispenswesen eine grundlegende Systemumstellung stattgefunden. Das frühere Konzessionssystem, bei dem die Bischöfe in der Regel befristet für 5 Jahre vom Papst mit Dispensbefugnissen ausgestattet wurden (sogenannte Quinquennalfakultäten), wurde durch das Reservationssystem abgelöst, bei dem grundsätzlich jeder Bischof von allen Disziplinargesetzen dispensieren kann; es sei denn, der Apostolische Stuhl hätte sich die Dispens vorbehalten. Solche Reservationen der Dispenszuständigkeit zugunsten des Apostolischen Stuhls oder gar zugunsten des Papstes persönlich sind vergleichsweise selten: Zu nennen sind insbesondere die Fälle des
- c. 291 CIC (Dispens von Zölibatsverpflichtung);
- c. 767 § 1 CIC (Dispens vom Verbot der Laienhomilie, wie sich aus einer authentischen Interpretation vom 20.06.1987, in: AAS 79 [1987], 1249, ergibt);
- c. 1014 CIC (Dispens vom Erfordernis zweier Mitkonsekratoren bei Bischofsweihe);
- c. 1031 § 4 CIC (Dispens von fehlendem Mindestalter für Diakonen- oder Priesterweihe, wenn mehr als ein Jahr fehlt);
- c. 1047 §§ 1–3 CIC (Dispens von näher bezeichneten Irregularitäten für den Weiheempfang bzw. die Ausübung einer bereits empfangenen Weihe);
- cc. 1078 § 2, 1079 § 1, 1080 § 1 CIC (Dispens von den Ehehindernissen aus Weihe, Gelübde und Verbrechen, wobei die Reservation für Dispens von der Priesterweihe auch in Todesgefahr von Braut oder Bräutigam nicht gelockert wird);
- c. 1117 CIC (Dispens von der Formpflicht, wenn Braut und Bräutigam katholisch sind, wie sich aus einer authentischen Interpretation vom 05.07.1985, in: AAS 77 [1985], 771, ergibt);
- c. 1308 § 1 CIC (Dispens von Messverpflichtungen aufgrund von Messstiftungen).
Von daher befindet sich nun also Art. 3 § 2 TC in einer illustren Gesellschaft verschiedenster Normen, die man zwar nicht ohne weiteres auf einen einheitlichen Nenner bringen kann, was die tiefere theologische Begründungslogik der Reservation anbelangt, bei denen aber jedenfalls im Endeffekt feststeht, dass der römischen Zentrale hier sehr an einer weltweit einheitlichen kirchlichen Disziplin gelegen ist.
Gemäß Art. 4 TC müssen Priester, die zeitlich nach der Promulgation des Motu Proprio, die durch Abdruck im L’Osservatore Romano vom 16.07.2021 erfolgte, geweiht worden sind und gemäß dem Messbuch von 1962 zelebrieren möchten, hierfür ein formales Bittgesuch an ihren Diözesanbischof richten – Zwischenfrage: Gilt das so auch für Ordensgeistliche? –, der vor Gewährung dieser Bitte den Apostolischen Stuhl um Erlaubnis zu fragen hat. (So die Diktion des erst nachträglich veröffentlichten lateinischen Textes, der damit gegenüber dem italienischen Original des Motu Proprio, das ebenso wie die offiziösen Übersetzungen ins Englische und Deutsche von „konsultieren“ spricht, in bemerkenswerter Weise an Schärfe gewinnt.) Also Klartext: Das Bittgesuch des Priesters ablehnen kann der Diözesanbischof ohne Weiteres, es genehmigen hingegen nur mit römischer Zustimmung. Hierzu wurde gefragt, ob der Diözesanbischof also eine römische Ermächtigung benötigt, um in dieser Frage nach (auch) tridetinischer oder (nur) vatikanischer Messe Entscheidungen bezüglich der Angehörigen seines Presbyteriums zu treffen. Dies wurde bejaht mit der Bemerkung, dass es hier in der Tat um eine Ermächtigung und nicht um eine beratende Stellungnahme gehe; und dass es den Heiligen Vater sehr traurig mache, wenn nach dem 16.07.2021 geweihte Priester nicht seinen Wunsch teilten, die Eucharistie nur noch nach den von den heiligen Päpsten Paul VI. und Johannes Paul II. gebilligten liturgischen Büchern zu feiern.
Dazu stellt das neue Audienzreskript nunmehr klar, dass die Zuständigkeit, den genannten Priestern die Erlaubnis zur Messfeier nach dem Missale von 1962 zu geben, beim Apostolischen Stuhl liege.
Das Audienzreskript beansprucht eine rückwirkende Geltung und behauptet, dass Diözesanbischöfe, die bereits in der Vergangenheit Dispensen von Art. 3 § 2 TC bzw. (ohne römische Ermächtigung) Erlaubnisse nach Art. 4 TC gewährt haben, verpflichtet seien, das zuständige Dikasterium für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung zwecks dortiger Prüfung des Sachverhalts und eventueller Sanierung der (ungültigen?) bischöflichen Entscheidung zu informieren.
In einer überaus lesenswerten Analyse hat Felix Neumann nicht nur die handwerklichen Mängel des ursprünglichen Motu Proprio, wie sie im Lichte des Audienzreskripts sichtbar werden, sondern auch die innere ekklesiologische Spannung, was die Theologie des Bischofsamtes anbelangt, in beiden Dokumenten wie auch im größeren Kontext der derzeitigen synodalen Prozesse aufgezeigt. Von jener „heilsamen Dezentralisierung“ (vgl. Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii Gaudium vom 24.11.2013, dort Nr. 16), die einst wie das kirchenpolitische Programm des derzeitigen Pontifikats erschien, ist im Rescriptum ex Audientia Ss.mi vom 20.02.2023 leider nichts mehr zu spüren.
Man muss also wahrlich kein Freund traditionalistischer Kreise sein, um dieses jüngste „oraculum vivae vocis“ des Papstes nicht gut zu finden.
㤠2 Gratia a Vicario generali vel a Vicario episcopali denegata, ab alio Vicario eiusdem Episcopi, etiam habitis a Vicario denegante denegationis rationibus, valide concedi nequit.
§ 3 Gratia a Vicario generali vel a Vicario episcopali denegata et postea, nulla facta huius denegationis mentione, ab Episcopo dioecesano impetrata, invalida est; gratia autem ab Episcopo dioecesano denegata nequit valide, etiam facta denegationis mentione, ab eius Vicario generali vel Vicario episcopali, non consentiente Episcopo, impetrari.“
„§ 2 Ein von einem Generalvikar oder einem Bischofsvikar abgelehnter Gnadenerweis kann von einem anderen Vikar desselben Bischofs, auch in Kenntnis der Gründe für die Ablehnung seitens des ablehnenden Vikars, nicht gültig gewährt werden.
§ 3 Ein von einem Generalvikar oder einem Bischofsvikar abgelehnter und später ohne Erwähnung dieser Ablehnung vom Diözesanbischof erlangter Gnadenerweis ist ungültig; ein aber vom Diözesanbischof abgelehnter Gnadenerweis kann auch unter Erwähnung dieser Ablehnung ohne Zustimmung des Bischofs von dessen Generalvikar oder Bischofsvikar nicht gültig erlangt werden.“
von Martin Rehak
Am 31.01.2023 ist die von Papst Franziskus erlassene Apostolische Konstitution In ecclesiarum communione [IEC] über die Ordnung des Vikariats von Rom vom 06.01.2023 in Kraft getreten (vgl. dazu beispielsweise auch hier, hier, hier, hier und hier). Das Vikariat von Rom ist die diözesane Kurie des Bistums Rom, welches nominell vom Papst, faktisch aber von dessen jeweiligem Kardinalvikar für das Bistum Rom geleitet wird. Die neue Regelung tritt an die Stelle der von Papst Johannes Paul II. erlassenen Apostolischen Konstitution Ecclesia in Urbe vom 01.01.1998, in: AAS 90 (1998) 177–193, durch welche wiederum die von Papst Paul VI. gegebene Apostolische Konstitution Vicariae potestatis vom 06.01.1977, in: AAS 69 (1977) 5–18, novelliert worden war.
Während die Ordnung aus dem Jahr 1977 insgesamt 24 Ziffern umfasste, kam die Regelung von 1998 auf nicht weniger als 40 Artikel. Die neue Apostolische Konstitution ist sogar auf 45 Artikel angewachsen, die in fünf Titel mit den Überschriften Leitprinzipien (Artt. 1–7) – Zentrale Struktur des Vikariats (Artt. 8–20) – Organe der Synodalität im Dienst der Mission der Diözese Rom (Artt. 21–24) – Ämter, Dienste und Organe der Rechtspflege des Vikariats (Artt. 25–35) – Gerichte (Artt. 36–45) gruppiert sind. Dabei wird in Artt. 8–9 IEC zunächst grundsätzlich das Verhältnis zwischen dem Apostolischen Stuhl, dem Staat der Vatikanstadt und dem Bistum Rom angesprochen. Artt. 10–13 IEC umschreiben das Amt des Kardinalvikars. Das Amt des Stellvertreters des Kardinalvikars, der als „Vicegerente“ bezeichnet wird und dessen Stellung im Verhältnis zum Kardinalvikar in etwa der eines Generalvikars zu seinem Diözesanbischof entspricht, wird in den Artt. 13–15 IEC umschrieben. Daneben gibt es im Bistum Rom weitere Weihbischöfe, die in der Regel für bestimmte territorial abgegrenzte Sektoren zuständig sind und dort mit ordentlicher Stellvertretergewalt (vgl. dazu c. 131 § 2 CIC) ausgestattet sind (vgl. Artt. 16–19 IEC). Gemäß Art. 16 § 1 haben diese Weihbischöfe für ihre jeweiligen Zuständigkeitsbereiche die Stellung eines Bischofsvikars im Sinne der cc. 476–481 CIC. (Notabene: Der Terminus „Bischofsvikar“ darf nicht zu der Annahme verleiten, der Inhaber dieses Amtes müsse zum Bischof geweiht sein; tatsächlich ist es zumeist so, dass ein Bischofsvikar lediglich Priester ist, vgl. dazu auch c. 478 § 1 CIC.)
Sodann sieht das neue Regelwerk gemäß Art. 33 IEC nicht weniger als 38 Ämter bzw. Dienste vor, die zu insgesamt 10 Tätigkeitsfeldern zusammengefasst sind, nämlich Christliche Formation (3 Ämter); Sorge um Diakonat, Klerus und Ordensleben (5 Ämter; man beachte die mit c. 266 § 1 CIC massiv in Spannung stehende Sprachregelung, die anscheinend unter „Klerus“ nur die im Bistum Rom inkardinierten Priester versteht); Sorge für bestimmte Altersgruppen (4 Ämter); Bildungswesen (3 Ämter); Caritas (3 Ämter); Gastfreundschaft und Weltoffenheit der Kirche (8 Ämter); Güterverwaltung (3 Ämter); Rechtsabteilung (3 Ämter); Dienst des Generalsekretariats (5 Ämter) und (als Stabsstelle ohne untergeordnete Ämter) der Dienst für den Schutz von Minderjährigen und vulnerablen Personen, der über den hierfür zuständigen Weihbischof des Bistums unmittelbar dem Consiglio Episcopale (Rat der Bischöfe) berichtet.
Nachdem bereits in der einleitenden Arenga der Apostolischen Konstitution mehrfach das Motiv von Evangelisierung und Synodalität angespielt worden ist, erklärt Art. 1 IEC, dass jede Aktivität im Vikariat von Rom ihrem Wesen nach pastoral und – gemäß ihrem synodalen Stil – auf die Verwirklichung des Heilsgeheimnisses der Kirche Christi, die in Rom anwest, ausgerichtet sei. Denn so erweise sich die stadtrömische Kirche als Vorbild in der Mission, im Primat der Liebe, sowie in der Verkündigung des Erbarmen Gottes und erfülle so jene Schuld gegenüber der gesamten katholischen Kirche, die ihr aufgrund ihres apostolischen Ursprungs zukommt. Es ist bemerkenswert, irgendwie faszinierend und nachdenklich stimmend, dass damit als normativer Text jene beiden patristischen Zitate widerhallen, die Johannes Paul II. unmittelbar an den Anfang der Arenga der Apostolischen Konstitution Ecclesia in Urbe platziert hatte: Zum einen die Sentenz des Irenäus von Lyon über eine „potentior principalitas (dt. etwa: mächtigere Gründungsautorität)“, wie sie Rom aufgrund der doppelt apostolischen Gründung durch Petrus und Paulus zukomme (vgl. Irenaeus Lyonensis, Adversus haereses III,3,2); wobei Franziskus die bei Irenäus eher passive Rolle Roms als Muster, mit dem jede rechtgläubige Kirche übereinstimmen muss („necesse est convenire omnem ecclesiam“), umdeutet zu einer eher aktiven Rolle mit Rom als Schuldnerin in Sachen Vorbildlichkeit. Zum anderen das Wort des Ignatius im Proöm seines Römerbriefs, wo Rom als vorsitzend in der Liebe bezeichnet wird (vgl. Ignatius Antiochenus, Epistula ad Romanos, inscr.: „προκαθημένη τῆς ἀγάπης“) – eine Aussage, die in der folgenreichen allegorischen Interpretation des Patristikers Franz Xaver Funk (1840–1907) ein römischer Primat im Liebesbund aller Ortskirchen der Catholica bezeugen soll. Es ist bekannt, dass Franziskus mit diesem Zitat vertraut ist (vgl. Franziskus, Promulgatio am 13.03.2013, in: AAS 105 [2013] 363 f., 363: „E adesso, incominciamo questo cammino: Vescovo e popolo. Questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità tutte le Chiese. Un cammino di fratellanza, di amore, di fiducia tra noi. Preghiamo sempre per noi: l’uno per l’altro“).
Im Weiteren begegnet das Stichwort der Synodalität noch in vier weiteren Artikeln der Apostolischen Konstitution. Gemäß Art. 4 IEC sind die verschiedenen Ämter zu einer engen Koordination ihrer Aktivitäten verpflichtet, mit dem Ziel „di realizzare un’effettiva sinodalità, per una organica e fruttuosa azione pastorale, secondo gli orientamenti diocesani, i quali dovranno essere sempre frutto dell’ascolto e della corresponsabilità dei battezzati.“ Ob dies freilich so zu verstehen ist, dass eine wirksame Synodalität die Frucht des aufeinander Hörens und der Mitverantwortung aller Getauften ist, oder Letzteres zum Ergebnis einer organischen und fruchtbaren pastoralen Aktivität führt, übersteigt die fremdsprachlichen Kompetenzen des Verfassers dieses Beitrags.
In Art. 21 § 1 IEC wird der Rat der Bischöfe als das Hauptorgan der Synodalität im Bistum Rom und oberste Instanz im Prozess der Unterscheidung und für pastorale und administrative Entscheidungen in Bezug auf das Bistum und die Diözesankurie bezeichnet. Dieser Rat besteht gemäß Art. 21 § 2 aus dem Vizegerenten und den übrigen Weihbischöfen des Bistums. Deren Zahl beträgt im Bistum Rom derzeit stattliche sieben, darin eingeschlossen den Vizegerenten, nicht jedoch die weiteren drei emeritierten Weihbischöfe. Ob auch letztere dem Consiglio Episcopale angehören sollen, geht aus der Apostolischen Konstitution nicht mit letzter Klarheit hervor; indes hat die Rechtspraxis, welche gemäß c. 27 CIC als beste Auslegerin des Gesetzes gilt, bereits zu einer klaren Position in dieser Frage gefunden (vgl. hier). Klar ist jedoch, dass erstens Synodalität im Bistum Rom hauptsächlich eine Synodalität der dortigen Bischöfe meint und zweitens diese Art von Synodalität in Bistümern, die vielleicht nur über zwei, einen oder keinen Weihbischof verfügen, keine Chance auf Verwirklichung hat.
Aus Art. 21 § 3 IEC geht sodann deutlicher hervor, wie die Redeweise vom Rat der Bischöfe als oberste Entscheidungsinstanz zu verstehen ist. Das Consiglio Episcopale unterstützt demnach, wie in den Kompetenzzuweisungen der Apostolischen Konstitution im Einzelnen näher geregelt, den Kardinalvikar bald durch seine Beratung, bald durch seine Zustimmung (insbesondere in Personalangelegenheiten). Allerdings ist der Kardinalvikar dann nicht an das übereinstimmende Votum des Rates der Bischöfe gebunden, wenn der Papst seiner (des Kardinalvikars) abweichenden Bewertung beipflichtet. Insofern wird die Entscheidungskompetenz des Consiglio Episcopale letztlich wohl eher im Bereich des „decision making“, also des Prozesses der Entscheidungsfindung, verbleiben, während das „decision taking“, also das endgültige Treffen einer bestimmten Entscheidung, dem Kardinalvikar bzw. dem Papst vorbehalten bleibt.
Schließlich bezeichnet Art. 22 § 1 IEC den Diözesanpastoralrat (vgl. cc. 511–514 CIC), das Konsultorenkollegium (vgl. c. 502 CIC), einen Rat der Präfekten (Dekanekonferenz?), sowie den Priesterrat (vgl. cc. 495–502 CIC) als weitere synodale Gremien, welche vom Rat der Bischöfe zu konsultieren sind. Gemäß Art. 22 § 2 IEC werden die Sitzungen der eben genannten Gremien vom Kardinalvikar geleitet, während vom Vizegerenten und den übrigen Weihbischöfen ebenfalls die Teilnahme erwartet wird.
Nachdem der Rat der Bischöfe gemäß Art. 21 § 2 IEC mindestens drei Mal pro Monat unter der Leitung des Bischofs von Rom, hilfsweise seines Kardinalvikars, zusammentreten soll, zeichnet sich ab, dass Weihbischof in Rom zu sein auch bedeutet, viel Zeit in Sitzungen und beim Studium der Akten zu den zahlreichen Konsultationsprozessen zu verbringen.
Interessant ist schließlich auch Art. 17 IEC, der nicht nur zu den wenigen Artikeln der Apostolischen Konstitution zählt, die explizit auf Kanones des Codex Iuris Canonici verweisen (vgl. insoweit noch Art. 16 § 2: cc. 1015–1017 CIC; Art. 16 § 3: c. 409 § 2 CIC; Art. 23 § 1: cc. 492 ff. CIC; Art. 40 § 1: c. 1490 CIC; Art. 43 § 1: cc. 1419–1437 CIC), sondern ebenfalls das Motiv der Synodalität bringt. Die Norm lautet:
„Per garantire una linea di amministrazione sana e prudente e il coordinamento tra le potestà ordinarie vicarie (prima verifica di un’effettiva sinodalità), quando concomitanti e concorrenti, afferenti a un determinato territorio, si applica ciò che è disposto dal can. 65 C.I.C.“
Im Fall konkurrierender Zuständigkeit der diversen Weihbischöfe soll also c. 65 CIC gelten, um die Befugnisse der vielen Stellvertreter in gesunder und kluger Weise zu koordinieren. Denn dies wiederum – also eine derartige Koordination konkurrierender Zuständigkeiten – gilt dem Gesetzgeber als Lackmustest dafür, ob sich Synodalität als tatsächlich wirksam und praxistauglich erweist. Interessant.
Die Norm des c. 65 CIC findet sich im ersten Buch des Kodex über Allgemeine Normen im dritten Kapitel über die Reskripte, das heißt über Verwaltungsentscheidungen, die nicht initiativ von der zuständigen Autorität, sondern in Reaktion auf entsprechende Eingaben und Gesuche getroffen werden. Dabei soll zunächst c. 65 § 1 CIC verhindern, dass der Bittsteller mehrere zuständige Ordinarien in der Weise gegeneinander ausspielt, dass er sich nach Ablehnung seines Gesuchs durch einen Ordinarius einfach an den nächsten wendet, ohne dabei darauf hinzuweisen, dass das Gesuch bereits vom Amtskollegen abgelehnt worden ist.
Die §§ 2–3 des c. 65 CIC nehmen dann speziell den Fall in den Blick, dass man sich innerhalb ein und desselben Bistums nacheinander an mehrere zuständige Autoritäten wendet. Insoweit folgt aus c. 65 § 2 CIC, dass die einmal von einem Vikar abgelehnte Bitte nicht gültig von einem anderen Vikar gewährt werden kann. Mit anderen Worten schließt also die erstmalige Befassung eines bestimmten von mehreren im Bistum Rom für eine Angelegenheit zuständigen Weihbischöfen alle anderen von einer späteren nochmaligen Befassung mit dieser Angelegenheit aus.
C. 65 § 3 CIC regelt sodann das Verhältnis der Kompetenzen zwischen dem Diözesanbischof und seinen Vikaren. Gemäß dem zweiten Halbsatz des c. 65 § 3 CIC ist die ablehnende Entscheidung eines Diözesanbischofs insofern endgültig, als ein Vikar eine anderslautende Entscheidung nur dann treffen kann, wenn der Diözesanbischof einer Revision seiner ursprünglichen Ablehnung zustimmt. Gemäß dem ersten Halbsatz des c. 65 § 2 CIC ist eine positive Verbescheidung seitens eines Diözesanbischofs jedoch dann ungültig, wenn das Gesuch zuerst von einem Vikar dieses Bischofs abgelehnt und dann der Diözesanbischof angegangen wurde, ohne dass der Bittsteller dabei die vorherige Ablehnung erwähnt hat.
All dies gibt Anlass, eine kleine, aber nicht marginale kanonistische Zweifelsfrage zu formulieren:
Verlangt Art. 17 IEC eine unmittelbare oder eine analoge Anwendung des c. 65 CIC? Ist also, mit anderen Worten, für Papst Franziskus er selbst oder der Kardinalvikar des Bistums Rom der „Diözesanbischof“ im Sinn des c. 65 CIC?
Man kann vermutlich für beide Deutungen mehr oder weniger gewichtige und überzeugende Argumente beibringen. So ließe sich beispielsweise zugunsten der zweiten Auslegung ins Feld führen, dass der Verweis auf c. 65 CIC wohl kaum dazu dienen soll, den Zeit- und Arbeitsaufwand, den der Papst in die Verwaltung des Bistums Rom investiert, durch seine Zweitbefassung mit bereits einmal abgelehnten Bittgesuchen zu erhöhen. Träfe indes die erste Auslegung zu, so würde das zum einen bedeuten, dass schon gemäß c. 65 § 2 CIC der Kardinalvikar eine ablehnende Entscheidung des Vizegerenten bzw. eines anderen Weihbischofs und Bischofsvikars nicht in eine stattgebende Entscheidung umwandeln könnte. Zum anderen wäre dies ein bemerkenswerter Fall einer Selbstbeschränkung des päpstlichen Jurisdiktionsprimats, insofern die Gültigkeit einer Entscheidung des Bischofs von Rom davon abhängt, ob ein Bittsteller beim Vorbringen seines Gesuchs mit offenen Karten gespielt hat oder nicht. Eine solche Selbstbeschränkung wäre im Übrigen aus kanonistischer Sicht einfach nur löblich, insofern sich dann der Papst in der Rolle eines custos canonum (dt.: Hüter der Kanones) schlicht und ergreifend an das gesamtkirchlich geltende Recht halten würde. Von daher: Videant Romani, ne quid papatus detrimenti capiat.
Eine etwaige päpstliche Selbstbeschränkung in der Apostolischen Konstitution In ecclesiarum communione wäre im Übrigen ein bemerkenswerter Präzedenzfall zugunsten jener bischöflichen Selbstbeschränkungen, die derzeit im Rahmen des deutschen Synodalen Wegs erörtert werden. Oder sollte insoweit etwa gelten: Quod licet Iovi non licet bovi?
„Exequiae Episcopi dioecesani in propria ecclesia cathedrali celebrentur,
nisi ipse aliam ecclesiam elegerit.“
„Die Exequien für den Diözesanbischof sind in der eigenen Kathedralkirche zu feiern,
wenn er nicht selbst eine andere Kirche bestimmt hat.“
von Martin Rehak
Der Tod von Joseph Ratzinger / Benedikt XVI. (16.04.1927–31.12.2022), dessen Verzicht auf das Papstamt (eigentlich: das Amt des Bischofs von Rom) zum 28.02.2013 für manche Diskussion und kanonistische Zweifelsfrage gesorgt hat, wirft zu Beginn des Jahres 2023 auch die Frage auf, mit welchem Zeremoniell die Kirche einem „papa emeritus“ die letzte Ehre erweist.
Eine gute Methodik, sich neuen rechtlichen Problemen zu nähern, besteht darin, sich zunächst einmal der Grundlage zu vergewissern, welche das Recht für bereits altbekannte ähnliche Fallkonstellationen bereithält.
Die rechtlichen Regelungen betreffend die Beisetzungsfeierlichkeiten für einen (im Amt verstorbenen) Papst finden sich außerkodikarisch im fünften Kapitel des ersten Teils der Apostolischen Konstitution Universi dominici gregis vom 22.02.1996, in: AAS 88 (1996) 305–343, welche den Themenkomplex der Vakanz des Apostolischen Stuhls und die Wahl des neuen Papstes regelt. Die dortige Ziffer 27 ordnet neuntägige Trauerfeierlichkeiten an und verweist für Einzelheiten vollumfänglich auf das liturgische Recht, wie es im Ordo exsequiarum Romani Pontificis niedergelegt ist. Dabei nimmt Ziffer 28 von Universi dominici gregis als Regelfall an, dass die Beisetzung des verstorbenen Papstes in der Vatikanischen Basilika, d.h. in der Krypta des Petersdoms erfolgt.
Im vorliegenden Fall wäre freilich auch an c. 1178 CIC zu erinnern, der in allgemeiner Form die Exequien für einen Diözesanbischof im Blick hat und dabei nicht danach differenziert, ob dieser im Amt oder als Emeritus verstorben ist. Der Begriff der Exequien ist dabei durchaus weit zu verstehen und umfasst sowohl die Eucharistiefeier für den Verstorbenen (Requiem) als auch das Begräbnis im engeren Sinn. Ergänzend hierzu hat die Bischofskongregation im Direktorium über den Hirtendienst der Bischöfe vom 22.02.2004, dort Nr. 245, darüber instruiert, dass der Leichnam eines verstorbenen Bischofs zum Zwecke des Gebets und der Verehrung durch das Volk an einem geeigneten Ort aufzubahren ist, wobei der Leichnam mit Paramenten (liturgische Gewänder) in violetter Farbe, den Pontifikalinsignien sowie – bei Metropoliten – dem Pallium bekleidet sein soll.
Wie sich in diesen Tagen zeigt, bahnt sich die Praxis im Fall der Exequien für den „papa emeritus“ Benedikt XVI. einen Mittelweg. So finden die Exequien in einer gegenüber den Vorgaben des Ordo exsequiarum Romani Pontificis verkürzter Form statt. Nach drei Tagen Aufbahrung im Petersdom wird der Verstorbene nach einer vom amtierenden Papst zelebrierten Seelenmesse dort zur letzten Ruhe gebettet. Die Exequien finden somit nicht in der Kathedralkirche des Papstes statt; dies wäre bekanntlich die Lateranbasilika. Benedikt XVI. wurde in roten Paramenten aufgebahrt, wie es traditionell bei der Aufbahrung verstorbener Päpste üblich ist. Allerdings wurde auf das Pallium verzichtet, womit wohl symbolisch zum Ausdruck gebracht ist, dass Benedikt XVI. nicht als Amtsinhaber verstorben ist.
Durch den am 11.02.2013 erklärten Amtsverzicht des Papstes aus Bayern ist deutlich geworden, dass dieser bislang in c. 332 § 2 CIC lediglich erwähnte Sachverhalt mehr als eine nur theoretische Möglichkeit ist, für die ergänzende rechtliche Regelungen wünschenswert erscheinen. Es steht zu erwarten, dass der verstorbene vormalige Papst so noch über seinen Tod hinaus als Impulsgeber für eine Weiterentwicklung des Kirchenrechts dienen wird.
Es ist hier nicht der Ort, das Leben und Wirken von Joseph Ratzinger / Benedikt XVI. umfassend zu betrachten. Gerechtfertigt erscheint jedoch das Urteil, dass neben seinem theologischen Werk auch seine Aktivität auf dem Gebiet des Kirchenrechts eine kurze Betrachtung wert ist.
Dass das Heilige Offizium während des Zweiten Vatikanischen Konzils nach einem Aufsehen erregenden Wortwechsel in der Konzilsaula zwischen Josef Frings und Alfredo Ottaviani (vgl. dazu Acta synodalia, Bd. II/4, 616 u. 624) sich erstmals eine Verfahrensordnung gegeben hat (jetzt aktuell: Ordnung für die Lehrüberprüfung vom 29.06.1997, in: AAS 89 [1997] 830–835), verdankt sich indirekt auch Ratzinger, der als Berater des Kölner Kardinals dessen Redebeitrag entworfen hatte.
Nachdem Ratzinger als Erzbischof von München und Freising in das Kardinalskollegium aufgenommen worden war, wirkte er in der Kardinalskommission mit, welche von Johannes Paul II. für die Beratungen über das Schema von 1980 für einen neuen Codex Iuris Canonici eingesetzt worden war und die sich vom 20.–29.10.1981 zu Beratungen in einer Vollversammlung traf (vgl. dazu die Relatio animadversionum, Vatikanstadt 1981, 7).
In seiner Amtszeit als Kardinalpräfekt der Kongregation (jetzt: Dikasterium) für die Glaubenslehre war Joseph Ratzinger vor allem als Theologe sowie rechtsanwendend tätig. Dabei wird von Fachleuten angezweifelt, ob die Exkommunikationsdekrete wegen versuchter Priesterweihe von Frauen aus dem Jahr 2002 (vgl. Dekret vom 05.08.2002; Dekret vom 21.12.2002) über eine tragfähige Grundlage im damals geltenden kanonischen Strafrecht verfügten. Mit Wirkung für die Zukunft wurde diesbezüglich im Jahr 2007 ein neuer Straftatbestand geschaffen.
Ohne unmittelbare Auswirkung auf das kirchliche Verfassungsrecht sind diverse ekklesiologische Äußerungen aus dem Palazzo del Sant'Uffizio geblieben, darunter insbesondere das Schreiben über einige Aspekte der Kirche als communio vom 28.05.1992, in: AAS 85 (1993) 838–850; die Erwägungen zum Primat des Nachfolgers Petri im Geheimnis der Kirche vom 31.10.1998, in: Communicationes 30 (1998) 207–216; die Note über den Ausdruck „Schwesterkirchen“ vom 30.06.2000; sowie die vor allem seitens der evangelischen Kirche als nicht hilfreich für das ökumenische Anliegen kritisierte Erklärung Dominus Iesus über die Einzigkeit und die Heilsuniversalität Jesu Christi und der Kirche, in: AAS 92 (2000) 742–765. Obgleich im Ausgang dogmatische Fragen betreffend, kommt mehreren Wortmeldungen zum Kommunionempfang alkoholkranker oder an Zöliakie leidender Personen eine erhebliche praktische, kirchenrechtliche Bedeutung zu (vgl. Responsa ad dubia vom 29.10.1982, in: AAS 74 (1982) 1298 f.; Rundschreiben vom 19.06.1995, in: Notitiae 31 (1995) 608–610; Rundschreiben vom 24.07.2003).
Die von nicht weniger als acht Kongregationen und Räten, darunter der Glaubenskongregation unter Präfekt Ratzinger, verantwortete Interdikasterielle Instruktion Ecclesia de mysterio („Laieninstruktion“) vom 15.08.1997, die sich einlässlich zu Möglichkeiten, Grenzen und (vermeintlichen) Fehlentwicklungen, was den Einsatz von Laien im kirchlichen Dienst und insbesondere in der Liturgie anbelangt, äußert, teilt in Sachen (mangelnder) Rezeption wohl das Schicksal so einiger kirchlicher Dokumente (wie – um ein eher unverfängliches Beispiel zu geben – etwa dem Dekret Frequens des Konzils von Konstanz).
Auf dem Gebiet des kirchlichen Strafrechts wurde Ratzinger zuerst mit einem Dekret vom 23.09.1988, in: AAS 80 (1988) 1367, tätig, welches die Strafbarkeit der Verletzung des Beichtgeheimnisses durch Aufzeichnung der Beichte mit technischen Mitteln begründete. Im Jahr 2001 hat Papst Johannes Paul II. mit dem Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela vom 30.04.2001, in: AAS 93 (2001) 737–739, die Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis in Kraft gesetzt (aktuell die Fassung von 2021), durch die die Strafverfolgung bestimmter Straftaten des kanonischen Rechts der Glaubenskongregation zur Ahndung zugewiesen wurden. Hierüber konnte der Kardinalpräfekt seine Mitbrüder im Bischofsamt mit Rundschreiben vom 18.05.2001, in: AAS 93 (2001) 785–788, informieren.
Ebenfalls aus dem Jahr 2001 stammt die aktuelle Verfahrensordnung für die Auflösung des Ehebandes zugunsten des Glaubens.
In einer Note bezüglich des Spenders des Sakraments der Krankensalbung vom 11.02.2005 vertrat Ratzinger die Auffassung, dass c. 1003 § 1 CIC eine Lehre wiedergibt, die im Sinne von c. 750 § 2 CIC „definitive tenenda“ sei; die also mit anderen Worten aus historischen oder sachlichen Gründen so mit dem geoffenbarten Glaubensgut verknüpft sei, dass jene Lehre unabdingbar sei, um dieses Glaubensgut unversehrt zu bewahren und treu auszulegen. (Allerdings argumentiert der beigegebene Kommentar zu dieser Note nicht verkündigungsrechtlich – benennt also insbesondere nicht diejenige Glaubenslehre, um derentwillen die kirchliche Lehre vom Priester als Spender der Krankensalbung endgültig zu halten sei –, sondern folgert aus der lehramtlichen Tradition, die allein den Priester als Spender dieses Sakraments kennt, dass die fragliche Lehre mindestens den genannten Sicherheitsgrad aufweisen müsse.)
Eine nur scheinbar unscheinbare gesetzgeberische Maßnahme von Benedikt XVI. als neuem Papst betraf gerade das Papstwahlrecht. Mit dem Motu Proprio Constitutione apostolica vom 11.06.2007, in: AAS 99 (2007) 776 f., kassierte er die Regelung aus Ziffer 75 von Universi dominici gregis, gemäß der nach 30 bzw. 33 Wahlgängen nur noch die absolute Mehrheit erforderlich sein sollte. Stattdessen gilt jetzt weiterhin das Prinzip einer 2/3-Mehrheit, womit das Papstwahlrecht näherungsweise dem klassischen Ideal der Einmütigkeit verpflichtet bleibt. Die vorherige Regelung stand hierzu in Widerspruch, da eine Partei, die gegen eine beachtliche Sperrminorität eine knappe Mehrheit auf einen Kandidaten versammeln konnte, die Angelegenheit bis zum 31. bzw. 34. Wahlgang hätte aussitzen können, anstatt sich mit der Minderheit auf einen Kompromisskandidaten zu verständigen. Weitere Verbesserungen der Papstwahlkonstitution verfügte Benedikt XVI. zum Ende seiner Amtszeit mit dem Motu Proprio Normas nonnullas vom 22.02.2013, in: AAS 105 (2013) 253–257.
Sodann unternahm Benedikt XVI. den Versuch, mit dem Motu Proprio Summorum Pontificum vom 07.07.2007, in: AAS 99 (2007) 777–781, der Feiergestalt des Gottesdienstes gemäß den liturgischen Büchern aus dem Jahr 1962 ein neues Heimrecht in der katholischen Kirche zu schaffen und sie im Sinne eines älteren Usus bzw. einer außerordentliche Form (usus antiquior, forma extraordinaria) prinzipiell gleichberechtigt der ordentlichen Form, wie sie aus der nachkonziliaren Liturgiereform hervorgegangen war, an die Seite zu stellen. Diese gesetzgeberische Maßnahme wurde durch ein Begleitschreiben des Papstes flankiert (amtlich veröffentlicht: AAS 99 (2007) 795–799), das genauen Aufschluss über die Motive und Erwartungen des Gesetzgebers gab. Vermutlich stellte dieses Motu Proprio auch den Versuch dar, den Weg zu einer Versöhnung der Priesterbruderschaft St. Pius X. mit der Kirche zu ebnen. Zwischenzeitlich sah sich Papst Franziskus dazu gezwungen, mit dem Motu Proprio Traditionis custodes vom 16.07.2021, in: Communicationes 53 (2021) 361–364, die Weichenstellungen seines Vorgängers in einigen Punkten zu korrigieren (siehe dazu auch Kanon des Monats zu c. 923 CIC), um so die Einheit der Kirche noch besser zu fördern.
Mit dem Motu Proprio Omnium in mentem vom 26.10.2009, in: AAS 102 (2010) 8–10, wurden zum einen die theologischen Leitkanones zum Weihesakrament (cc. 1008, 1009 CIC) besser an die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils über den Diakonat (vgl. dazu LG 29) angepasst, nachdem zuvor bereits der Katechismus der katholischen Kirche in Nr. 875 entsprechend umformuliert worden war. Zum anderen wurden – deutlicher Kritik im Schrifttum folgend – die so genannten Defektionsklauseln in den cc. 1086 § 1, 1117 und 1124 CIC gestrichen und damit die (im Fall eines Scheiterns der ersten Ehe durchaus zweischneidige) eherechtliche Privilegierung von Katholiken, die durch einen formalen Akt von der Kirche abgefallen waren, beendet. Das Motu Proprio markiert somit zugleich eine Abkehr von dem jahrhundertelang die kanonische Ehegesetzgebung leitenden rechtspolitischen Prinzip, durch entsprechende Normgestaltung möglichst viele gültige Eheschließungen zu ermöglichen.
Mit der Apostolischen Konstitution Anglicanorum coetibus vom 04.11.2009, in: AAS 101 (2009) 985–990, wurde das Rechtsinstitut der Personalordinariate für Anglikaner, die unter weitgehender Beibehaltung ihrer spirituellen Traditionen zur katholischen Kirche konvertieren möchten, geschaffen. Dabei steht ein solches Personalordinariat rechtlich den Teilkirchen (= Diözesen) im Sinne des lateinischen Kirchenrechts nahe und hat keine weiterreichende ekklesiologische Dignität, wie sie nach der Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils den Kirchen eigenen Rechts im Sinne des Ostkirchenrechts zukommt.
Mit dem Motu Proprio Intima ecclesiae natura vom 11.11.2012, in: AAS 104 (2012) 996–1004, wurde die Verantwortung der Diözesanbischöfe für das caritative Wirken der Kirche unterstrichen und für die auf diesem Gebiet tätigen Vereine das kodikarische Vereinsrecht modifiziert.
Verschiedene Änderungen in der Struktur der Römischen Kurie nahm Benedikt XVI. vor mit dem Motu Proprio Ubicumque et semper vom 21.09.2010, in: AAS 102 (2010) 788–792 (Errichtung des Päpstlichen Rates für die Neuevangelisierung), dem Motu Proprio Quaerit semper vom 30.08.2011, in: AAS 103 (2011) 569–571 (Abgabe der Nichtvollzugsverfahren von der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung an die Rota Romana) sowie dem Motu Proprio Ministrorum institutio und dem Motu Proprio Fides per doctrinam vom jeweils 16.01.2013, in: AAS 105 (2013) 130–135 bzw. 828–833; 136–139 (Änderung der Zuständigkeiten der Bildungskongregation, der Kleruskongregation und des Rates für die Neuevangelisierung in Bezug auf Seminare und Katechese).
Die Reform des kodikarischen Strafrechts, mit der im Pontifikat Benedikts XVI. begonnen wurde, konnte im Jahr 2021 abgeschlossen werden (siehe dazu auch Kanon des Monats zu c. 1313 CIC und Kanon des Monats zu c. 8 § 1 CIC).
Joseph Ratzinger hatte als junger Theologe bewusst Anschluss an die französische Nouvelle Théologie gesucht, deren Konzept des Ressourcement, der Rückbesinnung auf die biblischen und patristischen Quellen des Glaubens, er auch zur Grundlage seines eigenen theologischen Denkens machte. So konnte er sich erfrischend von den Epigonen einer neuscholastischen Dogmatik abheben und wurde für viele Zeitgenossen zunächst zum Inbegriff des ökumenisch aufgeschlossenen, modernen Denkers des Christentums. Als ausdrücklicher Verfechter einer „Hermeneutik der Reform“ (statt einer Hermeneutik des Bruchs) wird er freilich wohl insgesamt als konservativ in Erinnerung bleiben. Die Nachwelt mag das Lebenswerk dieses zweifellos sehr bedeutenden und einflussreichen Theologen des 20. Jh., der auch gelegentliche Polemik um der Sache willen nicht scheute, kontrovers beurteilen. Indes kann kein Zweifel daran bestehen, dass Joseph Ratzinger / Benedikt XVI. auch auf dem Gebiet des Kirchenrechts einige bemerkenswerte Beiträge geleistet hat, die eine wertschätzende Würdigung verdienen. Requiescat in pace.
* * *
Das Team des Lehrstuhls für Kirchenrecht wünscht allen Leserinnen und Lesern dieses Beitrags ein gesegnetes und glückseliges Neues Jahr 2023.
„Evangelicum consilium paupertatis ad imitationem Christi, qui propter nos egenus factus est cum esset dives, praeter vitam re et spiritu pauperem, operose in sobrietate ducendam et a terrenis divitiis alienam, secumfert dependentiam et limitationem in usu et dispositione bonorum ad normam iuris proprii singulorum institutorum.“
„Der evangelische Rat der Armut zur Nachahmung Christi, der um unseretwillen arm wurde, obwohl Er reich war, bringt außer einem tatsächlich und der Gesinnung nach armen Leben, das nach Kräften in Bescheidenheit und fern von irdischem Reichtum zu führen ist, Abhängigkeit und Beschränkung im Gebrauch und in der Verfügung über Vermögen nach Maßgabe des Eigenrechts der einzelnen Institute mit sich.“
von Martin Rehak
Am 10.11.2022 hat das Generalsekretariat der Bischofssynode (vgl. dazu c. 348 § 1 CIC) unter dem Titel „‚Mach den Raum deines Zeltes weit‘ (Jes 54,2)“ das Arbeitsdokument für die kontinentale Etappe des Prozesses zur Vorbereitung der XVI. Ordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode, die in zwei Sessionen im Oktober 2023 und im Oktober 2024 zum Thema „Für eine synodale Kirche: Gemeinschaft, Teilhabe und Sendung“ tagen soll, in deutscher Übersetzung vorgelegt.
Das fast 50 Seiten umfassende, in vier Kapitel mit insgesamt 109 Absätzen gegliederte Arbeitsdokument zeichnet sich dadurch aus, dass im Stil einer Collage immer wieder Wortmeldungen einzelner Bischofskonferenzen, die aus der Beschäftigung mit dem Vorbereitungsdokument hervorgegangen sind, im vollen Wortlaut eingespielt werden. Auf diese Weise vermittelt der Text „eine Vorstellung von der Fülle des eingegangenen Materials“ (Arbeitsdokument, S. 4) und einen authentischen Eindruck von den Anliegen, die Bischöfe und Gläubige in verschiedenen Ortskirchen beschäftigen. Dabei kann die Auswahl der Zitate nicht so verstanden werden, als sei das formulierte Thema ausschließlich für die Bischofskonferenz oder sonstige Gruppierung virulent, die vom Generalsekretariat zitiert wird; sondern die ausgesuchten Zitate bringen „ein in vielen Berichten wiederholt angesprochenes Empfinden besonders kraftvoll, treffend oder glücklich zum Ausdruck“ (ebd.).
Es ist kaum verwunderlich, dass sich das Arbeitsdokument dabei nicht ausdrücklich zu rein kirchenrechtlichen Fragestellungen äußert. Allerdings fällt bei aufmerksamer und nachdenklicher Lektüre auf, dass doch eine Reihe von Punkten angesprochen wird, die früher oder später eine kirchenrechtliche Regelung bzw. Änderung des geltenden Kirchenrechts nach sich ziehen könnten.
- Inklusion (vgl. ebd., S. 9 [Zimbabwe]; ähnlich ebd., S. 16 [England und Wales; Pfarrgruppe aus den USA]).
- Integration und Schutz von Priesterfrauen, Priesterkindern (vgl. ebd., S. 18 [Synodensekretariat].
- Inklusion von Menschen in nichtheterosexuellen Beziehungen (vgl. ebd., S. 20 [USA; Lesotho]).
- Freimütiger Meinungsaustausch als „eine[s] der ‚ungeschriebenen Gesetze‘ der kirchlichen Kultur“ (ebd., S. 10 [Lettland]).
- Schutz vulnerabler Personen (vgl. ebd., S. 12 [Australien]).
- Keine innerkirchliche Marginalisierung armer und ungebildeter Gläubiger (vgl. ebd., S. 22 [Uganda; Philippinen]).
- Ökumene (vgl. die konträren Erfahrungen ebd., S. 24 [Zentralafrikanische Republik; Indien]).
- Abtreibung, Frauenweihe, verheiratete Priester, Zölibat (vgl. ebd., S. 25 [Südafrika]).
- Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen (vgl. ebd., S. 25 [Südafrika]; S. 43 [Malaysia]).
- Dezentralisierung und Inkulturation (vgl. ebd., S. 27 [Luxemburg]).
- Kollegiale Leitungsmodelle (vgl. ebd., S. 28 [Argentinien]) und partizipatorisches Amtsverständnis (vgl. ebd., S. 29 [Slowakei]).
- Institutionelle Einbindung von Frauen in kirchliche Entscheidungsprozesse (vgl. ebd., S. 30 [Korea]); dazu auch ebd., S. 31 [Brasilien]).
- Subsidiaritätsprinzip, insbesondere zur Klärung des Verhältnisses von Priestern und laikalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Pastoral (vgl. ebd., S. 33 [Demokratische Republik Kongo]; Klärung der Kompetenzen von Laien (vgl. ebd. [Belgien]).
- Aufwertung von Beratungsgremien zu Entscheidungsgremien (vgl. ebd., S. 37 [Synodensekretariat]).
- Mehr Transparenz, beginnend bei Gremien auf Pfarreiebene (vgl. ebd., S. 37 [private Eingabe aus dem Vereinigten Königreich].
- Mehr Kompetenz der Entscheidungsträger in wirtschaftlichen Fragen (vgl. ebd. [Synodensekretariat im Anschluss an die Bischofskonferenz des Tschad]). Man wird dies womöglich als dezenten Hinweis auf das Erfordernis einer binnenkirchlichen Korruptionsbekämpfung lesen müssen.
- Neue Schwerpunkte der Priesterausbildung (vgl. ebd., S. 39 [Myanmar: Synodalität; Sri Lanka: Anleitung pastoraler Prozesse statt priesterlicher Lebensstil]).
Besonders angerührt hat den Verfasser dieses Beitrags indes der Hinweis in der gemeinsamen Stellungnahme der Ordensoberinnen und Ordensoberen, dass
„Frauen […] für die Aufgaben und Dienste, die sie ausüben, keinen gerechten Lohn erhalten. Ordensfrauen werden oft als billige Arbeitskräfte betrachtet“ (ebd., S. 30 f.).
Denn es drängt sich die Vermutung auf, dass dieser Missstand zumindest indirekt auch durch das Kirchenrecht gestützt wird.
Während nämlich das Thema des gerechten Lohns sowohl in c. 231 § 2 CIC in Bezug auf Laien im kirchlichen Dienst als auch in c. 281 §§ 1–3 CIC in Bezug auf (Welt-)Kleriker begegnet, fehlt – soweit ersichtlich – eine vergleichbare Vorschrift im Ordensrecht. Im Gegenteil wird dort wiederholt an den evangelischen Rat (vgl. dazu Mt 19,12) der Armut erinnert, vgl. zunächst allgemein cc. 573 § 2, 574 § 1, 575, 576 u. 598 §§ 1–2 CIC.
Ausführlich wird der evangelische Rat der Armut dann in c. 600 CIC thematisiert. Ausweislich der 1989 von der Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici authentice interpretando veranstalteten, mit einem Quellenapparat ausgestatteten Ausgabe des Codex Iuris Canonici ist diese Norm ohne Vorgänger im Kodex von 1917 und greift stattdessen auf mehrere Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils zurück. Dabei ist an erster Stelle die Kirchenkonstitution Lumen Gentium zu nennen, die sich unter Nr. 42,2 dem evangelischen Rat der Armut widmet. Im Dekret Perfectae caritatis über die Erneuerung des Ordenslebens ist Nr. 13,1–2 einschlägig. Hinzu kommt aus dem Dekret Presbyterorum ordinis über Dienst und Leben der Priester die dortige Nr. 17,4.
Im Einzelnen findet sich der Gedanke, dass Ordensleute „tatsächlich und in der Gesinnung arm sein“ müssen, bereits wörtlich in PC 13,2. (Die Übersetzung dieses Passus in der offiziösen lateinisch-deutschen Kodex-Ausgabe, wo von einem „im Geiste armen Leben“ die Rede ist, muss wohl als weniger glücklich bezeichnet werden.)
An allen drei genannten Konzilsstellen begegnet das Statement, dass Christus „um unseretwegen arm wurde, da er doch reich war“ (PC 13,1; vgl. LG 42,4; PO 17,4). Dabei machen – anders als der Text des c. 600 CIC – die Konzilstexte auch deutlich, dass es sich hierbei um ein Schriftzitat handelt. Auf diese Weise wird dann übrigens auch das ansonsten vielleicht für einen Rechtstext etwas befremdliche Pathos in der Formulierung verständlich.
Es handelt sich um ein Zitat aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther, der im dortigen achten Kapitel zu einer Sammlung für „die Heiligen“ in Jerusalem, also für die dortige Christengemeinde, aufruft. Diese Kollekte erfährt in 2 Kor 8,9 eine besondere theologische Begründung und Motivation: „Denn ihr wisst was Jesus Christus, unser Herr in seiner Liebe getan hat: Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen.“
Einen Satz davor stellt Paulus allerdings klar, dass dieser Spendenaufruf keine Weisung seinerseits darstellt, sondern als Chance gesehen werden möge, die Echtheit der eigenen Nächstenliebe unter Beweis zu stellen. Die so beschworene innerkirchliche Solidarität kann in Bezug auf das von den Ordensoberinnen und Ordensoberen benannte Problem richtungsweisend sein: Selbstlosigkeit und Opferbereitschaft dürfen nicht als selbstverständlich angesehen werden und können nicht von oben herab eingefordert werden. Kirchliche Autoritäten, die die Dienste von Ordensleuten in Anspruch nehmen, müssen ihnen mit einer Haltung der Wertschätzung begegnen, die zumal in heutiger Zeit auch monetären Ausdruck findet. Der Umstand, dass Ordensleute sich nicht zwecks Erwerb von privatem Vermögen in den Dienst der Kirche stellen, berechtigt umgekehrt nicht zu der Schlussfolgerung, dass der Arbeiter, der ein Armutsgelübde abgelegt hat, entgegen dem Schriftwort aus Lk 10,7 seines Lohnes nicht wert sei.
Bei alledem kann der Kontext des Schriftzitats aus 2 Kor 8,9 auf den ersten Blick zu der Annahme verleiten, es ginge hier tatsächlich um die Frage, ob Jesus von Nazareth in einem materiell-irdischen Sinne arm oder reich war. (Es sei die Vermutung geäußert, dass der Sohn eines Handwerkers, der nach lukanischer Darstellung womöglich über Grundbesitz in Bethlehem verfügte [so die pia opinio von Michael Hesemann, vgl. auch Lk 2,2–5] und mütterlicherseits mit einer Dynastie von Tempelpriestern verwandt war [vgl. Lk 1,5–6.36], ohne weiteres dem zeitgenössischen Mittelstand zugerechnet werden konnte.)
In Wahrheit verbirgt sich jedoch im Wortspiel von arm und reich eine christologische Aussage, was spätestens bei der Lektüre von LG 42,2 deutlich wird, wo 2 Kor 8,9 mit einer Zeile aus dem bekannten Christushymnus des gleichfalls paulinischen Philipperbriefs parallelisiert wird: Christus Jesus, der sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm (vgl. Phil 2,7).
Ist man so dem Geheimnis seiner Herkunft auf die Spur gekommen, wird offenbar: Mit den Worten des Apostels Paulus erinnert c. 600 CIC an das weihnachtliche Glaubensgeheimnis von der Inkarnation des Logos (Joh 1,1.14); an die frohe Botschaft vom ‚heruntergekommenen‘ Gott, der „in unserem armen Fleisch“ (Martyrologium Romanum / Liturgie der Christmette) Mensch geworden ist.
* * *
Das Team des Lehrstuhls für Kirchenrecht wünscht allen Leserinnen und Lesern dieses Beitrags eine gesegnete Adventszeit und ein frohes & friedvolles Weihnachtsfest anno Domini 2022.
„[…] abbatia territorialis est certa populi Dei portio, territorialiter quidem circumscripta,
cuius cura, specialia ob adiuncta, committitur alicui […] Abbati, qui eam,
ad instar Episcopi dioecesani, tamquam proprius eius pastor regat.“
„Eine […] Gebietsabtei ist ein bestimmter Teil des Gottesvolkes, und zwar ein gebietsmäßig abgegrenzter,
dessen Betreuung wegen besonderer Umstände einem […] Abt übertragen wird,
der sie nach Art eines Diözesanbischofs als ihr eigener Hirte zu leiten hat.“
von Martin Rehak
Vor einigen Tagen wurde von der Katholischen Nachrichtenagentur die Meldung verbreitet, dass Papst Franziskus eine (in Presseveröffentlichungen so bezeichnete) „Wahl“ des deutschen Benediktiners Mauritius Wilde zum neuen Abt von Montecassino nicht anerkenne und stattdessen selbst den neuen Abt ernennen wolle (siehe hier, hier, hier, hier und hier). Die Gründe hierfür sollen mit dem Status Montecassinos als Territorialabtei zusammenhängen. Der Gebietsabt bedürfe als Leiter einer Teilkirche der päpstlichen Bestätigung. Insoweit soll es jedoch innerhalb der Römischen Kurie eine Meinungsverschiedenheit geben, ob hierfür das Dikasterium für die Bischöfe oder das Dikasterium für die Institute des geweihten Lebens und für die Gesellschaften des apostolischen Lebens zuständig ist. Außerdem stehe Artikel 16 der Lateranverträge, wonach kein Teil Italiens einem Bischof unterstellt sein dürfe, dessen Bischofssitz sich im Ausland befindet, einer Bestätigung entgegen. Diese Vereinbarung bedeute in der Praxis, dass in Italien kein Ausländer Bischof werden könne. Denn sonst könnten Ausländer über Geld verfügen, das im italienischen System der Kirchenfinanzierung – im Falle einer entsprechenden Widmung seitens des Steuerschuldners! – aus dem Aufkommen der staatlichen Kultursteuer („otto per mille“) an die Kirche überwiesen wird.
Dieser Fall und die kolportierten Gründe einer päpstlichen Nichtbestätigung der Abtswahl werfen eine Reihe rechtlicher und (kirchenrechts-)politischer Fragen auf.
Was zunächst das an und für sich zutreffende konkordatsrechtliche Argument anbelangt, sei folgendes richtiggestellt: Die Lateranverträge von 1929 sind ein mehrere Dokumente umfassendes Vertragswerk, welches den so genannten Versöhnungsvertrag nebst vier Anhängen (Trattato, in: AAS 21 [1929] 209–274, dort als Anhang Nr. 4 auch eine Finanzkonvention) sowie ein Konkordat (Concordato, in: AAS 21 [1929] 275–295) beinhaltet. Richtig ist nun, dass Art. 16 des italienischen Konkordats von 1929 eine Regelung enthält, die sich folgender historischen Situation verdankt: Das vor dem Ersten Weltkrieg zu Österreich–Ungarn gehörige Dalmatien war 1920 im Vertrag von Rapallo teils Italien, teils dem späteren Jugoslawien zugeschlagen worden. Um einen territorialen Gleichlauf staatlicher und diözesaner Grenzen herzustellen, kamen die Vertragspartner des Konkordats darin überein, dass bei der geplanten Errichtung bzw. Neuzirkumskription des (Erz-)Bistums Zadar darauf zu achten ist,
„che nessuna parte del territorio soggetto alla sovranità del Regno d’Italia dipenderà da un Vescovo, la cui sede si trovi in territorio soggetto alla sovranità di altro Stato; e che nessuna diocesi del Regno comprenderà zone di territorio soggette alla sovranità di altro Stato (dt.: dass kein Teil des der Souveränität des Königreichs Italien unterstehenden Territoriums einem Bischof unterstellt wird, dessen Sitz sich in einem der Souveränität eines anderen Staates unterstehenden Territorium befindet, und dass keine Diözese des Königreichs einen Teil des der Souveränität eines anderen Staates unterstehenden Territoriums umfasst).“
Es bedarf nun keiner weitschweifigen Begründung, dass keine noch so kunstvolle Auslegung dieser Festlegung zu dem Ergebnis führt, dass der Abt von Montecassino kein Ausländer sein dürfe. Denn abgesehen davon, dass die Abtei Montecassino mitten in Italien liegt und der Abt selbstverständlich seinen Sitz genau dort hat, äußert sich die zitierte Norm des Konkordats mit keiner Silbe zur Nationalität der beteiligten Bischöfe, beinhaltet also mit anderen Worten (und vielleicht aus gutem Grund) keine Indigenatsklausel.
Allerdings ist das italienische Konkordat von 1929 mittlerweile durch ein neues Konkordat aus dem Jahr 1984 (vgl. AAS 77 (1985) 521–535) abgelöst worden. Der dortige Art. 3 § 3 bestimmt, unter Bezugnahme auf die im vorausgehenden § 2 genannten Diözesan(erz)bischöfe, Koadjutoren, Äbte und Prälaten mit territorialer Jurisdiktion, Pfarrer sowie Inhaber weiterer, für die staatliche Ordnung relevanter Kirchenämter:
„Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo ecclesiastici che non siano cittadini italiani (dt.: Mit Ausnahme der Diözese Rom und der suburbikarischen Bistümer dürfen Geistliche, die nicht die italienische Staatsangehörigkeit besitzen, nicht zu den in diesem Artikel genannten Ämtern ernannt werden).“
(Die Ausnahme zugunsten der suburbikarischen Bistümer dürfte sich der alten Rechtslage verdanken, gemäß der die Kardinäle der bischöflichen Klasse zugleich tatsächlich die Bischöfe der suburbikarischen Bistümer waren. Die Ausnahme zugunsten Roms leuchtet ohne Weiteres ein, nachdem 1984 mit Johannes Paul II. ein Pole feliciter regnans der Stadt und dem katholischen Erdkreis vorstand.)
In die besagte Regelung aus Art. 3 § 3 des italienischen Konkordats von 1984 sind nun ausdrücklich auch Territorialäbte einbezogen, so dass es nicht weiter darauf ankommt, ob diese – wie üblicherweise nicht – die Bischofsweihe empfangen.
Wie kommt es nun aber dazu, dass die Wahl des Abts von Montecassino vom Papst bestätigt werden muss? (Hier könnte man zunächst vielleicht argumentieren, es bedürfe gerade wegen des Konkordats eines solchen Vorrechts, da anders der kirchliche Vertragspartner die Einhaltung desselben gerade hinsichtlich der besagten Landeskinder-Klausel nicht effektiv gewährleisten könne. Aber wäre das nicht ein Zirkelschluss von der Aufgabe auf die Befugnis, wie er modernem Rechtsdenken eher fremd ist?)
Im alten Recht des CIC/1917 ergab sich ein solches päpstliches Bestätigungsrecht der „Abbates nullius dioeceseos“ – also in heutiger Diktion: der Gebietsäbte – unmittelbar aus can. 320 § 1. Eine vergleichbare ausdrückliche Regelung zu den früher so genannten niederen Prälaten enthält der CIC/1983 nicht. Eine Fortgeltung des päpstlichen Bestätigungsrechts lässt sich aber aus cc. 377 § 1, 381 § 2, 368 CIC herleiten. Denn gemäß c. 381 § 2 CIC sind die Vorsteher der in c. 368 CIC neben der Diözese genannten weiteren Arten von Teilkirchen, darunter auch die Gebietsabtei, im Recht einem Diözesanbischof gleichgestellt, so dass auch auf sie die Regelung des c. 376 CIC Anwendung findet, gemäß welcher der Papst die Bischöfe frei ernennt bzw. ihre rechtmäßige Wahl bestätigt.
Die päpstliche Bestätigung der Abtswahl in Montecassino hat nach alldem ihren (ekklesiologischen) Grund also nicht darin, dass diese Wahl als solche einer päpstlichen Bestätigung bedürfe; sondern darin, dass die Abtei Montecassino nach überkommener Anschauung eine Territorialabtei und somit eine Teilkirche innerhalb der lateinischen Kirche ist.
Allerdings muss die Frage gestellt werden, ob diese Sichtweise nach wie vor zutrifft und richtig ist.
Bereits Papst Paul VI. hatte mit dem Motu Proprio Catholica Ecclesia vom 23.10.1976, in: AAS 68 (1976) 694–696, den Impuls des Zweiten Vatikanischen Konzils aufgegriffen, eine Rückbesinnung des Mönchtums auf seine ursprüngliche Kernaufgabe des klösterlichen Gottesdienstes zu fördern und dabei Orden und Diözesen, das heißt konsoziative und hierarchische Strukturelemente in der Kirche, zu entflechten. Gemäß den Bestimmungen des Motu Proprio sollten künftig keine neuen Gebietsabteien errichtet und bestehende hinsichtlich ihrer Grenzen angepasst oder in neue kirchliche Zirkumskriptionen umgewandelt werden (vgl. Nr. 1–2 MP Catholica Ecclesia). Weiter bestimmt Nr. 3 des Motu Prorio:
„Abbatia nullius, cuius territorium ex toto in aliam ecclesiasticam circumscriptionem versum est, in statum iuris communis restituetur vel iure singulari regetur, prout Apostolica Sedes singulis in casibus decreverit (dt.: Eine gefreite Abtei, deren Gebiet vollständig in eine andere kirchliche Zirkumskription umgewandelt ist, wird im Status des allgemeinen Rechts wiederhergestellt oder unterliegt besonderen rechtlichen Bestimmungen, wie es der Apostolische Stuhl in jedem Einzelfall entscheidet).“
Von dieser Befugnis hat Papst Franziskus 2014 anlässlich der Ernennung (?) des bisherigen Abtes von Montecassino Gebrauch gemacht (vgl. dazu etwa hier). Ob freilich – wie etwa hier zu lesen – der Papst bereits 2014 nach der anfänglichen Wahl eines Ausländers den bisherigen Abt tatsächlich im Wege einer Ersatzvornahme ernannt hat, muss hier ungeklärt bleiben. Die Vermeldung im Bolletino des Vatikanischen Pressesaals vom 23.10.2014 spricht zwar von einer Ernennung, doch ist dies angesichts der (ungehörigen) kurialen Praxis, auch gewählte Bischöfe aus Prinzip nicht zu „bestätigen“, sondern zu „ernennen“ (vgl. dazu Aymans–Mörsdorf, Kanonisches Recht II, 330 mit Anm. 9), ohne heuristischen Wert.
Mit dem von der Bischofskongregation erlassenen Dekret Ad Cassinum Montem über die Änderung der Grenzen der Abtei Montecassino und die Umbenennung des Bistums Sora–Aquino–Pontecorvo vom 23.10.2014, in: AAS 106 (2014) 920–923, wurden 53 namentlich genannte Pfarreien in 20 namentlich genannten Ortschaften dem neuen Bistum Sora–Cassino–Aquino–Pontecorvo zugeschlagen. Bislang in Montecassino inkardinierte Weltkleriker wurden per Dekret in das besagte Bistum umkardiniert. Das Territorium der Gebietsabtei wurde auf die dortige Kathedralkirche sowie das Kloster nebst den unmittelbar zum Kloster gehörenden Gebäuden und Flächen reduziert. Nach veröffentlichten Angaben sank damit die Zahl der zu Montecassino zählenden Katholiken schlagartig von rund 78.900 auf weniger als 20.
Dabei spricht das Dekret weiterhin von Montecassino als einer Territorialabtei und trifft hinsichtlich dieses Titels keinerlei spezielle Verfügungen. Hierin liegt ein deutlicher Unterschied zur Vorgehensweise insbesondere bei der Anwendung des Motu Proprio Catholica Ecclesia auf das Benediktinerkloster St. Paul vor den Mauern, welches bis März 2005 ebenfalls die Rechtsstellung einer Territorialabtei innehatte. Damals hatte die Bischofskongregation mit Dekret Iuxta normas über die Aufhebung der Gebietsabtei vom 07.03.2005, in: AAS 97 (2005) 445 f., ohne Umschweife erklärt, dass die dortige Abtei ihren bisherigen Rechtsstatus als Territorialabtei verliert. Papst Benedikt XVI. sah es daraufhin als ratsam an, zur Klärung aller dadurch entstandenen Zweifelsfragen mit dem Motu Proprio L’antica e venerabile Basilica vom 31.05.2005, in: AAS 97 (2005) 769–771, nachzusteuern und für weitere Klärungen der Sach- und Rechtslage zu sorgen.
Aber ist allein deshalb, weil Montecassino der Titel „Territorialabtei“ bislang nicht ausdrücklich entzogen worden ist, dieses Kloster weiterhin eine Territorialabtei? Vom ekklesiologischen Standpunkt aus muss diese Frage klar und entschieden verneint werden. Statt anderer sei auf die Erläuterungen bei Aymans–Mörsdorf, Kanonisches Recht II, 324, verwiesen; dort heißt es zu Recht: „Bei der Gebietsabtei ist aber niemals nur das jeweilige Kloster in den Rang einer Teilkirche erhoben; die Gebietsabtei wird vielmehr gebildet von der Abtei und den umliegenden Pfarreien.“ Dabei ist entscheidend, dass gemäß der Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils sowie des kodikarischen Rechts jede Teilkirche aus einer „Portion“ des Volkes Gottes („portio populi Dei“), die also das gesamte Spektrum der Gläubigen abbildet (vgl. dazu auch hier), besteht. Hieran fehlt es, wenn zu einer Teilkirche nur Personen mit einem Sonderstatus gehören sollen, also beispielsweise die Mönche eines Klosters (und ggf. weitere zur dortigen Hausgemeinschaft zählende Menschen). Auf der anderen Seite ist zu sehen, dass es in der kirchlichen Praxis schon immer historisch bedingte Sonderfälle gab, zumal in Fragen der Kirchenorganisation.
Es mag nun so sein, dass gleichwohl – etwa aufgrund Gewohnheitsrechts oder aufgrund entsprechender Festlegungen im Eigenrecht des Ordens – auch unabhängig von der Rechtsstellung als Territorialabtei die neuen gewählten Äbte von Cassino einer päpstlichen Bestätigung bedürfen. Für eine solche Bestätigung wäre dann aber in der Tat innerkurial das Dikasterium für die Institute des geweihten Lebens und für die Gesellschaften des Apostolischen Lebens zuständig, das gemäß Art. 124 § 1 Nr. 2 Apostolische Konstitution Praedicate Evangelium sich mit Angelegenheiten der ordentlichen Leitung von Ordensgemeinschaften befasst, während es gemäß Art. 105 § 1 dieses Kurienorganisationsgesetzes dem Dikasterium für die Bischöfe zukommt, sich um die Ernennung von Bischöfen und allgemeiner um die Besetzung von Teilkirchen mit geeigneten Vorstehern zu kümmern.
Wenn und weil aber Montecassino – nach hier vertretener Auffassung – wohl nur noch der Bezeichnung, aber nicht mehr der Sache nach eine Territorialabtei ist, ist es problematisch und meines Erachtens falsch, die Wahl eines Ausländers zum neuen Abt mit der Begründung zu verweigern, dass andernfalls gegen das italienische Konkordat verstoßen werde.
Die Regelung aus Art. 3 § 3 des italienischen Konkordats von 1984 ist mit Blick auf Teilkirchenvorsteher, die nicht frei vom Papst ernannt werden, sondern – wie beispielsweise im hier diskutierten Fall – von einer Ordensgemeinschaft gewählt werden, schon immer ein Vertrag zulasten Dritter (nämlich dieser Gemeinschaft) gewesen. Mit Rücksicht auf den ekklesiologischen und kanonischen Status einer Gebietsabtei als Teilkirche mag dies in der päpstlichen Sorge um alle Teilkirchen seinen rechtfertigenden Grund gefunden haben. In dem Moment jedoch, in dem der Abt nicht mehr zugleich der hierarchische Leiter einer Teilkirche, sondern nur noch der Höhere Obere der ihm anvertrauten Mönchsgemeinschaft ist, ist dieser Grund in Wegfall geraten. Damit ist es nunmehr unbillig, päpstlicherseits das innere Leben der Abtei einer weitreichenden Einschränkung zu unterwerfen, zumal meines Erachtens nicht erkennbar ist, dass und welches Interesse der italienische Staat am Indigenat des Abtes von Montecassino haben sollte.
Auch deshalb erscheint es außerdem als zweifelhaft, ob der Papst ohne weiteres zu einer Ersatzvornahme schreiten und eigenmächtig einen neuen Abt ernennen dürfte, oder ob er lediglich die Neuwahl eines Italieners verlangen kann.
Vielleicht sollte man der Abtei nach alldem mit Blick auf die Zukunft anraten, auf den bloßen Titel einer „Territorialabtei“ zu verzichten, wenn das der Preis für mehr innere Autonomie und Freiheit in der Wahl von für das Amt geeigneten Personen zum Abt ist. Aber leider hilft das nichts, solange sich nicht auch der Apostolische Stuhl den hier vertretenen Standpunkt zur wahren Sach- und Rechtslage zu eigen macht. Denn die Aufhebung einer Teilkirche steht nach kanonischer Rechtsordnung gerade nicht im Belieben der Teilkirche selbst, sondern bedürfte – in entsprechender Anwendung des c. 373 CIC auf den actus contrarius zu einer Errichtung – ihrerseits einer Entscheidung der höchsten kirchlichen Autorität.
„In conventibus celebrationibusve, ii regulis ordinis tenentur, qui in iisdem partem habent.“
„Bei Zusammenkünften oder Veranstaltungen werden durch die Regeln der Ordnung diejenigen verpflichtet, die daran teilnehmen.“
von Martin Rehak
„Im Auslegen seid frisch und munter! Legt ihr's nicht aus, so legt was unter.“
Johann Wolfgang von Goethe
Auf der Vierten Synodalversammlung des Synodalen Wegs hat sich vor den Augen und Ohren der interessierten Öffentlichkeit ein denkwürdiges Schauspiel entfaltet, das geeignet ist, einen dunklen Schatten auf die innerkirchliche Rechtskultur in Deutschland zu werfen. Die Rede ist von der verfehlten Auslegung und Anwendung der Bestimmungen der Satzung sowie der Geschäftsordnung des Synodalen Wegs in Bezug auf geheime Abstimmungen zu Sachanträgen.
Dazu möchte der Verfasser dieses Beitrags nicht verhehlen, dass er in der Sache wenig bis keine Sympathie für das Instrument der geheimen Abstimmung über die Sachthemen des Synodalen Wegs hegt. Denn es entspricht der bislang ungebrochenen, bestens bewährten Tradition der Kirche, dass die Konzilsväter und Synodalen, die einer gemeinsamen Entscheidung ihre Zustimmung geben konnten, sich namentlich in den Akten des Konzils unterschrieben haben.
Zudem ist nicht erkennbar, dass geheime Abstimmungen einem Ringen um jene Einmütigkeit förderlich wären, die die kirchliche Tradition stets als Aufweis einer vom Heiligen Geist angeleiteten Versammlung angesehen hat. Klar erkennbar ist hingegen, dass ein solches Ringen um Einmütigkeit für einen nachhaltigen Erfolg des Synodalen Wegs und seiner Beschlüsse förderlicher sein dürfte als das machtpolitische Schielen auf Zwei-Drittel-Mehrheiten unter den Bischöfen.
Gleichwohl sieht der Verfasser dieses Beitrags – in tiefer Verbundenheit mit seinem Namenspatron, der einst eine faire Behandlung der Priscillianer eingefordert hat – aus kirchenrechtlicher Sicht keinen Sinn darin, über die nachstehend erörterten Vorgänge den Mantel des Schweigens zu breiten und den Grundsatz „Principiis obsta! (Wehret den Anfängen!)“ zugunsten einer neuen, geschmeidigen Doktrin namens „Principia obstant. (Prinzipien sind nur hinderlich.)“ beiseite zu schieben.
Der Tragödie erster Teil ereignete sich am zweiten Tag (09.09.2022) der Versammlung. Der Synodale zu Eltz hatte gemäß § 5 Abs. 3 lit. j Geschäftsordnung einen Antrag auf Auslegung der Geschäftsordnung gestellt und um Klärung gebeten, ob eine Abstimmung namentlich oder geheim zu erfolgen hat, falls sowohl namentliche als auch geheime Abstimmung beantragt wird (siehe hier ab 1:21:00). Dazu hatte der Synodale Nomine in einer Gegenrede zutreffend darauf hingewiesen, dass die geheime Abstimmung in der Satzung und die namentliche Abstimmung in der Geschäftsordnung geregelt sind, und von daher die Rechtsauffassung geäußert, dass die Satzung Vorrang habe. Daraufhin stimmte die Synodalversammlung dem Geschäftsordnungsantrag mit großer Mehrheit zu.
Das weitere Vorgehen in diesem Fall ist in § 7 Abs. 4 Geschäftsordnung geregelt:
„Besteht Unklarheit über die Interpretation einer Bestimmung der Geschäftsordnung, entscheidet […] während der Sitzungen der Synodalversammlung die Synodalversammlung über die Auslegung nach Konsultation der Interpretationskommission. Die Interpretationskommission, deren drei Mitglieder von der Synodalversammlung für die Dauer des Synodalen Weges gewählt werden, prüft den strittigen Sachverhalt und gibt eine Entscheidungsempfehlung für das Synodalpräsidium bzw. die Synodalversammlung ab.“
Die Interpretationskommission des Synodalen Weges zog sich sodann zu Beratungen zurück. Nach einer guten Stunde wurde namens der Kommission eine Erklärung abgegeben (vgl. hier ab 2:33:00), auf die im Einzelnen noch näher einzugehen ist und deren Aussagespitze folgendermaßen lautete:
„Wenn wir die Satzung und GO anschauen, sind wir übereingekommen und haben einstimmig gesehen, dass die namentliche Abstimmung höher priorisiert wird als die geheime Abstimmung.“
Die Sitzungsmoderation nahm diese Einlassung mit Dank an die Arbeit der Kommission zur Kenntnis und resümierte (siehe hier ab 2:35:20; später nochmals in Erinnerung gerufen ebd., ab 9:07:50), dass
„wir jetzt klar haben: Namentlich geht vor geheim“.
Anstatt nun jedoch die Synodalversammlung in ihr Recht zu setzen und nach erfolgter Konsultation der Interpretationskommission über die Auslegung der Geschäftsordnung abstimmen zu lassen, arbeitete die Moderatorin auf Bitten der Synodalin Knop einen anderen Geschäftsordnungsantrag gemäß § 5 Abs. 3 lit. a Geschäftsordnung ab und ging dann zur Tagesordnung über.
In dem Statement zu den Beratungen der Interpretationskommission war zunächst insbesondere folgendes ausgeführt worden:
„Die Satzung ist ausgesprochen klar und sie sagt sehr klar: Souverän ist die synodale Vollversammlung. Sie muss über jeden Schritt entscheiden. Nicht das Präsidium oder andere Entscheidungsträger. Was kann beantragt werden? Es kann beantragt werden eine geheime Abstimmung; dazu braucht man fünf Antragsteller. Es kann beantragt werden eine namentliche Abstimmung, das geht durch einfachen Geschäftsordnungsantrag, dem aber die synodale Vollversammlung zustimmen muss.“
Damit wird die Rechtslage zutreffend referiert. Denn zunächst bestimmt Art. 11 Abs. 4 Satzung:
„Grundsätzlich erfolgen Abstimmungen öffentlich. Davon ausgenommen sind Personalentscheidungen sowie Abstimmungen, die auf Antrag von mindestens fünf Mitgliedern der Synodalversammlung geheim erfolgen können.“
Ein Geschäftsordnungsantrag auf namentliche Abstimmung von Sachanträgen ist in § 5 Abs. 3 lit. m Geschäftsordnung vorgesehen. Dazu regelt § 6 Abs. 6 Geschäftsordnung:
„Über Sachanträge kann auf Antrag namentlich abgestimmt werden, unbeschadet eines möglichen Antrags auf geheime Abstimmung (Art. 11 Abs. 4 Satz 2 SaSW).“
Zu der eigentlich zu diskutierenden Auslegungsfrage ließ man sich sodann folgendermaßen ein:
„Wenn wir die Satzung und GO anschauen sind wir übereingekommen und haben einstimmig gesehen, dass die namentliche Abstimmung höher priorisiert wird als die geheime Abstimmung. Schauen Sie in die GO § 6 Abs. 6, eben wo es dann heißt: „… kann auf Antrag namentlich abgestimmt werden, unbeschadet eines Antrag auf Geheimhaltung“. Das ist eine Hierarchisierung in der Aussage.“
Diese Auslegung ist unhaltbar.
Richtig ist vielmehr das kontradiktorische Gegenteil. § 6 Abs. 6 Geschäftsordnung priorisiert die geheime Abstimmung gegenüber der namentlichen.
Denn „unbeschadet“ bedeutet nicht, „auch wenn ein möglicher Antrag auf geheime Abstimmung gestellt wurde“. „Unbeschadet“ heißt nicht „ungeachtet“. „Unbeschadet“ meint nicht, „ohne dass die mindestens fünf, geheime Abstimmung beantragenden Mitglieder sich deswegen beschädigt fühlen sollen“.
„Unbeschadet“ bedeutet: Ohne dass von der in Bezug genommenen Regelung – hier Art. 11 Abs. 4 S. 2 Satzung – irgendwelche Abstriche gemacht werden, diese Norm irgendeine Minderung ihrer Geltung erleidet, sie irgendeinen Schaden nimmt.
In dieser Frage gibt es kein Vertun. Die rechtssprachliche Konvention, was Sinn und Zweck der Konjunktion „unbeschadet“ anbelangt, ist eindeutig und unmissverständlich.
Es ist schier unbegreiflich, dass Persönlichkeiten von Rang und Namen, deren persönliche Integrität über jeden Zweifel erhaben ist und die in der juristischen Fachwelt einen Ruf zu verlieren haben, ein solcher Fehler unterlaufen konnte.
Man versteht auch nicht, welcher verqueren inneren Logik die von der Interpretationskommission behauptete Auslegung folgen könnte. Vielleicht so: Die namentliche Abstimmung ist im ersten Halbsatz des § 6 Abs. 6 Geschäftsordnung angesprochen, also wird sie wohl wichtiger sein als das, was im zweiten Halbsatz steht?! Oder so: Wenn der Antrag eines einzigen Menschen zu einer namentlichen Abstimmung führt, während hingegen nur der Antrag von fünf Menschen zu einer geheimen, dann ist offenbar die namentliche Abstimmung fünfmal so wichtig wie die geheime?!
Unbehelflich ist nach alldem auch die Schlussbemerkung aus den Darlegungen zum Beratungsergebnis der Interpretationskommission:
„Also Fazit: Souverän ist die synodale Vollversammlung, sie muss über jeden Schritt abstimmen. Und wenn sie das tut, geht ‚namentlich‘ vor ‚geheim‘ dann, wenn entsprechende Anträge von der Vollversammlung mehrheitlich angenommen werden.“
Was wie eine Begründung erscheinen mag, ist in sich verwirrend. Denn die Redeweise von „Anträgen“ im Plural, die mehrheitlich anzunehmen wären, geht an der von der Satzung und Geschäftsordnung statuierten Rechtslage vorbei: Über den Antrag von mindestens fünf Mitgliedern auf geheime Abstimmung findet – im Gegensatz zu Geschäftsanträgen, wenn auf sie eine Gegenrede erfolgt – gerade keine nochmalige Abstimmung statt, weder seitens der Synodalversammlung noch seitens eines anderen Gremiums. Wer Gegenteiliges behauptet, trägt die Beweislast und möge konkret die Norm benennen, die das hergeben soll. Vielmehr sehen in einem solchen Fall Satzung und Geschäftsordnung ohne Weiteres vor, dass geheim abgestimmt wird.
Bei alldem ist im Übrigen merkwürdig, dass es dem Synodalen Weg in einem anderen Kontext keinerlei Schwierigkeiten bereitet, den wahren Sinn der Vokabel „unbeschadet“ richtig zu erfassen und der Geschäftsordnung gemäß zu handeln. Denn diese bestimmt in § 7 Abs. 2 S. 2 Geschäftsordnung:
„[Das Synodalpräsidium] entscheidet über die Durchführung eines Livestreams während der Sitzungen der Synodalversammlung, unbeschadet der Wahrung der Persönlichkeitsrechte.“
Insoweit sind Moderation und Livestream-Regie genauestens instruiert, jene Mitglieder nicht in Wort und/oder Bild zu zeigen, die dem unter Berufung auf ihre Persönlichkeitsrechte widersprochen haben.
Man möchte sich nicht den Shitstorm der Empörung ausmalen, der wohl über den Synodalen Weg hereinbrechen würde, wenn die Interpretationskommission sich angesichts eines auf mehr Transparenz zielenden Auslegungsantrags zu § 7 Abs. 2 S. 2 Geschäftsordnung so einlassen würde:
„Kurze Vorab-Aussage: Weißer Rauch. Die Geschäftsordnung ist ausgesprochen klar und sie sagt: Über den Livestream entscheidet das Synodalpräsidium. Schauen Sie sich die GO an, in § 7 Abs. 2, da ist das Synodalpräsidium höher priorisiert als die Persönlichkeitsrechte, eben wo es heißt: ‚Es entscheidet über die Durchführung […], unbeschadet der Wahrung der Persönlichkeitsrechte.‘ Das ist eine Hierarchisierung in der Aussage. Also Fazit: Das Synodalpräsidium entscheidet und wenn es das tut, geht Livestream vor Persönlichkeitsrechten. So haben wir uns abgestimmt und das ist das Ergebnis unserer Beratungen und wir sind sehr froh, dass die Geschäftsordnung das in großer Weitsicht vorab geregelt hat.“
Der Tragödie zweiter Teil entfaltete sich daraufhin am dritten Tag (10.09.2022) der Vierten Synodalversammlung, als die Moderatorin – objektiv in grober Verkennung der Rechtslage, aber angesichts der unsäglichen Positionierung der Interpretationskommission am Vortag vielleicht nicht subjektiv vorwerfbar – allen Ernstes einen Antrag von mindestens fünf Synodalen auf geheime Abstimmung als Geschäftsordnungsantrag behandelte und darüber abstimmen ließ (siehe hier ab 3:28:30).
Diese Vorgehensweise war rechtlich inakzeptabel. Denn unter den statthaften Geschäftsordnungsanträgen, die in einem die Buchstaben a bis m umfassenden Katalog in § 5 Abs. 3 Geschäftsordnung aufgelistet sind, wird „geheime Abstimmung“ nicht aufgeführt. Dabei bestimmt die Geschäftsordnung am angegebenen Ort – kenntlich gemacht durch die Vokabel „ausschließlich“ –, dass es sich nicht um eine beispielhafte Aufzählung der wichtigsten Arten von Geschäftsordnungsanträgen, sondern um einen abgeschlossenen numerus clausus handelt:
„Als Anträge zur Geschäftsordnung kommen ausschließlich in Betracht […].“
Rechtsirrig war von daher auch die in diesem Zusammenhang geäußerte Meinung des Moderators (siehe hier ab 3:33:20), dem zufolge
„die Satzung schreibt, es kann geheim abgestimmt werden, nicht es muss, wenn beantragt wird, insofern ist durchaus eine Abstimmung vorgesehen.“
Es sei zugegeben, dass die Satzung an der hier entscheidenden Stelle vielleicht nicht optimal formuliert ist. Jedoch ist vom Gesamtkontext her eindeutig, dass das vom Moderator in Bezug genommene Wort „können“ in Art. 11 Abs. 4 S. 2 Satzung im Blick auf das Gegenüber von Grundsatz (Art. 4 Abs. 4 S. 1 Satzung) und Ausnahme (Art. 4 Abs. 4 S. 2 Satzung) zu verstehen ist. Dabei signalisiert der Ausdruck „können“ gerade nicht, dass es sich bei Art. 11 Abs. 4 S. 2 Satzung um eine „Kann-Bestimmung“ handelt, deren Anwendung im Ermessen des Normadressaten läge. Vielmehr ist die Vokabel als ein Ausdruck der Ermächtigung zu lesen, im Falle eines Antrags von mindestens fünf Mitgliedern vom Grundsatz der öffentlichen Abstimmung zugunsten der geheimen abzurücken. Die vom Moderator verfochtene Interpretation, die Vokabel verweise darauf, dass über den Antrag abgestimmt werden müsse, ist jedoch an den Haaren herbeigezogen. Offensichtlich geht sie am Telos der Norm vorbei. Denn aufgrund bitteschön welcher Logik sollte ausgerechnet der Antrag auf geheime Abstimmung der (Geschäftsordnungs-)Antrag sein, der als einziger unter allen statthaften Anträgen für eine weitere Befassung mit ihm ein Quorum von fünf Antragstellern benötigt? Wenn der Satzungsgeber an die Vokabel „können“ so weitreichende und erstaunliche Folgerungen hätte knüpfen wollen, so wäre doch zu erwarten gewesen, dass er das Erfordernis einer Abstimmung der Synodalversammlung über den Antrag der mindestens fünf Mitglieder ausdrücklich in die Satzung hineinschreibt.
Anzumerken ist noch, dass § 6 Abs. 6 Geschäftsordnung seinerseits indiziert, dass über Anträge auf geheime Abstimmung nicht nochmals abgestimmt werden muss. Denn dies würde entweder dazu führen, dass sich eine Mehrheit dem Antrag der mindestens fünf Mitglieder anschließt. In diesem Fall wäre die Norm überflüssig. Oder eine Mehrheit lehnt die geheime Abstimmung ab und wünscht damit inzident eine namentliche Abstimmung. Die Norm des § 6 Abs. 6 Geschäftsordnung in ihrem korrekten Verständnis wäre in diesem Fall unanwendbar.
Zu Recht hat der Synodale Nomine daraufhin die Vorgehensweise der Moderation als
„rechtlich untragbar“
kritisiert (siehe hier ab 3:37:00). Die Erwiderung der Moderatorin, man habe sich hier
„satzungsmäßig richtig verhalten“,
ist indes nicht nachvollziehbar.
Ohne jeden Rückhalt in der Satzung und im klaren Widerspruch zur insoweit zutreffenden Darlegung der Interpretationskommission hinsichtlich der Unzuständigkeit des Synodalpräsidiums für Auslegungen der Geschäftsordnung während einer Synodalversammlung gemäß § 7 Abs. 4 Geschäftsordnung, war zudem die nachgeschobene Behauptung der Moderatorin:
„Und die Instanz für die Auslegung, im Zweifelsfall, dieser Geschäftsordnung ist das Präsidium, und auch das ist in der Satzung festgeschrieben.“
Ein daraufhin (siehe hier ab 3:38:45) gestellter Antrag auf erneute Auslegung der Geschäftsordnung wurde mehrheitlich abgelehnt.
Technisch gesehen ist daher die Frage, wie § 6 Abs. 6 Geschäftsordnung auszulegen ist, bislang keine res iudicata. Ein weises, klug beratenes Synodalpräsidium könnte also die Zwischenzeit bis zur nächsten Synodalversammlung nutzen, um gemäß § 7 Abs. 4 lit. a Geschäftsordnung eine juristische korrekte Auslegung der strittigen Regelung herbeizuführen und mit verbindlicher Wirkung für die nächste Synodalversammlung zu erklären, dass Anträge gemäß Art. 11 Abs. 4 S. 2 Satzung keine Geschäftsordnungsanträge sind und bei entsprechenden Anträgen gemäß § 6 Abs. 6 Geschäftsordnung die geheime Abstimmung Vorrang vor einer eventuell ebenfalls beantragten namentlichen Abstimmung hat.
Der Verstoß gegen c. 95 § 2 CIC wäre damit korrigiert.
„Qui graviter violat residentiae obligationem cui ratione ecclesiastici officii tenetur, iusta poena puniatur, non exclusa, post monitionem, officii privatione.“
„Wer die Residenzpflicht schwer verletzt, an die er aufgrund eines Kirchenamtes gebunden ist, soll mit einer gerechten Strafe belegt werden, nach erfolgter Verwarnung den Amtsentzug nicht ausgenommen.“
von Anna Krähe
Der vorliegende Beitrag gehört zur sechsteiligen Reihe „Wann Kirche straft und warum“, in der ausgewählte Kanones aus dem besonderen Teil des kirchlichen Sanktionsrechts, cc. 1364–1398 CIC n.F., vorgestellt werden. Bisherige Teile: Teil 1 (c. 1368 CIC n.F. [c. 1369 CIC a.F.]); Teil 2 (c. 1374 CIC); Teil 3 (c. 1389 CIC n.F. [c. 1384 CIC a.F.]); Teil 4 (c. 1390 § 2 CIC n.F.).
Mit der Apostolischen Konstitution „Pascite gregem Dei“ vom 23. Mai 2021 hat Papst Franziskus das erneuerte Buch VI des CIC/1983 „Strafbestimmungen in der Kirche“ promulgiert (Kanones lat.; Kanones dt.). Es ist am 8. Dezember 2021 in Kraft getreten. Der folgende Text bespricht die geltende Fassung des Kanons. Zur Unterscheidung zwischen geltendem und altem Recht wurden den Kanones des kirchlichen Strafrechts die Kürzel „a.F.“ (= alte Fassung) sowie „n.F.“ (= neue Fassung) hinzugefügt.
Für die einen gehen in diesen ersten Septembertagen die Sommerferien – zumindest im bayerischen Freistaat – langsam in ihre letzte Phase über; für die anderen bricht jetzt erst die Urlaubssaison an. Neben Schüler*innen, Lehrer*innen, Studierenden und Dozierenden an Hochschuleinrichtungen und weiteren Mitarbeiter*innen im Bildungsbereich nutzt, wie Martin Rehak bereits in einem „Kanon des Monats“-Beitrag vom August 2018 zu c. 283 § 2 CIC entfaltete, auch das pastorale Personal diese Spätsommerwochen gern für den verdienten und sowohl vom universalen als auch vom partikularen Recht vorgesehen Erholungsurlaub. Dass auch Träger*innen kirchlicher Ämter gerade in der Pastoral Auszeiten benötigen, scheint einsichtig; dass es für bestimmte Personen im Kreis der pastoral Tätigen aber durchaus eigens geregelt ist, dass diese Auszeiten ganz explizit auch mit dem räumlichen Abstand bzw. der Abwesenheit vom Wohnort einhergehen dürfen, mag manch weltliche*n Arbeitnehmer*in doch überraschen. Hintergrund ist eine besondere Pflicht bestimmter kirchlicher Amtsträger*innen: Die Residenzpflicht.
Kern dieser im kirchlichen Recht mehrfach erwähnten und mit einem Kirchenamt verbundenen Verpflichtung ist es, dass sich die Person, welche das entsprechende Kirchenamt innehat, sowohl in zeitlicher Hinsicht dauerhaft im eigenen Amtsgebiet aufzuhalten als auch in örtlicher Hinsicht dort zu wohnen hat. Als eine dementsprechend höchstpersönliche Verpflichtung kann sie nur durch den Amtsinhaber bzw. die Amtsinhaberin selbst erfüllt werden. Die Ursprünge der Residenzpflicht und der Sanktionierung bei Verstößen reichen in die ersten Jahrhunderte des Christentums zurück. Schon das Konzil von Nizäa (325) hatte in can. 15 die Bindung von Klerikern an ihre je eigene Gemeinde und das Verbot des Umherziehens festgeschrieben; in can. 16 wurde flankierend das Verbot normiert, solche Kleriker in einer anderen Gemeinde bzw. Kirche aufzunehmen. Mit dem Bild des guten Hirten, der bei seiner Herde verweilen soll, mahnt das Konzil von Trient diese Hirten, nämlich die Vorsteher von Teilkirchen und die Pfarrer, dass sie für die ihnen anvertraute Gemeinde das Wort zu verkünden, die Sakramente zu feiern und karitative Werke zu verwalten haben, sich also der Seelsorge für die Gläubigen zu widmen haben (Tridentinum, Sess. XXIII, cap. 1 de ref.). Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, formuliert das Konzil die persönliche Residenzpflicht für diese Hirten. Sie wird in diesem Sinne bis heute von dem Anliegen getragen, dass die jeweiligen Amtsinhaber*innen ihre Amtsaufgaben – in der Regel die Verwirklichung und Mitarbeit an der Hirtensorge innerhalb einer Gemeinschaft von Gläubigen – tatsächlich und umfassend erfüllen. Diese Zielausrichtung ist das zentrale und bestimmende Element des christlichen Zusammenlebens insbesondere in Pfarreien und Teilkirchen, weswegen der kirchliche Gesetzgeber diejenigen, die für die Erfüllung dieser Aufgaben verantwortlich sind, durch die Residenzpflicht speziell an ihren Zuständigkeitsbereich bindet. Dies bedeutet natürlich nicht, dass es nicht auch rechtmäßige Gründe für die Abwesenheit vom Amtsgebiet gibt. Jährlich vorgesehener Urlaub, Exerzitien, Abwesenheiten aufgrund von Krankheit oder zur Genesung stellen rechtmäßige und auch vom Gesetz vorgesehene Ausnahmen von dieser Pflicht dar. Den eigenen Wirkungskreis aber ohne Vorliegen eines dieser Gründe zu verlassen, kann schnell ein Fall des c. 1396 CIC n.F. (= a.F.) werden. Unter dem fünften Titel des zweiten Teils im Buch VI des Kodex „Straftaten gegen besondere Verpflichtungen“ sammelt der Gesetzgeber Delikte, durch die besondere Verpflichtungen verletzt werden. Solche können sich aus dem kirchenrechtlichen Status als Kleriker oder Ordensperson ergeben oder – wie im Fall der Residenzpflicht – durch ein bestimmtes kirchliches Amt begründet sein.
Bezüglich des Täter*innenkreises deutet das „qui“ zunächst wieder auf einen allgemeinen, jedermann umfassenden Personenkreis hin. Es gilt demnach auch bei c. 1396 CIC zunächst, was für alle Straftatbestandsnormen des kirchlichen Sanktionsrechts zu beachten ist: Mit c. 11 CIC hält der Gesetzgeber fest, dass durch rein kirchliche Gesetze nur und all jene verpflichtet werden, die in der katholischen Kirche des lateinischen Rechts getauft oder in sie aufgenommen wurden sowie das siebte Lebensjahr vollendet haben. Nach ganz herrschender Meinung fallen die Kanones des kirchlichen Sanktionsrechts unter die Gesetze des rein kirchlichen Rechts und verpflichten damit nur Katholik*innen, wobei aus c. 1323 n. 1 CIC n.F. deutlich wird, dass Gläubige, die noch nicht das 16. Lebensjahr vollendet haben, straffrei bleiben.
Für den c. 1396 CIC gibt aber schon die Titelüberschrift mit dem Verweis auf „speciales obligationes“ vor, dass Bezugspunkt der Delikte unter diesem Titel eine besondere Verpflichtung ist. Eine solche obliegt nach der Logik des Gesetzbuches immer persönlich einer konkreten Person; so auch die Residenzpflicht. Dies macht der Gesetzgeber im Wortlaut des c. 1396 CIC auch mit der Formulierung deutlich: „an die [= Residenzpflicht] er [= potentielle*r Täter*in] aufgrund seines Kirchenamtes gebunden ist“. Es kommen daher nur Personen infrage, die ein Kirchenamt nach c. 145 CIC innehaben, das auch zur Residenz verpflichtet. Zur konkreten Bestimmung dieser Ämter bedarf es des vertieften Blickes ins Gesetzbuch der lateinischen Kirche, wo zahlreiche Kirchenämter mit Residenzpflicht zu finden sind. Zunächst obliegt sie auf pfarrlicher Ebene natürlich dem Pfarrer (c. 533 § 1 CIC); gegebenenfalls dem Pfarradministrator (c. 540 § 1 CIC) sowie dem Pfarrvikar (c. 550 § 1 CIC) und den Priestern, die gemeinschaftlich („in solidum“; vgl. KdM zu c. 543 § 1 CIC) eine Pfarrei leiten (c. 543 § 2 n. 1 i.V.m. c. 517 § 1 CIC). Darüber hinaus kommt auch dem Diözesanbischof die Residenzpflicht höchstpersönlich zu (c. 395 § 1 CIC) sowie in Verbindung mit c. 381 § 2 CIC denjenigen, die dem Diözesanbischof rechtlich gleichgestellt sind; außerdem Bischofskoadjutoren und Weihbischöfen (c. 410 CIC) sowie ebenso einem möglichen Diözesanadministrator (c. 429 CIC). Kardinäle haben nach c. 356 CIC, sofern sie ein Amt in der Kurie innehaben und keine Diözesanbischöfe sind, eine Pflicht zur Residenz in der Stadt Rom. Ebenso besteht für Obere eines Instituts des geweihten Lebens nach c. 629 CIC Residenzpflicht in ihrer jeweiligen Niederlassung; Gleiches gilt gemäß c. 734 CIC für Leiter von Gesellschaften des Apostolischen Lebens. Unter der Paragraphenüberschrift zu § 14 „Residenzpflicht, Dienstwohnung, Dienstzimmer“ wird in der Rahmenordnung für Ständige Diakone in den Bistümern der Bundesrepublik Deutschland 2015 in Abs. 1 festgehalten, dass Ständige Diakone am Dienstort wohnen sollen; sofern sie hauptberuflich tätig sind, können ihnen Dienstort und Wohnung auch zugewiesen werden (für Würzburg: § 10 Abs. 5 Gesetz zur Änderung der Dienst- und Vergütungsordnung für Ständige Diakone in den bayerischen [Erz-]Diözesen; vgl. Abl Würzburg 162 (2016) Nr. 17, 511). Für Pastoral- und Gemeindereferent*innen können die einzelnen Diözesen eigene partikularrechtliche Regelungen treffen und dort ebenfalls eine Residenzpflicht vorsehen. Die Dienstordnung für Pastoralreferenten/Pastoralreferentinnen in den Bayerischen (Erz-)Diözesen v. 19.02.2014 sieht in § 3 die Zuweisung einer Dienstwohnung nebst der Verpflichtung zum Bezug dieser Dienstwohnung als eine Möglichkeit vor, von der aber in Härtefällen abgesehen werden kann. Die Dienstordnung für Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten in den bayerischen Diözesen v. 13.07.2017 erwähnt nur in § 4 die Zuweisung einer Dienstwohnung bei Versetzung. Der Begriff der Residenzpflicht findet in beiden Ordnungen keine Verwendung. Die fehlende Terminologie allein schließt aber auch Pastoral- und Gemeindereferent*innen nicht aus dem möglichen Täter*innenkreis aus. Es ist in diesen Fällen im Einzelfall zu prüfen, ob die partikularrechtliche Ausgestaltung des jeweiligen Kirchenamtes de facto eine Residenzpflicht begründet und ob der bzw. die Amtsinhaber*in im konkreten Fall auch daran gebunden ist. Ist für das jeweilige Kirchenamt vom Recht die Residenzpflicht vorgesehen, fallen die genannten Personen unter die Deliktsnorm des c. 1396 CIC. Personen, die kein Kirchenamt mit Residenzpflicht innehaben, werden in dieser Konsequenz nicht von der Deliktsnorm erfasst, auch wenn es für Ordensleute (cc. 665, 740 CIC) und Kleriker (c. 283 CIC) ebenfalls eigene Verpflichtung zum Aufenthalt bzw. Wohnsitz an einem bestimmten Ort gibt.
Die eigentliche Tathandlung wird im Tatbestand des c. 1396 CIC nicht benannt. Der Gesetzgeber beschränkt sich darauf zu schreiben, dass es sich um eine Verletzung der aus eigenem Kirchenamt resultierenden Residenzpflicht handelt. Worin das Delikt besteht, ergibt sich daher aus dem Verständnis der Residenzpflicht selbst. Statt der Verpflichtung nachzukommen, am Dienstort dauerhaft anwesend und auch wohnhaft zu sein, wird in der Tathandlung des c. 1396 CIC dieser Dienstort demnach unrechtmäßig verlassen und ein anderer (dauerhafter) Aufenthaltsort gewählt. Der Gesetzgeber erwähnt an dieser Stelle nicht explizit, dass es sich um eine unrechtmäßige Pflichtverletzung handeln muss; dies erschließt sich aber daraus, dass er für die jeweiligen Kirchenämter mit Residenzpflicht eigens rechtmäßige Ausnahmen vorsieht wie Urlaub, Exerzitien, bestimmte dienstliche Reisen, Krankenhaus- sowie Rehaaufenthalte und Ähnliches. Liegt eine solche gesetzliche Ausnahme oder auch eine Erlaubnis des Dienstgebers vor, ist der Tatbestand des c. 1396 CIC nicht erfüllt. Die Vollendung des Delikts nach c. 1396 CIC besteht darin, dass die verpflichtete Person grundsätzlich ohne Erlaubnis abwesend ist oder den Rahmen der rechtmäßigen Abwesenheit überschritten hat. Hinzu kommt, dass die Verletzung der Residenzpflicht „graviter“, also schwer, sein muss; es hat somit eine qualifizierte Verletzungshandlung vorzuliegen. Ab wann eine solche schwere Residenzpflichtverletzung besteht, muss im Einzelfall bestimmt werden.
Das unrechtmäßige Verlassen des Dienstortes muss bewusst und willentlich erfolgen, die Verletzung der Residenzpflicht hat also nach c. 1321 § 3 CIC überlegt zu geschehen. Diese vom Gesetzgeber nach c. 1321 § 2 CIC geforderte Vorsätzlichkeit des Handelns macht den subjektiven Tatbestand des c. 1396 CIC aus. Das Strafrechtsschema von 2011 hatte den dort enthaltenen can. 1396 noch in zwei Paragraphen unterteilt, von denen § 1 die entsprechende Regelung des c. 1396 CIC a.F. wortgleich wiederholte. Der can. 1396 § 2 Schema/2011 hatte darüber hinaus vorgesehen, dass auch eine über § 1 hinausgehende grob fahrlässige Verletzung der Residenzpflicht zu sanktionieren ist. Diese Regelung wurde nicht übernommen und somit bleibt ausschließlich die vorsätzliche Residenzpflichtverletzung strafbar.
Die Rechtsfolgen bei Vorliegen der Tatbestandsseite des c. 1396 CIC sind zweistufig geordnet. Auf erster Stufe ist in jedem Fall eine „iusta poena“, eine gerechte Strafe, zu verhängen. Grundsätzlich erlaubt es eine solche unbestimmte Strafandrohung nach c. 1315 § 3 CIC n.F. dem Rechtsanwender selbst, im Rahmen des Strafzumessungsermessens eine konkrete Strafe festzulegen. Nach c. 1349 CIC n.F. hat sich die Sanktion am durch das Delikt entstandenen Ärgernis und der Schwere des entstandenen Schadens zu orientieren. Schwere Strafen dürfen nur bei einer besonderen Schwere des Falls, Strafen für immer dürfen nicht verhängt werden. Damit sind mit c. 1349 CIC n.F. im Gegensatz zur alten Rechtslage klarere Kriterien zur Bemessung unbestimmter Strafen eingeführt worden, wobei zugleich dem richterlichen Ermessen Rechnung getragen wurde, sodass der Einzelfall Berücksichtigung finden kann.
Doch was meint nun diese „gerechte Strafe“ konkret? Zunächst ist für die Beantwortung dieser Frage festzuhalten, dass es sich in Anwendung des Bestimmtheitsgrundsatzes aus c. 221 § 3 CIC bei der „poena“ um eine vom kirchlichen Gesetzgeber grundsätzlich schon gesetzlich umschriebene Strafe handeln muss. Es kommen demnach die in c. 1312 § 1 CIC n.F. genannten Strafmittel der Sühne- oder der Beugestrafen in Betracht. Die Sühnestrafen nach c. 1336 CIC n.F. legen nach neuer Ordnung der §§ 1–5 bereits ein nach der Schwere der Strafe geordnetes Sanktionssystem vor und bieten sich daher besonders für eine dem jeweiligen Einzelfall angepasste Sanktionierung an – mit Ausnahme von c. 1336 § 5 CIC n.F., da dieser mit der Entlassung aus dem Klerikerstand eine Strafe für immer regelt. Im erneuerten kirchlichen Sanktionsrecht wird in einer ganzen Reihe von Normen die Strafandrohung „iusta poena“ aus Kanones der a.F. durch die Nennung von „c. 1336 §§ 2–4“ CIC n.F. ersetzt oder ergänzt (cc. 1365 n.F., 1371 §§ 1,2 n.F.; 1377 § 1; 1378 § 2 n.F.; 1383 n.F.; 1390 § 2 n.F.; 1391 n.F.; 1393 § 1 CIC n.F.). Neben den Sühnestrafen kommen auch die Zensuren bzw. Beugestrafen der cc. 1331–1333 CIC n.F. in Betracht. Hierbei ist aber zum einen zu beachten, dass die Verhängung einer Zensur nur dann sinnvoll ist, wenn es auch eine widersetzliche Haltung, eine „contumacia“ bei Täter bzw. Täterin gibt, die durch die Bestrafung aufgelöst werden soll und dass es sich zum anderen bei den Rechtsentzügen der Exkommunikation, des Interdikts und der Suspension durchaus um sehr umfassende Einschränkungen für das kirchliche Leben des Einzelnen handelt. Insofern sind Beugestrafen als schwere Strafen einzustufen und im Fall des c. 1396 CIC nur bei besonderer Schwere des Falls anzuwenden.
Auf zweiter Stufe ist nach c. 1396 CIC auch der Amtsentzug als Sanktion in Betracht zu ziehen, wobei es sich wohl – wenn auch nicht explizit genannt – um einen Rechtsentzug nach c. 1336 § 4 n. 1 CIC n.F. handelt, dem eine „monitio“ nach c. 1339 §§ 3,4 CIC n.F. vorausgeht. Diese Verwarnung gehört zu den sogenannten Strafsicherungsmitteln, ist demnach keine Strafe im eigentlichen Sinne, sondern ein Mittel, durch das (ggf. weitere) Straftaten verhindert werden sollen. Wird ein Verhalten bekannt, das möglicherweise zu einer Straftat erwachsen könnte, dient die Verwarnung dazu, das richtige Verhalten einzuschärfen und die möglichen, strafrechtlichen Konsequenzen bei Zuwiderhandeln deutlich zu machen. Eine Verwarnung hat nach c. 1339 § 3 CIC n.F. aufgrund eines Dokuments festzustehen und ist im Geheimarchiv der Diözesankurien zu verwahren. Das Verfahren zur Amtsenthebung von Pfarrern, cc. 1740–1747 CIC, sieht in c. 1741 n. 4 CIC die „grobe Vernachlässigung oder Verletzung der pfarrlichen Amtspflichten, die trotz Verwarnung weiter andauert“, als einen der Gründe zur Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens vor. Ein solches Amtsenthebungsverfahren ist allerdings nicht als Strafverfahren zu verstehen und steht daher wohl neben einem Verfahren aufgrund der Verletzung von c. 1396 CIC.
Auch wenn die „Straftaten gegen besondere Verpflichtungen“, welche im Titel V im besonderen Teil des kirchlichen Sanktionsrechts geregelt sind, spezifisch Kleriker, Ordensleute und Träger*innen bestimmter kirchlicher Ämter im Blick haben, besitzen gerade diese Straftatbestände eine besondere Bedeutung für die ganze kirchliche Gemeinschaft. Gerade die Residenzpflicht mag zunächst als eine eher randständige oder rein formale Verpflichtung erscheinen. Dennoch ist sie von ihrer Zielrichtung her betrachtet ein zentrales Element für das Zusammenleben in kirchlichen Gemeinschaften. Die Einhaltung der Residenzpflicht trägt dazu bei, dass in jeder Gemeinschaft Amtsträger*innen wirken, die die frohe Botschaft verkünden, Katechesen gestalten, Liturgie feiern, Gläubige in allen Fragen, Notlagen, Unsicherheiten begleiten und daran mitwirken, dass jeder und jede sein und ihr eigenes Apostolat verwirklichen kann. Dies alles sicherzustellen ist das eigentliche innere Ziel der Sanktionsandrohung des c. 1396 CIC.
„Praelatura personalis regitur statutis ab Apostolica Sede conditis, eique praeficitur Praelatus ut Ordinarius proprius, cui ius est nationale vel internationale seminarium erigere necnon alumnos incardinare, eosque titulo servitii praelaturae ad ordines promovere.“
„Eine Personalprälatur wird gemäß den vom Apostolischen Stuhl erlassenen Statuten geleitet und ihr wird ein Prälat als eigener Ordinarius vorgesetzt, dem das Recht zukommt, ein nationales oder internationales Seminar zu errichten und Alumnen zu inkardinieren und sie auf den Titel des Dienstes für die Prälatur zu den Weihen zu führen.“
von Martin Rehak
Das 1928 vom spanischen Priester Josemaria Escrivá de Balaguer gegründete Opus Dei hatte im Rahmen der Instrumentarien, die das kodikarische Recht des CIC/1917 bereitstellte, zunächst die kanonische Rechtsform einer frommen Vereinigung (pia unio) gefunden. Nachdem Papst Pius XII. mit der Apostolischen Konstitution Provida Mater Ecclesia vom 02.02.1947, in: AAS 39 (1947) 114–124, das Rechtsinstitut der Säkularinstitute ins Leben gerufen hatte, erfuhr das Opus Dei noch im gleichen Monat durch ein entsprechendes laudis decretum im Sinne von Art. VII § 1 AK Provida Mater Ecclesia eine päpstliche Anerkennung als Säkularinstitut. Damit war das Opus Dei das erste Säkularinstitut in der Geschichte der Kirche. Im Jahre 1982 erfolgte unter Papst Johannes Paul II. mit der Apostolischen Konstitution Ut sit vom 28.11.1982, in: AAS 75/I (1983) 423–425, die Umwandlung in eine Personalprälatur. Diese Apostolische Konstitution sah vor, dass innerhalb der Römischen Kurie die Kongregation für die Bischöfe für das Opus Dei als Personalprälatur zuständig ist. Konsequenterweise wies Art. 80 der Apostolische Konstitution Pastor Bonus über die Römische Kurie vom 28.06.1988, in: AAS 80 (1988) 841–912, die innerkuriale Zuständigkeit für Personalprälaturen im Allgemeinen der Kongregation für die Bischöfe zu. Mit der Apostolischen Konstitution Praedicate Evangelium vom 19.03.2022 wurde indes die innerkuriale Zuständigkeit für Personalprälaturen dahingehend geändert, dass seit dem Inkrafttreten von Praedicate Evangelium am 05.06.2022 nunmehr gemäß deren Art. 117 das Dikasterium für den Klerus zuständig ist.
Mit dem Motu Proprio Ad charisma tuendum vom 14.07.2022, welches am 22.07.2022 vom Päpstlichen Pressesaal bekannt gemacht wurde und das, wie in der Schlussklausel verfügt, am 04.08.2022 in Kraft tritt, hat Papst Franziskus zum einen die Apostolische Konstitution Ut sit dahingehend abgeändert, dass dort nunmehr ebenfalls ausdrücklich die Zuständigkeit des Dikasteriums für den Klerus benannt ist. Dies geschah anscheinend zu dem Zweck, eventuelle letzte Zweifel an der neuen innerkurialen Zuständigkeit für die Belange des Opus Dei auszuräumen. Zum anderen hat der Heilige Vater unmissverständlich klargestellt, dass es mit Rücksicht auf das Gründungscharisma des Opus Dei angemessen erscheine, wenn sich dessen Leitung vorrangig auf Charisma statt auf hierarchische Autorität stützt; so dass eine Bischofsweihe des Prälaten nicht in Betracht kommt („Pertanto il Prelato non sarà insignito, né insignibile dell’ordine episcopale“).
Das jüngste Motu Proprio des Heiligen Vaters ist damit Anlass genug, die Geschichte des Rechtsinstituts der Personalprälatur sowie die Rolle des Ordinarius einer Personalprälatur einer näheren Betrachtung zu unterziehen.
Der Begriff „Personalprälatur“ begegnet erstmals prominent auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wo in Art. 10,2 des Dekrets Presbyterorum Ordinis über Leben und Dienst der Priester vom 07.12.1965, in: AAS 58 (1966) 991–1024, hier 1007, eine Anpassung des Inkardinationsrechts an die pastoralen Bedürfnisse der Gegenwart (der 1960er Jahre) diskutiert wird, nämlich Lockerungen mit Rücksicht auf die Erfordernisse des Apostolats, die angemessene Verteilung der Priester, sowie spezielle pastorale Aufgaben in verschiedenen sozialen Schichten. Als nützliche Instrumente werden dazu neben internationalen Priesterseminaren insbesondere auch „peculiares dioeceses vel praelaturae personales (besondere Diözesen oder Personalprälaturen)“ ins Spiel gebracht. Den gedanklichen Hintergrund dürfte dabei die 1954 – gemäß den engen Vorgaben des CIC/1917 allerdings als Territorialprälatur – gegründete Mission de France gebildet haben (vgl. dazu auch Pius XII., Apostolischen Konstitution Omnium Ecclesiarum sollicitudo vom 15.08.1954, in: AAS 46 [1954] 567–574), die von einem Prälaten geleitet wurde (und wird), den der französische Episkopat aus seinen eigenen Reihen wählt; der Prälat war (und ist) also zuallererst der (Diözesan-)Bischof eines französischen Bistums. Unmittelbar nach dem Konzil hat Papst Paul VI. mit dem Motu Proprio Ecclesiae Sanctae vom 06.08.1966, in: AAS 58 (1966) 757 f., nebst den zugehörigen Normae ad exsequenda decreta Ss. Concilii Vaticani II ‚Christus Dominus‘ et ‚Presbyterorum Ordinis‘, in: ebd., 758–775, hier 760 f. (Cleri distributio et subsidia dioecesibus praestanda, Nr. 4), die rechtliche Gestalt der Personalprälatur mit bis heute richtungsweisenden Formulierungen näher ausgeprägt.
Allerdings war die Personalprälatur mit der Wendung „peculiares dioeceses vel praelaturae personales“ in eine auffällige Nähe zu den Teilkirchen, ja sogar zu deren Vollform, sprich der von einem Bischof geleiteten Diözese, gerückt worden. Dies warf notwendigerweise die Frage auf, ob hier nicht Gebilde des Verfassungs- und des Vereinigungsrechts miteinander verwechselt oder verschmolzen wurden. Denn in der Tat sah etwa das Schema CIC/1980 in can. 335 § 2 vor, dass die Personalprälatur rechtlich den Teilkirchen – definiert als „certae Dei populi portiones, in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia Christi exsistit (dt.: bestimmte Teile des Gottesvolkes, in denen und aus denen die eine und einzige Kirche Christi besteht)“ – gleichgestellt wird („aequiparatur“).
Es war vor allem der seinerzeitige Kardinalerzbischof von München und Freising, Joseph Ratzinger, der in der Vollversammlung der Päpstlichen Kommission zur Reform des CIC, die vom 20.–29.10.1981 über das Schema CIC/1980 beriet, entschieden gegen die teilkirchliche Qualität einer Personalprälatur Einspruch erhob (vgl. die Sitzungsakten, dort 377, 388 f. u. passim). Die Zugehörigkeit zu einer Teilkirche resultiere stets aus objektiven Kriterien, wie dem Wohnsitz, der Zugehörigkeit zum Militär oder der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Ritus. Die Personalprälatur hingegen sei eine Vereinigung. Damit korrumpiere eine Zuordnung der Personalprälatur zu den Teilkirchen den Begriff derselben, weil umgekehrt die Personalprälatur ihrem inneren Wesen nach keine Teilkirche sei. Ein Gebilde, in das man durch schlichten Willensakt ein- und austreten kann, sei – so Ratzingers dezent polemische Zuspitzung – keine Teilkirche (ecclesia particuliaris), sondern eine „ecclesia specialis“, eine „ecclesia electorum“ (vgl. a.a.O., 403). Zugleich sei es jedoch gegen die katholische Tradition, eine solche Vereinigung der Auserwählten als „(Teil-)Kirche“ zu bezeichnen (vgl. a.a.O., 389).
In der Folge wurden cann. 335 § 2, 337 § 2 Schema CIC/1980 über die Personalprälaturen (und die Militärvikariate) aus dem Recht der hierarchischen Verfassung der Kirche (Buch II, Teil II) gestrichen (vgl. nun cc. 368, 370 CIC e silentio) und die Normen über die Personalprälatur im Recht der Gläubigen (Buch II, Teil I) zwischen dem Kleriker(dienst)recht und dem kanonischen Vereinsrecht einsortiert (vgl. nun cc. 294–297 CIC).
Es ist also jeder Teilkirche eigentümlich, dass sie die Diversität des Volkes Gottes – (anfänglich) Juden und Griechen, Sklaven und Freie, Männer und Frauen (vgl. Gal 3,28); aber auch Laien und Kleriker, Heilige und Sünder, Gebildete und Analphabeten, usw. usf. – abbildet und so selbst wesensmäßig auf Inklusion bedachte communio fidelium ist. Damit korrespondiert die strenge Pflicht des Bischofs, sich gemäß c. 383 § 1 CIC um alle ihm anvertrauten Gläubigen gleichermaßen zu kümmern und nicht einzelne, über soziologische Kriterien bestimmbare Gruppen von Gläubigen zu bevorzugen. Umgekehrt ist es für eine Personalprälatur charakteristisch, dass sich dort freiwillig Menschen finden, die sich dem in c. 294 CIC umschriebenen, speziellen Apostolat widmen wollen bzw. im Fall des Opus Dei sich in besonderer Weise mit dessen Charisma, Spiritualität und Apostolat identifizieren. Der jeweilige Zweck der Vereinigung fördert dabei zugleich eine gewisse Homogenität der Mitglieder. Zu Recht ist daher jede Teilkirche als „portio populi Dei“ und nicht nur als „pars populi Dei“ charakterisiert, während umgekehrt die im Schema CIC/1980 vorgesehene Definition der Personalprälatur als eine „portio populi Dei, Praelati curae commissa“ gestrichen wurde. Denn im Gegensatz zum Diözesanbischof kann sich der Prälat einer Personalprälatur letztlich aussuchen, wer zu den ihm anvertrauten Gläubigen gehört und wer nicht. Oder anders gesagt: Eine Teilkirche, die (nach dem Bild der Universalkirche) wahrhaft katholisch sein will, kann ihre Gläubigen nicht nach einem bestimmten (Gründungs-)Charisma (der Gemeinschaft) nebst vertraglicher Bindung an das Werk vorsortieren.
Mit dem jüngsten Motu Proprio hat Papst Franziskus nochmals unterstrichen, dass Personalprälaturen bzw. das Opus Dei als Personalprälatur nicht zur hierarchischen Struktur der Kirche gehören und nicht als personal umschriebene weltweite Superdiözesen angesehen werden können, weswegen auch ekklesiologisch keine Notwendigkeit besteht, dass sie von einem Bischof geleitet werden. Insofern ist auch die Änderung in der Zuständigkeit der römischen Dikasterien sachgerecht. Denn die einstige Zuordnung der Personalprälatur zur Kongregation (jetzt: Dikasterium) für die Bischöfe wird man wohl nicht zuletzt auf jene unglückliche Formulierung in PO 10,2 zurückführen können, die „besondere Diözesen“ und „Personalprälaturen“ als zwei unterschiedliche Begriffe für ein und dieselbe Sache erscheinen lässt.
Zum kanonistischen Problem der Nichterwähnung des Prälaten der Personalprälatur in c. 134 CIC wird man nach alldem die These vertreten können, dass dieser Prälat den Ordensordinarien systematisch wesentlich näher steht als den Ortsordinarien.
„Qui aliam ecclesiastico Superiori calumniosam praebet delicti denuntiationem, vel aliter alterius bonam famam illegitime laedit, iusta poena puniatur ad normam can. 1336, §§ 2–4, cui praeterea censura addi potest.“
„Wer einem kirchlichen Oberen eine andere verleumderische Anzeige eines Delikts macht oder sonst den guten Ruf eines anderen unrechtmäßig verletzt, wird mit einer gerechten Strafe nach can. 1336 §§ 2–4 belegt, der darüber hinaus eine Beugestrafe hinzugefügt werden kann.“
von Anna Krähe
Der vorliegende Beitrag gehört zur sechsteiligen Reihe „Wann Kirche straft und warum“, in der ausgewählte Kanones aus dem besonderen Teil des kirchlichen Sanktionsrechts, cc. 1364–1398 CIC n.F., vorgestellt werden. Bisherige Teile: Teil 1 (c. 1368 CIC n.F. [c. 1369 CIC a.F.]); Teil 2 (c. 1374 CIC); Teil 3 (c. 1389 CIC n.F. [c. 1384 CIC a.F.]).
Mit der Apostolischen Konstitution „Pascite gregem Dei“ vom 23. Mai 2021 hat Papst Franziskus das erneuerte Buch VI des CIC/1983 „Strafbestimmungen in der Kirche“ promulgiert (Kanones lat.; Kanones dt.). Es ist am 8. Dezember 2021 in Kraft getreten. Der folgende Text bespricht die geltende Fassung des Kanons. Zur Unterscheidung zwischen geltendem und altem Recht wurden den Kanones des kirchlichen Strafrechts die Kürzel „a.F.“ (= alte Fassung) sowie „n.F.“ (= neue Fassung) hinzugefügt.
Ein Charakteristikum der kirchlichen Sanktionsrechtsreform 2021 ist wohl, dass schutzwürdige Rechte, Ansprüche und Güter im besonderen Teil des Buches VI CIC/1983 n.F. deutlicher in den Blick genommen, hervorgehoben, ausgestaltet werden. Neben dem ganz neuen Titel III „Straftaten gegen die Sakramente“ zeigt sich das auch in der Erweiterung der Überschrift zu Titel IV, in die nun das Rechtsgut des „guten Rufs“ aus c. 220 CIC explizit aufgenommen worden ist: „De delictis contra bonam famam et de delicto falsi“. Doch welche Handlungen und Aussagen stellen eigentlich eine Rufschädigung im Sinne des Kirchenrechts dar? Wann ist für den Gesetzgeber die Grenze zur Strafbarkeit überschritten? Und was droht den Verursacher*innen solch schädigender Handlungen? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, sind die kurzen und eher unscheinbaren Ausführungen des c. 1390 § 2 CIC n.F. in den Blick zu nehmen.
Zunächst ist festzuhalten, dass es sich bei c. 1390 § 2 CIC n.F. um ein „Jedermann“-Delikt handelt. Der Personenkreis, der sich strafbar machen kann, wird nicht näher bestimmt, sondern lediglich mit „qui“, „wer“, betitelt. Zur näheren Definition ist auf c. 11 CIC (auch can. 1490 CCEO) zurückzugreifen, demnach durch rein kirchliche Gesetze nur und all jene verpflichtet werden, die in der katholischen Kirche des lateinischen Rechts getauft oder in sie aufgenommen wurden sowie das siebte Lebensjahr vollendet haben. Die Normen des kirchlichen Sanktionsrechts verdanken sich nach ganz herrschender Meinung rein kirchlicher Setzung und verpflichten somit alle Katholik*innen nach Vollendung des siebten Lebensjahres.
Der ganze c. 1390 CIC n.F. widmet sich verschiedensten Handlungen, die den guten Ruf, der einem jeden Menschen aufgrund seiner Würde eigen und der so auch in c. 220 CIC in besonderer Weise geschützt ist, bewusst schädigen. Der Normaufbau ist bemerkenswert, denn der Gesetzgeber beginnt nicht mit dem allgemeinsten Tatbestand und wird dann spezieller, sondern § 1 des c. 1390 CIC n.F. sanktioniert zunächst einen spezifischen Einzelfall: Wird ein Beichtvater fälschlicherweise einer Straftat im Sinne des c. 1385 CIC n.F. beschuldigt, drohen dem bzw. der Täter*in die Tatstrafen des Interdikts oder der Suspension; also Beugestrafen, die mit der Begehung der Tat von selbst eintreten. Da gerade Straftaten, die im Rahmen des Bußsakraments begangen werden, schwer beweisbar sind, zielt der Gesetzgeber mit der Heraushebung dieses Delikts sowie der scharfen Strafandrohung vermutlich eine besonders große Abschreckungswirkung an.
In den beiden je eigenständigen Tatbeständen, die in c. 1390 § 2 CIC n.F. umschrieben werden, weitet sich der Kreis derjenigen, die von einer Schädigung des guten Rufes betroffen sein können. Es sind unterschiedliche Tathandlungen eingeschlossen und die Sanktionsandrohung ist milder und unbestimmter als im Spezialfall des § 1.
Über c. 1390 § 1 CIC n.F. hinaus, kann sich auch jede Anschuldigung, eine andere als in § 1 genannte Straftat begangen zu haben, auf den guten Ruf der beschuldigten Person auswirken. Daher droht jedem bzw. jeder Katholik*in, die einem kirchlichen Oberen die Straftat einer dritten Person zur Anzeige bringt und dies in verleumderischer Absicht tut, eine kirchliche Strafe; dies ist der erste Tatbestand (= Alt. 1) des c. 1390 § 2 CIC n.F. Das „delictum“, also die Straftat, die – zur Erfüllung des objektiven Tatbestands – zur Anzeige gebracht werden muss, ist im Wortlaut des c. 1390 § 2 Alt. 1 CIC n.F. zwar nicht näher bestimmt, aber es sind eben „andere“ – als in § 1 – verleumderische Anzeigen von Delikten gemeint. Da Adressat der Anzeige ein kirchlicher Oberer sowie Ziel der Falschanzeige allem Anschein nach ein kirchliches Strafverfahren ist, muss es sich um ein Delikt des kirchlichen Sanktionsrechts handeln. Es kommen Sanktionsnormen des universal- und partikularkirchlichen Rechts ebenso in Betracht wie kirchliche Strafgebote; nicht jedoch verleumderische Hinweise auf sündhaftes Handeln, Verstöße gegen kirchliche Ver- oder Gebote ohne Sanktionsandrohung, Pflichtverletzungen oder Ähnliches. Die Anzeige muss „calumniosa“, verleumderisch, böswillig wahrheitswidrig, erfolgen. Das meint in objektiver Hinsicht zunächst, dass der Inhalt der Anzeige falsch sein muss, der bzw. die Beschuldigte also die Straftat nicht begangen haben darf und die anzeigende Person das auch weiß. Diese will den bzw. die Beschuldigte*n durch die Falschanzeige bewusst schädigen und sagt deswegen die Unwahrheit in Bezug auf die Täterschaft des Delikts. Insofern ist die verleumderische Absicht auch ein eigenes, subjektives Merkmal dieses Tatbestands (vgl. zu einer Definition der Verleumdung KKK 2477). Rechtssprachlich etwas unpräzise scheint die Adressatenbezeichnung „ecclesiastico Superiori“, die im Kodex kein Äquivalent besitzt und nicht eindeutig zu definieren ist. In jedem Fall ist damit wohl der „Ordinarius“ (vgl. c. 134 § 1 CIC) gemeint, der nach c. 1341 CIC n.F. über die Beschreitung des Gerichts- oder Verwaltungswegs zur Strafverhängung entscheidet und der gemäß c. 1717 CIC für die Voruntersuchung zu einem Strafprozess zuständig ist. Allerdings verwendet der Gesetzgeber diesen Terminus in c. 1390 § 2 Alt. 1 CIC n.F. gerade nicht, sondern die unbestimmtere Bezeichnung „kirchlicher Oberer“. Dies deutet darauf hin, dass damit jede Person erfasst werden soll, die nach Meinung des bzw. der Täter*in gegen die angezeigte Person strafrechtlich einschreiten oder eine solche Anzeige zumindest an entsprechende Stelle weitergeben könnte (nach MKCIC–Lüdicke, c. 1390, Rz. 4 würde diese Person als gutgläubiges Werkzeug handeln). Die Parallelnorm zu c. 1390 § 2 CIC n.F. im Kodex der katholischen Ostkirchen, can. 1454 CCEO, nennt interessanterweise gar keinen Adressaten der Anzeige, sondern spricht nur allgemein davon, dass „jemand wegen irgendeiner Straftat angezeigt“ wird. Ähnlich auslegungsbedürftig wie die Adressatenfrage ist auch die Frage, in welcher Form die verleumderische Anzeige zu tätigen ist. Anders als die deutsche Übersetzung möglicherweise suggeriert, ist der Begriff „denuntiatio“ in c. 1390 § 2 Alt. 1 CIC n.F. nicht als Fachterminus für Strafanzeigen zu verstehen, denn das kirchliche Recht kennt keinen festgelegten, förmlichen Weg der Strafanzeige. Hier ist lediglich im Sinne des allgemeinen Sprachgebrauchs die Mitteilung, das Anzeigen, das Ankündigen einer Straftat gemeint. Universalkirchlich betrachtet ist diese „Anzeige“ wohl diejenige Information, durch die ein Ordinarius Kenntnis von einer möglichen kirchlichen Straftat erhält und diese Informationen zu prüfen hat; die sogenannte Voruntersuchung nach c. 1717 CIC – in der selbst nach § 2 wiederum auch der gute Name, sprich der gute Ruf des bzw. der Beschuldigten zu schützen ist. Wie der Ordinarius die wenigstens wahrscheinliche Nachricht von einer Straftat (vgl. c. 1717 § 1 CIC) erhält, ist im Kodex nicht geregelt. Im Rahmen der Aufarbeitung zum Umgang mit sexualisierter Gewalt in der Kirche verlangt die Deutsche Bischofskonferenz in ihrer Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst vom 18. November 2019 [= Ordnung/2019] von den Diözesanbischöfen die Beauftragung von Ansprechpersonen (vgl. Nrn. 4–6 Ordnung/2019), die nach Nr. 10 Ordnung/2019 „Hinweise auf sexuellen Missbrauch an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im Sinne dieser Ordnung entgegen[nehmen].“ Diese Hinweise werden durch die Ansprechpersonen auf ihre Plausibilität hin geprüft (vgl. Nr. 20 Ordnung/2019); bei Klerikern und Ordensleuten wird eine kanonische Voruntersuchung nach c. 1717 § 1 CIC eingeleitet (Nrn. 36–39 Ordnung/2019). Nach Nr. 13 Ordnung/2019 werden Ordinarien sowie „Leiter des kirchlichen Rechtsträgers“, bei dem die beschuldigte Person beschäftigt ist, bereits vom Verdacht einer Handlung im Sinne der Ordnung informiert. Daher kann man in der Logik der Ordnung/2019 davon auszugehen, dass der Tatbestand des c. 1390 § 2 Alt. 1 CIC n.F. schon erfüllt wäre, wenn die Ansprechperson wider besseres Wissen über eine frei erfundene Straftat informiert wird. Zumindest für Handlungen, die unter die Ordnung/2019 fallen (vgl. Nr. 2) sind nach Nr. 12 Ordnung/2019 sogar anonyme Hinweise oder Gerüchte beachtlich, „wenn sie tatsächliche Anhaltspunkte für Ermittlungen enthalten“. Grundsätzlich kann vom Taterfolg nach c. 1390 § 2 Alt. 1 CIC n.F. gesprochen werden, wenn die Anzeige beim kirchlichen Oberen angekommen ist; zumindest darf der bzw. die Täter*in nicht mehr in der Lage sein, die Kenntnisnahme aus eigener Kraft zu verhindern. An dieser Stelle sei auch angemerkt, dass für den Fall einer Überarbeitung der Ordnung/2019 ein Hinweis auf c. 1390 § 2 CIC n.F. in die jetzige Nr. 44 einzupflegen wäre, in welcher die „Maßnahmen im Falle einer fälschlichen Beschuldigung“ geregelt werden, wobei dort derzeit nur vorgesehen ist, die Unbegründetheit einer Beschuldigung schriftlich zu vermerken und aktenkundig zu machen. Da es den Tatbestand nach c. 1390 § 2 Alt. 1 CIC n.F. gibt und dieser im Fall, dass tatsächlich eine vorsätzliche Falschbeschuldigung in böswilliger Absicht getätigt wurde, auch einschlägig ist, sollte er wenigstens im Sinne der Transparenz erwähnt werden. Potentielle Täter*innen im Sinne des c. 1390 § 2 Alt. 1 CIC n.F. abzuschrecken oder ggf. auch gegen sie vorzugehen, schützt nicht nur die beschuldigte Person. Gerade Betroffenen von sexualisierter Gewalt soll und muss Vertrauen entgegengebracht werden, wenn sie sich mit dem, was ihnen widerfahren ist an die diözesanen Ansprechpersonen wenden, damit die Täter*innen dieser Straftaten zur Rechenschaft gezogen werden. Denjenigen, die dieses gegenseitige Vertrauen böswillig ausnutzen wollen, sollte – eben auch zum Schutz der wirklich Betroffenen – unmissverständlich deutlich gemacht werden, dass solche böswilligen Falschbeschuldigungen Konsequenzen haben.
Das Ziel des bzw. der Täter*in, den guten Ruf einer anderen Person zu schädigen, wird noch deutlicher im zweiten Tatbestand (= Alt. 2) des c. 1390 § 2 CIC n.F., der eine Sanktion an das in c. 220 CIC aufgestellte Verbot, den Ruf einer anderen Person unrechtmäßig zu schädigen, knüpft. Die eigentliche Tathandlung wird in c. 1390 § 2 Alt. 2 CIC n.F. gar nicht benannt. Der Gesetzgeber hebt lediglich den Taterfolg hervor, der in der tatsächlich eingetretenen Rufschädigung liegt.
Der gute Ruf ist kirchenrechtlich in c. 220 CIC verankert und damit Teil des Pflichten- und Rechtekatalogs aller Gläubigen. Dort wird er durch die strenge Verbotsnorm geschützt, dass niemand das Recht habe, jemandes guten Ruf zu schädigen. Die darin enthaltene positive Aussage ist: Jedem Menschen –so auch allen Nicht-Katholik*innen – ist aufgrund der ihnen eigenen menschlichen Würde auch ein guter Ruf eigen (vgl. dazu z.B. GS 26), der nicht „illegitime“ Schaden nehmen darf. „Rechtmäßige“ Rufschädigungen wurzeln in einem nachweisbaren, offenkundigen Verhalten des bzw. der Geschädigten selbst, das objektiv-rechtlich festgestellt ist; z.B. einer rechtskräftigen Verurteilung in einem Strafprozess. Wird aber der gute Ruf einer Person von einem bzw. einer Katholik*in unrechtmäßig, rechtswidrig beschädigt, dann droht eine kirchliche Sanktion nach c. 1390 § 2 Alt. 2 CIC n.F.
Dass mögliche Äußerungen im Rahmen des Delikts nach c. 1390 § 2 Alt. 2 CIC n.F. „illegitime“ erfolgen müssen, bedeutet somit auch im Fall der zweiten Alternative, dass die Behauptungen falsch, also wahrheitswidrig sein müssen und nicht durch irgendwie geartete, rechtfertigende Begründungen getragen sein dürfen. Der Tatbestand ist aber auch erfüllt, wenn es sich um eine wahre Behauptung handelt, der bzw. die Täter*in diese aber nicht an die Öffentlichkeit hätte bringen dürfen, also die Veröffentlichung bzw. Verbreitung rechtswidrig ist. Die Sphäre des guten Rufes einer Person muss durch die Tathandlung in objektiver und subjektiver Hinsicht beschädigt werden. Im can. 2355 CIC/1917 waren noch üble Nachrede, die auch eine verleumderische Anzeige im Sinne des heutigen c. 1390 § 2 Alt. 1 CIC n.F. einschloss, und Beleidigung als konkrete Tathandlungen benannt. Unter den Tatbestand der üblen Nachrede fielen falsche, ehrverletzende Behauptungen, die in Abwesenheit der betroffenen Person, aber vor mindestens zwei anderen Menschen geäußert wurden (vgl. ähnlicher KKK 2477). Beleidigungen hingegen konnten z.B. Beschimpfung, Verspottung, Verächtlichmachung, Verfluchung oder Ähnliches sein, die in Anwesenheit der betroffenen Person stattfanden. Beide Formen zielen auf eine Ehrverletzung und Rufschädigung und sind insofern auch mögliche Tathandlungen im c. 1390 § 2 Alt. 2 CIC n.F. Die Beleidigung trifft dabei mehr die betroffene Person selbst und greift deren persönliche Würde direkt an, während die üble Nachrede vor allem die soziale Wertschätzung gegenüber der betroffenen Person und damit deren Ruf schädigt (vgl. KKK 2479). Das widerrechtliche und rufschädigende Verhalten kann auf dem Wege des gesprochenen Wortes, aber auch durch Schriften, Bilder oder Gesten erfolgen, die dazu geeignet sind und das Ziel haben, die Wertschätzung und das Ansehen einer anderen Person ganz oder teilweise herabzusetzen. Inhalt der Behauptung kann alles sein, was für eine Rufschädigung geeignet ist; besonders natürlich fälschlich zugeschriebene Straftaten – kirchliche (auch über c. 1390 § 1 und § 2 Alt. 1 CIC n.F. hinaus) oder weltliche –, aber z.B. auch fälschlich zugeschriebenes sündhaftes Verhalten, moralische Laster oder Sittenverstöße jeder Art.
Dass es sich bei c. 1390 § 2 CIC n.F. um zwei Delikte handelt, die vorsätzlich begangen werden müssen (da die fahrlässige Begehung der Straftaten im Kanon nicht sanktionsbedroht ist, ist nur vorsätzliches Handeln strafbar; vgl. c. 1321 §§ 2,3 CIC n.F.), ist im Fall dieser Tatbestände besonders beachtenswert. Der Vorsatz, der wissentlich und willentlich alle Tatbestandsmerkmale umfassen muss, fordert nämlich mit Blick auf diese beiden Straftaten, dass der bzw. die Täter*in im Zeitpunkt der Tatbegehung um die Unrichtigkeit der Anzeige bzw. der Behauptung weiß und sich nicht lediglich im Irrtum darüber befindet oder noch Zweifel an deren Wahrheit äußert. Zudem muss die Rufschädigung, die im Kern beide Teile der Deliktsnorme durch die Strafandrohung verhindern möchten, ebenfalls willentlich angezielt sein.
In c. 1390 § 2 CIC a.F. beschränkte sich die Sanktionsandrohung auf die unbestimmte „iusta poena“. Bisher hatte der Gesetzgeber offengelassen, welche konkreten Strafen bei dieser Strafandrohung im Einzelfall „gerechterweise“ zu verhängen sind und diese Einschätzung den jeweiligen Rechtsanwendungsorganen überlassen. Diese Offenheit war insofern problematisch, als sich die Frage stellte, ob der richterliche Strafzumessungsspielraum über die Sanktionsmittel des Kodex hinausgehen oder ob nur aus den bereits bekannten Strafmitteln geschöpft werden durfte. Im Sinne der engen Auslegung nach c. 18 CIC und dem Erfordernis der Rechtssicherheit besonders im Bereich des Sanktionsrechts nach c. 221 § 3 CIC konnte wohl nur die letzte Möglichkeit gewählt werden. Bei der eher beschränkten Auswahl an Strafmitteln im Buch VI a.F. des CIC/1983 kamen daher nicht allzu viele Strafen als Konkretisierung der unbestimmten Strafandrohung „gerechte Strafe“ in Betracht. Im inzwischen geltenden Gesetzestext – zumindest in c. 1390 § 2 CIC n.F. – ist die Formel „iusta poena“ zum einen durch Bezugnahme auf konkrete Sühnestrafen erweitert; es muss sich nämlich um eine gerechte Strafe handeln, die aus den in c. 1336 §§ 2–4 CIC n.F. genannten Strafen bestimmt wird. Zum anderen wird nun die Hinzufügung einer Beugestrafe zusätzlich zur „gerechten Strafe nach can. 1336 §§ 2–4“ gestattet. In der alten Fassung war die Beugestrafe noch eingeschlossen in die „gerechte Bestrafung“. Für die bleibende kanonistische Frage danach, was wohl unter einer gerechten Strafe alles subsumiert werden kann, ist diese Präzisierung sicher hilfreich. Da der Gesetzgeber diesen konkreten Hinweis auf die Sühnestrafen aber nur in c. 1390 § 2 CIC n.F. eingefügt hat und in anderen Kanones bei der Formel „iusta poena“ geblieben ist, ist es für andere Fälle trotzdem weiterhin wenig eindeutig, welche Sanktion im Einzelfall zu erwarten bzw. zu verhängen ist. Die Gesetzesänderung durch Franziskus hat dennoch zu einer Sanktionsverschärfung geführt, denn die Bestrafung in der n.F. des Kanons ist nun nicht mehr fakultativ, sondern obligatorisch. Unter Würdigung der Einzelfallumstände hat demnach in aller Regel eine Bestrafung zu erfolgen, wenn die objektiven und subjektiven Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind.
Mit der Bestrafung mittels Sühne- oder sogar Beugestrafen in c. 1390 § 2 CIC n.F. lässt es der Gesetzgeber aber nicht bewenden. In der Tradition des CIC/1917 fordert auch das geltende kanonische Recht in c. 1390 § 3 CIC n.F. eine Wiedergutmachung des bzw. der Täter*in. Diese Verpflichtung ist ein Spezialfall des Wiedergutmachungsanspruchs aus c. 128 CIC, demnach derjenige, der durch eine vorsätzlich oder fahrlässig begangene (Rechts-)Handlung, Dritten widerrechtlich Schaden zugefügt hat, zur Wiedergutmachung verpflichtet ist. Im Fall einer Rufschädigung kommen zum einen Schadenersatz in Betracht, aber – je nach Mittel, das zur Rufschädigung verwendet wurde – beispielsweise auch richtigstellende Erklärungen z.B. gegenüber dem kirchlichen Oberen (Alt. 1) oder in der Presse (Alt. 2).
In wenigen Kanones des kirchlichen Sanktionsrechts wird die Funktion von Sanktionsnormen als Rechtsschutznormen so deutlich wie in c. 1390 § 2 CIC n.F. Die Anbindung an c. 220 CIC sowohl in der Titelüberschrift als auch im Wortlaut des c. 1390 § 2 Alt. 2 CIC n.F. stellt heraus, dass der Gesetzgeber den Schutz des guten Rufes nicht lediglich postuliert und dessen Schädigung verbietet, sondern er stützt dieses Verbot mit einer Sanktionsandrohung, die – bestenfalls – soweit abschreckende Wirkung entfaltet, dass niemand diesen Straftatbestand erfüllt.
„Curia Romana, qua negotia Ecclesiae universae Summus Pontifex expedire solet et quae nomine et auctoritate ipsius munus explet in bonum et in servitium Ecclesiarum, constat Secretaria Status seu Papali, Consilio pro publicis Ecclesiae negotiis, Congregationibus, Tribunalibus, aliisque Institutis, quorum omnium constitutio et competentia lege peculiari definiuntur.“
„Die Römische Kurie, durch die der Papst die Geschäfte der Gesamtkirche zu besorgen pflegt und die ihre Aufgabe in seinem Namen und seiner Autorität zum Wohl und zum Dienst an den Teilkirchen ausübt, besteht aus dem Staatssekretariat oder Päpstlichen Sekretariat, dem Rat für die öffentlichen Angelegenheiten der Kirche, den Kongregationen, den Gerichtshöfen und anderen Einrichtungen, deren Ordnung und Zuständigkeit durch besonderes Gesetz festgelegt sind.“
von Martin Rehak
Eine ordentliche Schwangerschaft dauert neun Monate. Es kann aber auch mal länger dauern – besonders wenn das Kind viele Väter hat und es um die ebenso komplexe wie delikate Angelegenheit einer Umstrukturierung der Römischen Kurie geht. Denn seit der Wahl von Papst Franziskus am 13.03.2013 und seiner liturgischen Amtseinführung am 19.03.2013 vergingen nicht weniger als neun Jahre, bis ein neues Organisationsgesetz für die Römische Kurie am 19.03.2022 offiziell – wesentliche neue Aspekte waren schon 2019 durch Indiskretionen bekannt geworden (vgl. hier) – das Licht der Welt erblickte.
Die Apostolische Konstitution Praedicate Evangelium über die Römische Kurie und ihren Dienst in der Welt vom 19.03.2022 wurde am nämlichen Tag in italienischer Sprache vom Vatikanischen Pressesaal bekannt gemacht. Zugleich wurde für den 21.03.2022 eine Pressekonferenz einberufen, auf der Marcello Semeraro (Kardinalpräfekt der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungen), Marco Mellino (Sekretär des K9-Kardinalsrats) und Gianfranco Ghirlanda SJ (emeritierter Professor für Kirchenrecht) das Dokument eingehender vorstellten. Im Druck wurde der Text in der Ausgabe Nr. 74 des L’Osservatore Romano vom 31.03.2022, S. I–XII, veröffentlicht. Inzwischen liegen auch private Übersetzungen in spanischer und französischer Sprache vor (vgl. hier und hier).
Als Datum des Inkrafttretens hat Papst Franziskus den Pfingstsonntag im Jahr des Herrn 2022, also den 05.06.2022, festgelegt.
Die AK Praedicate Evangelium ist in elf Abschnitte (Präambel – Prinzipien und Kriterien für den Dienst der Römischen Kurie – Allgemeine Normen – Staatssekretariat – Dikasterien – Organe der Rechtspflege – Organe für ökonomische Angelegenheiten – Ämter – Anwälte – Mit dem Heiligen Stuhl verbundene Institutionen – Übergangsbestimmung) untergliedert und folgt damit im Wesentlichen dem Aufbau der Apostolischen Konstitution Pastor Bonus vom 28.06.1988, in: AAS 80 (1988) 841–912, des bisherigen Organisationsgesetzes der Römischen Kurie. Der normative Teil von Praedicate Evangelium erstreckt sich über die Abschnitte III bis XI und umfasst insgesamt 250 Artikel. Zum Vergleich: In der AK Pastor Bonus umfasste der normative Teil insgesamt 193 Artikel und war in neun Hauptteile strukturiert (Allgemeine Normen – Staatssekretariat – Kongregationen – Gerichtshöfe – Päpstliche Räte – Ämter – Weitere Einrichtungen der Römischen Kurie – Anwälte – Einrichtungen, die mit dem Heiligen Stuhl verbunden sind).
Damit ist bereits eine der augenfälligen Neuerungen benannt: Die klassische Unterscheidung zwischen Kongregationen (traditionell mit Entscheidungskompetenz) und Räten (traditionell nur mit Beratungskompetenz) wird aufgegeben, indem nunmehr einheitlich der aus dem Griechischen entlehnte Begriff Dikasterium (Abteilung) gebraucht wird. Aus den in AK Pastor Bonus beschriebenen neun Kongregationen und 12 Räten sind so nunmehr 16 Dikasterien geschaffen worden, die stichwortartig folgende Namen bzw. Zuständigkeiten haben: Evangelisierung (Art. 53–68); Glaubenslehre (Art. 69–78); Dienst der Nächstenliebe (Art. 79–81); Orientalische Kirchen (Art. 82–87); Gottesdienst und Sakramentenordnung (Art. 88–97); Selig- und Heiligsprechungsprozesse (Art. 98–102); Bischöfe (Art. 103–112); Klerus (Art. 113–120); Institute des gottgeweihten Lebens und die Gesellschaften des apostolischen Lebens (Art. 121–127); Laien, Familie und Leben (Art. 128–141); Förderung der Einheit der Christen (Art. 142–146); Interreligiöser Dialog (Art. 147–152); Kultur und Bildung (Art. 153–162); Dienst der integralen menschlichen Entwicklung (Art. 163–174); Gesetzestexte (Art. 175–182); Kommunikation (Art. 183–188).
Inwieweit diese und ähnliche Neuerungen – wie etwa die Möglichkeit, kraft päpstlichen Mandats auch Laien mit der Leitung einzelner Dikasterien zu betrauen – eher kosmetischen Charakter haben oder tatsächlich von tiefgreifender Bedeutung sind, wird sich zeigen. Stattdessen kann man an einem bestimmten Punkt der Analyse des neuen Gesetzes den Eindruck gewinnen, dass es in weiten Teilen wenig substantielle Veränderung, dafür aber eine neue Optik und andere Schwerpunktsetzungen gibt. Diese These lässt sich etwa anhand der Binnenstruktur des Abschnitts zu den Allgemeinen Normen belegen. Denn die jetzigen Unterpunkte (Begriff der Römischen Kurie – Pastoraler Charakter der kurialen Aktivität – Operative Prinzipien der Römischen Kurie – Struktur der Römischen Kurie – Kompetenz und Vorgehensweise der kurialen Einrichtungen – Treffen der Leiter der kurialen Einrichtungen – Die Römische Kurie im Dienst der Teilkirchen – Besuch „ad limina Apostolorum“ – Ordnungen) begegnen wörtlich oder sinngemäß bereits als Zwischenüberschriften in der AK Pastor Bonus. Lediglich das dort noch eigens hervorgehobene Zentrale Arbeitsbüro (vgl. dazu hier, hier und hier) wird jetzt nur noch beiläufig in Art. 11 Praedicate Evangelium erwähnt, während der Kardinalsrat zur Beratung der organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten des Apostolischen Stuhls (kurz: Kardinalsrat für Wirtschaftsfragen) bereits 2014 – soweit ersichtlich, ohne explizite Aufhebung – durch den sogenannten Wirtschaftsrat ersetzt wurde (vgl. dazu hier und hier), der nun in Artt. 205–211 Praedicate Evangelium beschrieben ist.
Bemerkenswert sind andererseits die vielen Änderungen im Detail, auf die in aller Breite und Tiefe einzugehen, hier nicht der Ort ist. Erwähnt sei insoweit lediglich jene beachtliche Erweiterung der Kompetenz und Aufgaben des Dikasteriums für die Gesetzestexte (ex Päpstlicher Rat für die Gesetzestexte), die sich aus Art. 182 § 2 Praedicate Evangelium ergibt. Bislang war der Päpstliche Rat ausschließlich für die Klärung rein rechtlicher Fragen zuständig. In Zukunft soll er auch über die Rechtspraxis wachen, d.h. eine besondere Aufmerksamkeit auch „alla corretta prassi canonica“ widmen, die fachlich zuständigen Dikasterien auf „prassi illegittime“ aufmerksam machen, und ihnen Ratschläge zur Unterbindung derselben unterbreiten.
Anstelle solcher Detailfragen zu einzelnen Dikasterien sollen im Folgenden nun Begriff und Selbstverständnis der Römischen Kurie einer näheren Betrachtung unterzogen werden, wie sie einerseits in c. 360 CIC, andererseits in Art. 1 Praedicate Evangelium begegnen.
Insoweit sei zunächst die Bemerkung gestattet, dass c. 360 CIC bereits seit dem Inkrafttreten der AK Pastor Bonus, insofern überholt war, als damit der Rat für die öffentlichen Angelegenheiten der Kirche ersatzlos abgeschafft wurde. Dieser Rat war im Zuge der Kurienreform Papst Pauls VI. (1963–1978) geschaffen worden und gemäß Nrn. 26–28 der Apostolischen Konstitution Regimini ecclesiae universae vom 15.08.1967, in: AAS 59 (1967) 885–928, an die Stelle der vorherigen Kongregation für außerordentliche kirchliche Angelegenheiten getreten.
Diese Inkongruenz zwischen Kodex und Kurienorganisationsgesetz hat freilich die Verantwortlichen jahrzehntelang nicht weiter gestört. Es bleibt abzuwarten, ob nunmehr vielleicht die begriffliche Abschaffung der Kongregation einen hinreichenden Grund dafür darstellt, nach dem Kuriengesetz auch c. 360 CIC einer Revision zu unterziehen.
Zum Selbstverständnis der Römischen Kurie erklärt Art. 1 Praedicate Evangelium als erstes, dass sie das vorzügliche Organ des Papstes „bei der Ausübung seines höchsten Hirtenamts und seiner universalen Sendung in der Welt“ sei. Dabei begegnet die Redeweise von der „Ausübung seines höchsten Hirtenamts“ bereits in Art. 1 Pastor Bonus. Demgegenüber formuliert der Kodex etwas nüchterner, dass sich der Papst mittels der Kurie um „die Geschäfte der Gesamtkirche“ kümmert. Hierbei wird man sich unter der Gesamtkirche insbesondere die Gesamtheit der Teilkirchen (neben Vereinigungen von Gläubigen und jeder Einzelperson des Volkes Gottes) vorzustellen haben. Die Gleichsetzung von Gesamtkirche und Gesamtheit der Teilkirchen lässt sich mithilfe der Schlussklausel des c. 349 CIC erschließen, wo der Gesetzgeber sein Selbstbild hinsichtlich der Rolle des Papstes präsentiert: Dem Papst ist die tägliche Sorge für die Gesamtkirche anvertraut. (Weshalb für das Bistum Rom faktisch nicht der Bischof von Rom, sondern sein Kardinalvikar zuständig ist, wobei das Emblem des Vikariats – nennen wir es hier zu Diskussionszwecken mal unverblümt einen Skandal – nach wie vor die von Benedikt XVI. [2005–2013] aus dem päpstlichen Wappen entfernte Tiara zeigt [vgl. hier]). Die in c. 349 CIC nachzulesende Wendung entstammt der sogenannten Narrenrede des Apostels Paulus (2 Kor 11,16–12,13), wo der Völkermissionar mit einem Unterton von Frust und Erschöpfung ins Wort bringt, was ihn neben allen äußeren Gefährdungen innerlich umtreibt: „instantia mea cotidiana, sollicitudo omnium ecclesiarum (2 Kor 11,28 – Vulgata; dt.: der tägliche Andrang zu mir, die Sorge um alle Gemeinden)“. Erst eine spätere Theologie hat die Gesamtheit aller (Teil-)Kirchen (universitas omnium ecclesiarum) zu einer Gesamtkirche (universa Ecclesia) abstrahiert.
Wie die Liturgie der Kirche in der österlichen Zeit mit einer Bahnlesung der Apostelgeschichte in Erinnerung ruft, hat Paulus – nach der Darstellung des auctor ad Theophilum stets geleitet vom Heiligen Geist (vgl. Apg 13,2.4.52; 15,28; 16,6–7; 19,2.6; 20,22–23.28; 21,4.11) – in der großen weiten Welt mit Freimut und Erfolg das Evangelium gepredigt, zuletzt in der damaligen Hauptstadt der Welt, Rom (vgl. Apg 28,31). Dabei hat er laut unserem Autor nachweislich mindestens 14 Gemeinden (oder in heutiger Diktion: Teilkirchen) gegründet, nämlich Salamis (Apg 13,5), Paphos (Apg 13,6), Antiochia in Pisidien (Apg 13,14), Ikonion (Apg 14,1), Lystra (Apg 14,8; 16,1), Derbe (Apg 14,21; 16,1), Perge (Apg 14,25), Philippi (Apg 16,12; 20,6), Thessalonike (Apg 17,1), Beröa (Apg 17,10), Athen (Apg 17,34), Korinth (Apg 18,1), Ephesos (Apg 18,19; 19,1; 20,17) und Troas (Apg 20,6 – mit gutem Glück für Eutychos). Man versteht zum einen, dass jemand, von dem so viele, bisweilen in Parteiungen zerstrittene Gemeinden ständig geistlichen Rat und intellektuellen Beistand erbitten, sich irgendwann wie ein Narr vorkommt. Und wenn bereits der Völkerapostel Paulus durch diese Zahl an fernbetreuten Kirchen an seine Grenzen gebracht wurde, so ist zum anderen klar, dass der Papst, der sich heutzutage um grob gerundet 3.200 Diözesen weltweit (vgl. dazu hier) sorgen darf, auf loyale und tüchtige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Römischen Kurie angewiesen ist.
In diesem Zusammenhang lässt sich zum Selbstverständnis der Römischen Kurie sodann festhalten, dass neben dem Papst in der Tat auch die Teilkirchen deren Aufmerksamkeit beanspruchen. Dabei spricht c. 360 CIC davon, dass die Kurie „ihre Aufgabe … zum Wohl und zum Dienst der Teilkirchen ausübt“. In Art. 1 Pastor Bonus war dieser Gesichtspunkt in die Wendung integriert, dass der höchste Hirtendienst des Papstes „für das Wohl der und den Dienst an der Universalkirche und den Teilkirchen“ ausgeübt wird. Angesichts dieser Textgeschichte fällt es auf, dass in Art. 1 Praedicate Evangelium die Teilkirchen begrifflich überhaupt nicht mehr vorkommen. Stattdessen erklärt Papst Franziskus im neuen Kuriengesetz, dass die Kurie nicht nur im Dienst des Papstes, sondern auch im Dienst der Bischöfe stehe.
Im Lichte der Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils (vgl. insbesondere LG 8,2; CD 6,1), der zufolge jedem Bischof neben der Sorge für sein Bistum auch eine Mitsorge für die Gesamtkirche zukommt, erscheint dies im Ansatz als äußert sachgerecht. Die Kehrseite dieser Hermeneutik mag man darin sehen, dass sich die Fixierung der Römischen Kurie auf die Sorge um die Gesamtkirche – die insoweit freilich nur ein Abbild des oben skizzierten, leicht hypertrophen Rollenverständnisses des Bischofs von Rom als Nachfolger des Apostels Paulus (!) ist – weiter verfestigen dürfte. Diese Fixierung hat in der Vergangenheit wiederholt Kritik in der Literatur auf sich gezogen, vgl. Heribert Schmitz, in: HdbKathKR3, 496: „Nicht erfüllt war [durch die Kurienreform Pauls VI.] das grundlegende Desiderat einer Trennung der Römischen Kurie in eine Kurie für die Gesamtkirche und eine Kurie für die lateinische Kirche. Dieses Desiderat lässt sich wegen der dem Apostolischen Stuhl für dieses Problem fehlenden Sensibilität vorerst auch nicht verwirklichen.“
Davon abgesehen bleibt offen, was die sybillinische Wendung, dass die Dienstleistung der Kurie gegenüber dem Papst einerseits, den Bischöfen andererseits „secondo le modalità che sono proprie della natura di ciascuno“ erfolgen müsse, vor allem im Tagesgeschäft konkret bedeuten wird; vermutlich in etwa „Ober sticht Unter“.
Bereits durch Art. 1 Pastor Bonus war in das gesetzlich verordnete Selbstverständnis der Römischen Kurie der Gedanke eingetragen worden, dass durch die Arbeit der Kurie „die Einheit des Glaubens und die Gemeinschaft des Volkes Gottes gestärkt sowie die der Kirche eigene Sendung in der Welt gefördert wird.“ Diese Formulierung ist in Art. 1 Praedicate Evangelium weiterentwickelt zu der Aussage, dass die Kurie „zum Wohl und zum Dienst“ – Traditionselement aus c. 360 CIC – „der Gemeinschaft, der Einheit und der Auferbauung der Gesamtkirche“ handelt und darüber hinaus auch noch „auf die Bedürfnisse der Welt, in der die Kirche aufgerufen ist, ihre Sendung zu erfüllen“, eingeht.
Was zunächst die erste Hälfte dieser komplexen Aussage anbelangt, frappiert doch sehr, dass es der Kurie zentral um die Gesamtkirche und deren Gemeinschaft und Einheit gehen soll. Trotz ähnlichen Vokabulars sind hier also erhebliche Verschiebungen des Aussagesinns im Vergleich zu Pastor Bonus zu beobachten. Die Gemeinschaft des Volkes Gottes geht irgendwie in der Gemeinschaft der Gesamtkirche – bei der nicht zwingend an die einzelnen Gläubigen gedacht werden muss, sondern auch die Gemeinschaft der Teilkirchen im Blick sein könnte – auf und unter. Der Glaube als einheitsstiftendes Element ist – sit venia verbo – verdunstet; oder – irenisch formuliert – anscheinend nicht als eine von der Gesamtkirche und ihrer Predigt des Evangeliums isolierte Größe zu fördern.
Was sodann die zweite Hälfte jener Aussage anbelangt, hält Franziskus augenscheinlich dafür, dass sich die Sendung der Kirche in der Welt auch darin zeigt, auf die Bedürfnisse der Welt einzugehen. Viel deutlicher wird man den Ruf nach einer Einheit von Orthodoxie und Orthopraxie kaum formulieren können – Heilsdienst als Weltdienst.
Bei alledem gibt sich Art. 1 Praedicate Evangelium nicht damit zufrieden, wie vorstehend analysiert die Aufgabe der Römischen Kurie zu umreißen, sondern schreibt auch in allgemeiner Form vor, wie und in welcher Gesinnung die Römische Kurie bzw. die dort Beschäftigten ihre Arbeit verrichten werden: Die Haltung, derer sich die Kurie und die Kurialen bei ihrer Arbeit befleißigen mögen, soll nämlich den Geist des Evangeliums widerspiegeln. Man kann vielleicht sogar sagen, dass die Art und Weise der kurialen Amtsausübung selbst eine lebendige Predigt des Evangeliums sein soll.
Dies ist gewiss ein hoher Anspruch, über dessen Erfüllbarkeit man zweifelsohne trefflich streiten kann. Zeigt doch schon das Beispiel des Apostels Paulus, dass erfolgreiche Glaubensverkündigung je und je bei den lokalen Möglichkeiten und Gegebenheiten ansetzt. Gleichwohl macht Ziff. 1 der Präambel von Praedicate Evangelium deutlich, dass es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kurie in ihrem Dienst nicht nur um die Erledigung des Tagesgeschäfts und um bürokratisches Kleinklein, sondern um nichts Geringeres als die ersten und höchsten Ziele der missionarischen Jüngerinnen und Jünger Jesu gehen muss, deren Verkündigung des Evangeliums sich mit einer Haltung des Dienens und einer Barmherzigkeit gegenüber allen Menschen paarte. Dabei begegnet jenes „Praedicate evangelium“, welches dem gesamten neuen Kurienorganisationsgesetz seinen Namen gibt, als ein kurzer, unmittelbarer Auf- oder Zuruf und nicht – wie sonst üblich – als mehr oder weniger gekünstelter Auftakt eines langen, theologisch gehaltvollen Aussagesatzes. In diesem Zusammenhang verdient noch die Beobachtung eine eigene Erwähnung, dass als biblische Referenz für diesen Auf- oder Zuruf zwei auf den ersten Blick ganz heterogene Schriftstellen beigezogen werden. Denn Mk 16,15 versteht unter der frohen Botschaft offenbar die Kunde von der Auferweckung Jesu von den Toten, während es in Mt 10,7–8 um das Evangelium Jesu vom Herannahen des Himmelreichs geht, welches sich wiederum in innerweltlichen Zeichen ausdrückt: Kranke werden heil, Tote lebendig, Aussätzige rein, Besessene von ihren Dämonen befreit.
Es entbehrt dabei freilich nicht einer gewissen Ironie, dass Artt. 205–211 Praedicate Evangelium nicht weniger als sechs verschiedene Einrichtungen benennen, die sich um die wirtschaftlichen Angelegenheiten des Apostolischen Stuhls und der Römischen Kurie kümmern, während Mt 10,8 mit der bekannten Mahnung schließt: „Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben“. Doch diese Betrachtung lenkt schon wieder vom Eigentlichen ab: Die Römische Kurie – daran kann es im Lichte ihres neuen Organisationsgesetzes keinen Zweifel geben – ist kein Selbstzweck. Sondern sie hat eine Aufgabe, die unterschiedlichen konkreten Umsetzungen zugänglich ist und gerade darin auch die bemerkenswerte innere Pluralität und Katholizität der Kirche spiegelt.
„Sodalis dimitti debet ob delicta de quibus in cann. 1395, 1397 et 1398, nisi in delictis, de quibus in cann. 1395 §§ 2–3, et 1398 § 1, Superior maior censeat dimissionem non esse omnino necessariam et emendationi sodalis atque restitutioni iustitiae et reparationi scandali satis alio modo consuli posse.“
„Ein Mitglied muss aufgrund der in den cann. 1395, 1397 und 1398 genannten Straftaten entlassen werden, außer der Obere ist bei den Straftaten, von denen cc. 1395 §§ 2–3 und 1398 § 1 handeln, der Ansicht, dass eine Entlassung nicht unbedingt nötig ist und dass für die Besserung des Mitglieds, für die Wiederherstellung der Gerechtigkeit und für die Wiedergutmachung des Ärgernisses anderweitig hinreichend gesorgt werden kann.“
von Martin Rehak und Anna Krähe
Das kirchliche Strafrecht ist innerhalb des kanonischen Rechts kein isoliertes Rechtsgebiet, sondern steht in Beziehung zu anderen Normen des kodikarischen (und außerkodikarischen) Rechts. Dabei sind explizite Verweise auf die strafrechtlichen Kanones des sechsten Buchs (cc. 1311–1399 CIC) im Kodex zwar selten; außer dem in diesem Beitrag zu betrachtenden c. 695 § 1 CIC n.F. wären noch zu nennen:
- c. 198 CIC mit dem Vermerk, dass c. 1362 CIC als verjährungsrechtliche lex specialis anzusehen ist;
- c. 1718 § 1 Nr. 2 CIC, wo auf c. 1341 CIC verwiesen wird;
- c. 1720 Nr. 3 CIC, der auf cc. 1342–1350 CIC Bezug nimmt; sowie
- c. 1727 § 1 CIC, der den Richter an cc. 1344, 1345 CIC erinnert.
Darüber hinaus gibt es aber beispielsweise im Sakramentenrecht eine ganze Reihe von Normen, deren Missachtung strafbewehrt ist. Genannt seien hier insbesondere
- die gemäß c. 1381 CIC strafbare verbotene Gottesdienstgemeinschaft, wie sie sich aus einer Missachtung des c. 908 CIC (aber auch des c. 844 CIC) ergeben kann;
- die gemäß c. 1384 CIC strafbare absolutio complicis im Sinne des c. 977;
- die gemäß c. 1386 CIC strafbare Verletzung des bereits durch c. 983 CIC geschützten Beichtgeheimnisses;
- die gemäß c. 1387 CIC strafbare Weihe eines Bischofs ohne päpstliches Mandat nach c. 1013 CIC;
- die gemäß c. 1379 § 3 CIC strafbare (versuchte) Weihe einer Frau, die mit der geltenden Regelung über den gültigen Empfang des Weihesakraments aus c. 1024 CIC (siehe dazu auch hier) unvereinbar ist; sowie
- die im Recht der Irregularitäten (vgl. cc. 1041 Nr. 2, 1044 § 1 Nr. 2 CIC mit c. 1364 § 1 CIC; cc. 1041 Nr. 3, 1044 § 1 Nr. 3 CIC mit c. 1394 §§ 1-2 CIC; cc. 1041 Nr. 4, 1044 § 1 Nr. 3 mit c. 1397 §§ 1–2 CIC; cc. 1041 Nr. 5, 1044 § 1 Nr. 3 CIC mit wiederum c. 1397 § 1; und cc. 1041 Nr. 6, 1044 § 1 Nr. 6 CIC mit c. 1379 §§ 1 u. 5 CIC) näher umschriebenen Straftatbestände.
Die Reform des kodikarischen Strafrechts mit der Apostolischen Konstitution „Pascite gregem Dei“ vom 23. Mai 2021, die am 8. Dezember 2021 in Kraft getreten ist, hat eine (zumindest) redaktionelle Anpassung der Norm des c. 695 § 1 CIC erforderlich gemacht. Denn der bisherige Normtext sah für Ordensmitglieder, die sich einer Straftat gemäß der cc. 1397, 1398 und 1395 CIC a.F. (in dieser Reihung!) schuldig gemacht hatten, im Regelfall eine Entlassung aus dem Orden vor, wobei in Fällen des c. 1395 § 2 CIC a.F. der zuständige Obere unter näher skizzierten Voraussetzungen von dieser Maßnahme auch absehen konnte.
Jene Verweisung war indes im Zuge der Strafrechtsreform des Jahres 2021 unklar geworden, da die genannten drei Kanones inhaltlich neu gefasst wurden. Dies mag der nachstehende Textvergleich verdeutlichen:
Fassung vor Strafrechtsreform | Fassung nach Strafrechtsreform |
c. 1395 § 1 a.F. = n.F.: Ein Kleriker, der außer dem in can. 1394 erwähnten Fall, in einem eheähnlichen Verhältnis lebt, sowie ein Kleriker, der in einer anderen äußeren Sünde gegen das sechste Gebot des Dekalogs verharrt und dadurch Ärgernis erregt, sollen mit der Suspension bestraft werden, der stufenweise andere Strafen bis zur Entlassung aus dem Klerikerstand hinzugefügt werden können, wenn die Straftat trotz Verwarnung fortdauert. | |
c. 1395 § 2: Ein Kleriker, der sich auf andere Weise gegen das sechste Gebot des Dekalogs verfehlt hat, soll, wenn nämlich er die Straftat mit Gewalt, durch Drohungen, öffentlich oder an einem Minderjährigen unter sechzehn Jahren begangen hat, mit gerechten Strafen belegt werden, gegebenenfalls die Entlassung aus dem Klerikerstand nicht ausgenommen. | c. 1395 § 2: Ein Kleriker, der sich auf andere Weise gegen das sechste Gebot des Dekalogs verfehlt hat, soll, wenn die Straftat öffentlich begangen wurde, mit gerechten Strafen belegt werden, wenn erforderlich, die Entlassung aus dem Klerikerstand nicht ausgenommen. |
c. 1395 § 3: Mit der gleichen Strafe, die im § 2 erwähnt wird, soll ein Kleriker bestraft werden, der mit Gewalt oder durch Drohungen oder Missbrauch seiner Autorität eine Straftat gegen das sechste Gebot des Dekalogs begangen oder jemand gezwungen hat, sexuelle Handlungen vorzunehmen oder zu ertragen. | |
c. 1397 a.F. = c. 1397 § 1 n.F.: Wer einen Menschen tötet oder durch Gewalt oder Täuschung entführt, festhält, verstümmelt oder schwer verletzt, soll je nach Schwere der Straftat mit den in can. 1336 genannten [a.F.: Rechtsentzügen und Verboten] Strafen bestraft werden; die Tötung aber einer der in can. 1370 genannten Personen wird mit den dort und auch in § 3 dieses Canons festgelegten Strafen belegt. | |
c. 1398: Wer eine Abtreibung vornimmt, zieht sich mit erfolgter Ausführung die Tatstrafe der Exkommunikation zu. | c. 1397 § 2: Wer eine Abtreibung vornimmt, zieht sich mit erfolgter Ausführung die Tatstrafe der Exkommunikation zu. |
vgl. c. 1395 § 2 | c. 1398 § 1: Mit der Amtsenthebung und anderen gerechten Strafen, wenn es die Schwere des Falles nahelegt, die Entlassung aus dem Klerikerstand nicht ausgenommen, soll ein Kleriker bestraft werden: 1. der eine Straftat gegen das sechste Gebot des Dekalogs mit einem Minderjährigen oder einer Person begeht, deren Vernunftgebrauch habituell eingeschränkt ist oder der das Recht einen gleichen Schutz zuerkennt; 2. der einen Minderjährigen oder eine Person, deren Vernunftgebrauch habituell eingeschränkt ist oder der das Recht einen gleichen Schutz zuerkennt, dazu verführt oder verleitet an echten oder simulierten pornographischen Darstellungen teilzunehmen oder diese umzusetzen; 3. der für sich gegen die guten Sitten in jedweder Form und mit jedwedem Mittel pornographische Bilder von Minderjährigen oder Personen, deren Vernunftgebrauch habituell eingeschränkt ist, erwirbt, aufbewahrt oder verbreitet. |
| c. 1398 § 2: Wenn ein Mitglied eines Instituts des Geweihten Lebens oder einer Gesellschaft des Apostolischen Lebens oder sonst ein Gläubiger, der in der Kirche eine Würde bekleidet oder ein Amt oder eine Funktion ausübt, eine der Straftaten des § 1 oder des can. 1395 § 3 begeht, soll er nach Maßgabe des can. 1336 §§ 2-4 bestraft werden, wobei je nach Schwere der Straftat andere Strafen hinzugefügt werden sollen. |
Im Einzelnen wurde also die Regelung aus c. 1398 CIC a.F. in c. 1397 § 2 CIC n.F. überführt, während der bisherige c. 1395 § 2 CIC a.F. ausdifferenziert wurde. Der Tatbestand des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger aus c. 1395 § 2 a.F. findet sich in c. 1398 § 1 Nr. 1 CIC n.F. wieder. Die weiteren in c. 1395 § 2 CIC a.F. genannten Sachverhalte wurden auf die neuen §§ 2–3 dieses Kanons verteilt, wobei zudem in c. 1395 § 3 CIC n.F. gegenüber c. 1395 § 2 CIC a.F. der Aspekt des Missbrauchs der (geistlichen) Autorität ergänzt wurde. Außerdem finden sich in c. 1398 § 1 Nrn. 2–3 CIC n.F. Straftatbestände, die zuvor nicht oder nur außerkodikarisch im Rahmen der so genannten Normae de gravioribus delictis sanktioniert waren.
Vor diesem Hintergrund hatte bereits das Schema recognitionis libri VI Codex Iuris Canonici des Päpstlichen Rats für die Gesetzestexte aus dem Jahr 2011, welches die Regelung des jetzigen c. 1398 § 1 Nr. 3 CIC als neuen c. 1395 § 3 CIC vorgesehen hatte, eine Änderung des c. 695 § 1 CIC a.F. vorgeschlagen, bei der das Ermessen des Ordinarius, von einer Entlassung abzusehen, sich auf die Fälle des c. 1395 §§ 2–3 erstrecken sollte.
Nach der Veröffentlichung der Strafrechtsreform wurde in der offiziösen, im Auftrag der Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz sowie weiterer (Erz-)Bischöfe mit Gläubigen deutscher Zunge herausgegebenen lateinisch-deutschen Ausgabe des Kodex des kanonischen Rechts vorgeschlagen, in c. 695 § 1 den Text dahingehend zu aktualisieren, dass die genannten Kanones „1397, 1398 und 1395“ jetzt auf cc. 1395 §§ 2–3, 1397 §§ 1–2 und 1398 § 1 Nr. 1 CIC n.F. verweisen, während die Bezugnahme auf c. 1395 § 2 sich – wenn auch mit Interpretationsspielraum im Detail – auf cc. 1395 §§ 2–3 und 1398 § 1 Nr. 1 CIC n.F. beziehen dürfte.
Eine endgültige Klarheit in dieser Frage hat nunmehr Papst Franziskus mit dem Motu Proprio Recognitum Librum VI geschaffen, das die neue Textfassung des c. 695 § 1 CIC n.F. festlegt. Das Motu Proprio, dessen Originalsprache (erfreulicherweise) das Lateinische ist, wurde durch Abdruck im L’Osservatore Romano vom 26. April 2022 promulgiert und trat am selben Tag in Kraft.
Der neue Text nennt nun die drei Strafnormen, deren Verwirklichung eine Entlassung aus der Ordensgemeinschaft nach sich ziehen kann, in numerischer Reihenfolge. Die Delikte, bei denen die Oberen insoweit allerdings einen Ermessensspielraum haben, sind c. 1395 §§ 2–3 CIC n.F. und der gesamte c. 1398 § 1 CIC n.F., also nicht nur dessen Nr. 1. Insgesamt bietet das neue Motu Proprio damit nicht eine redaktionelle Anpassung des c. 695 § 1 CIC an die Änderungen im sechsten Buch des Strafrechts, sondern auch eine inhaltliche Neuregelung.
Nachdem Täter der Delikte aus cc. 1395 §§ 2–3, 1398 § 1 CIC n.F. nur ein Kleriker sein kann, könnte man im Kontext des c. 695 § 1 CIC die Frage stellen, ob konsequenterweise nur jene Ordensmitglieder, die eine sakramentale Weihe empfangen haben, im Falle einer entsprechenden Ermessensentscheidung einer Entlassung aus dem Orden entgehen können. Für eine solche Auslegung, die zu einer Unterscheidung zwischen geweihten und nicht geweihten Ordensmitgliedern führt, ist aber ein Sachgrund nicht erkennbar. Im Gegenteil ist zu bedenken, dass c. 1398 § 2 CIC n.F. die Strafbarkeit von Ordensmitgliedern, die keine Kleriker sind, auch für die in c. 1395 § 3 sowie c. 1398 § 1 CIC n.F. genannten Delikte begründet. Es kommt – mea sententia – an dieser Stelle also auf die begangene strafbare Handlung an, nicht auf die Frage, ob man zugleich Kleriker ist und damit bei strenger Wortlautauslegung überhaupt erst tauglicher Täter dieser Straftat sein kann.
Die eben erwähnte Ausweitung der Strafbarkeit der Delikte aus c. 1395 CIC a.F. bzw. in cc. 1395 § 3, 1398 § 1 CIC n.F. auf Ordensleute, die keine Kleriker sind, stellt eine Neuerung der Strafrechtsreform dar. Zuvor waren speziell (nicht-klerikale) Ordensleute als potenzielle Täter lediglich in den cc. 1392, 1394 § 2 CIC a.F. ausdrücklich benannt worden.
Vor diesem Hintergrund sei zunächst daran erinnert, dass c. 695 CIC die ordensrechtliche Einstiegsnorm in das in cc. 695–700 CIC näher geregelte (Verwaltungs-)Verfahren der Entlassung aus dem Orden darstellt. Es ist offensichtlich, dass ein solches Entlassungsverfahren zugleich Strafcharakter hat.
Daher kann es auch nicht verwundern, dass sich der (bzw. die) Ordensobere bei seiner (bzw. ihrer) Ermessensentscheidung, ob ausnahmsweise von einer Entlassung aus dem Orden trotz Begehung eines der genannten „kirchlichen Sexualdelikte“ abgesehen werden kann, von den selben Erwägungen leiten lassen muss, die immer wieder gleichsam als Strafzwecke des kanonischen Rechts genannt werden:
- Besserung des Täters (bzw. der Täterin);
- Wiederherstellung der Gerechtigkeit;
- Wiedergutmachung des Ärgernisses (griechisch: skandalon).
Diese Trias der Strafzwecke ist seit der Strafrechtsreform von 2021 relativ prominent in c. 1311 § 2 CIC n.F. am Ende verankert. Darüber hinaus begegnete und begegnet sie aber, wenn auch bisweilen leicht variiert und gekürzt, in weiteren strafrechtlichen Normen (vgl. c. 1341 CIC a.F. = n.F., c. 1343 CIC n.F., c. 1344 Nr. 2 CIC a.F. = n.F., c. 1347 § 2 CIC a.F. = n.F. und c. 1357 § 2 CIC a.F. = n.F.). Dabei bietet jedoch c. 1311 § 2 CIC n.F. ebenso wie c. 1341 CIC n.F. eine andere Reihung dieser drei Strafzwecke und nennt als erstes die Wiederherstellung der Gerechtigkeit. Das könnte zum einen dahingehend interpretiert werden, dass Besserung des Täters und Wiedergutmachung des Schadens zwei spezielle Konkretionen der Wiederherstellung der Gerechtigkeit sind. Zum anderen ist zu sehen, dass die Besserung des Täters zwar problemlos bei Beugestrafen, aber nur entfernt – vielleicht im Sinne einer Spezialprävention des potenziellen Wiederholungstäters – auch bei Sühnestrafen als Strafzweck angesehen werden kann.
Es fällt vor diesem Hintergrund auf, dass diese Umstellung nicht in c. 695 § 1 CIC n.F. übernommen wurde.
Nach alledem macht schließlich die Beobachtung nachdenklich, dass hinsichtlich der Rechtsfolgen für Kleriker nach dem Strafrecht und für Ordensmitglieder nach dem Ordensrecht in Sachen Entlassung (aus dem Klerikerstand einerseits, aus dem Ordensstand andererseits) eine gewisse Spannung zu bestehen scheint. Wie dargelegt, statuiert nämlich c. 695 § 1 CIC a.F. = n.F. die Ordensentlassung als den Regelfall, von dem allenfalls bei einer günstigen Prognose des (bzw. der) Ordensoberen (Ordensoberin) eine zugunsten des Mitglieds abweichende Ermessensentscheidung getroffen werden kann. Demgegenüber erscheint als Regelstrafmaß in den Fällen der cc. 1395 §§ 2–3, 1398 CIC die nicht näher präzisierte „gerechte Strafe“, während nach den Worten des Gesetzes die Entlassung aus dem Klerikerstand offenbar eine gewisse Schwere des Falls zur Voraussetzung hat. Die Entlassung aus dem Orden erfordert mit anderen Worten in minderschweren Fällen weniger Begründungsaufwand seitens des Oberen bzw. der Oberin, als die Entlassung aus dem Klerikerstand für das Gericht im Strafprozess; und die (vermeintliche) Höchststrafe der Entlassung kann mithin eine ordensangehörige Person eher treffen als einen Weltpriester. Gilt hier, in einer spirituell-theologischen Gewichtung der jeweiligen Profession, der Satz: Wer höher steht, kann tiefer fallen?

von Theodor Seidl
Die musikalische Folklore des modernen Israel hat religiöse Kanongesänge kreiert, die rasch internationale Verbreitung fanden wie „Schalom chaverim“ oder „Hinne mah tob uma naim“ [1]. Zu ihnen gehört auch „Haschiwenu Adonaj elächa“, der oben abgedruckte Kanon, dessen Bibeltext im folgenden Artikel in den Kontext des 5. Klagelieds eingeordnet und kurz ausgelegt wird.
Der hebräische Text von Klgl 5,21 kann so übersetzt werden:
„Lass uns zurückkehren, Adonaj, zu dir,
dann können wir uns (zu dir) bekehren;
erneuere unsere Tage wie vor alters.“
1.
Die Melodie des Kanons von 1964 stammt von Meir Ben-Uri [2]; ihre Popularität zeigt sich in der Übernahme durch mehrere Jugendliederbücher [3].
Der Gesang steht in h-moll, bleibt aber durch Vermeidung des Leittons ais kirchen-tonartlich. Die Melodie umfasst den Klangraum einer Dezime und reicht von h bis d‘. Die ersten vier Takte bis zum Einsatz der 2. Stimme verbleiben melodisch im Quintraum h-fis; der zweite Teil erweitert die Melodie bis zur Sext und erreicht den höchsten Ton d‘; von ihm löst sich der dritte Teil nur zögerlich: Erst nach dreimaliger Repetition des d‘ schließt der Kanon auf dem Grundton h‘.
Die Textunterlegung erfolgt so, dass die drei Verben des Bibelverses jeweils wiederholt und dadurch intensiviert werden: haschiwenu – „kehre uns zu dir“, wenaschuwa – „dann können wir uns bekehren“, chadesch – „erneuere“.
Die Schlussbitte im 21. Vers des 5. Klageliedes ist in der Kanonkomposition in einen fließenden und damit drängenden 6/8-Rhythmus gefasst.
2.
Das 5. Klagelied [4] der Hebräischen Bibel – zu ihrem 3. Teil und dort zu den Megillot („Festrollen“) gehörend – geht in manchem andere Wege als seine vier Vorgänger: Es folgt nicht der strengen akrostichischen Abfolge des hebräischen Alphabets, weist aber auch die Anzahl von 22 Versen auf, was der Zahl der hebräischen Konsonanten des Alphabets entspricht.
Es ist nahezu einheitlich von der Wir-Klage des Volkes geprägt, während Klgl 1; 3; 4 fast durchgehend individuelle Aussagen enthalten oder eher sachlich die Notlage der Menschen beschreiben. Wie in Klgl 1; 2; 4 werden die Leiden der Gegenwart als Folgen der Sünden des Volkes bewertet. Doch anders als in Klgl 2 und 4 sind nicht die Vergehen von Priester und Prophet die Ursache, sondern die Sünden der Väter (V. 7). Es klagt also wohl eine jüngere Generation über die nicht endende Kriegs- und Exilssituation.
3.
Das 5. Klagelied lässt sich deutlich in drei ungleiche Teile gliedern: V. 1 – V. 2-18 – V. 19-22:
Der einleitenden Anrufung Jahwes mit drei Bitten (V. 1), doch das Elend des Volkes wahrzunehmen, schließt sich die ausgedehnte Wir-Klage an (V. 2-18). Der Schluss (V. 19-22) gliedert sich in Hymnus (V. 19), vorwurfsvolle Fragen (V. 20.22) und die im Kanon vertonte Bitte von V. 21. Alle drei Teile haben das Ziel, den abwesend und fern angenommenen Gott aus seiner Verborgenheit herauszurufen. Die Drastik in der Beschreibung der Kriegsfolgen in den V. 2-18 soll das vor allem bewirken.
Im Einzelnen wird beklagt: Der Landverlust sowie die Fremd- und Ausländerherrschaft (V. 2.5.8), der Verlust der Familienväter (V. 3), die Teuerung des Lebensbedarfs (V. 4), die gefährdete Sicherheitslage (V. 9), die Folgen des Hungers (V. 10), die Schändung der Frauen (V. 11), die Hinrichtung führender Persönlichkeiten (V. 12), die Verkehrung der Gesellschaftsordnung (V. 13) , das Fehlen von Rechtsprechung (V. 14a), das Schweigen und Ausbleiben von Musik und Tanz (V. 14b.15) und die Verwüstung und Verödung des Tempelbergs und seines Geländes (V. 18).
Unterbrochen wird diese drastische Auflistung durch drei Schuldgeständnisse der klagenden Wir-Gruppe in V. 6.7.16b; dabei ist besonders bemerkenswert, weil historisch verifizierbar: Die unstete Außenpolitik Judas und Jerusalems, die wechselweise zur westlichen Großmacht Ägypten und zur östlichen Großmacht Assur bzw. Babylonien schielte (V. 6), was jede politische Stabilität verhinderte. Man suchte also nach eigenen Fehlern in der Politik der Vergangenheit und schrieb ihnen die schlimme Lage der Gegenwart zu.
Nach einem hymnischen Bekenntnis (V. 19) richtet der Dichter vorwurfsvolle Fragen an seinen Gott (V. 20.22), und bezichtigt ihn damit der Abwesenheit, Untätigkeit und des Vergessens.
Die im Kanon vertonte Bitte (V. 21) gesteht freilich ein, dass sich der Dichter und sein geschwächtes Volk nicht mehr in der Lage sehen, eigenständig Umkehr und Hinwendung zu Jahwe zu vollziehen, dass vielmehr der angerufene und beklagte Gott den ersten Schritt der neuen Hinwendung zum Volk machen und seine Erneuerung nach den Maßstäben der Vorzeit vollziehen muss.
Dieses theologische Konzept der von Jahwe selbst bewirkten Umkehr liegt auch in Dtn 30,6-10 und Jer 31,18 vor (anders Klgl 3,40); es wendet sich kritisch gegen die deuteronomistische Umkehrpredigt [5], die die menschliche Umkehr zur Vorleistung und Bedingung der Wende zum Heil macht.
4.
Manche direkten Parallelen zu aktuellen weltpolitischen Ereignissen ergeben sich mühelos. Die im 5. Klagelied aufgelisteten Kriegsgräuel sind in den Medienberichten aus der Ukraine leider wieder Alltag geworden.
Doch die biblische Dichtung kann uns Vorbild sein in ihrer Suche nach eigenen Fehlern in der politischen Vergangenheit als Ursachen für das Unglück der Gegenwart. Echt und wirklichkeitsnah erscheint uns die Dichtung in ihrem deutlichen Eingeständnis eigener Ohnmacht; es mündet unmittelbar in die vertrauensvolle Hinwendung zu einer Frieden stiftenden Macht über uns.
Das 5. Klagelied [6]
1 Herr, denk daran, was uns geschehen, blick her, und sieh unsre Schmach!
2 An Ausländer fiel unser Erbe, unsre Häuser kamen an Fremde.
3 Wir wurden Waisen, Kinder ohne Vater, unsere Mütter wurden Witwen.
4 Unser Wasser trinken wir für Geld, unser Holz müssen wir bezahlen.
5 Wir werden getrieben, das Joch auf dem Nacken, wir sind müde, man versagt uns die Ruhe.
6 Nach Ägypten streckten wir die Hand, nach Assur, um uns mit Brot zu sättigen.
7 Unsere Väter haben gesündigt; sie sind nicht mehr. Wir müssen ihre Sünden tragen.
8 Sklaven herrschen über uns, niemand entreißt uns ihren Händen.
9 Unter Lebensgefahr holen wir unser Brot, bedroht vom Schwert der Wüste.
10 Unsere Haut glüht wie ein Ofen von den Gluten des Hungers.
11 Frauen hat man in Zion geschändet, Jungfrauen in den Städten von Juda.
12 Fürsten wurden von Feindeshand gehängt, den Ältesten nahm man die Ehre.
13 Junge Männer mussten die Handmühlen schleppen, unter der Holzlast brachen Knaben zusammen.
14 Die Alten blieben fern vom Tor, die Jungen vom Saitenspiel.
15 Dahin ist unseres Herzens Freude, in Trauer gewandelt unser Reigen.
16 Die Krone ist uns vom Haupt gefallen. Weh uns, wir haben gesündigt.
17 Darum ist krank unser Herz, darum sind trüb unsere Augen
18 über den Zionsberg, der verwüstet liegt; Füchse laufen dort umher.
19 Du aber, Herr, bleibst ewig, dein Thron von Geschlecht zu Geschlecht.
20 Warum willst du uns für immer vergessen, uns verlassen fürs ganze Leben?
21 Lass uns zurückkehren, Adonaj, zu dir,
dann können wir uns (zu dir) bekehren;
erneuere unsere Tage wie vor alters.
22 Oder hast du uns denn ganz verworfen, zürnst du uns über alle Maßen?
[1] Zusammengestellt von Christoph Uehlinger, Hebräische Lieder, Fribourg 1982.
[2] Geb. 1908 in Riga, gest. 1983 in Kiryat Shmuel: Architekt, Maler, Illustrator, Komponist, tätig in Haifa.
[3] U.a. in Kumbaya, Oekumenisches Jugendgesangbuch. Lieder und Texte, Zürich 1980, Nr. 78, Die Fontäne. Ein Liederbuch für Leute unterwegs zum größeren Leben, Evangelisches Jugendwerk, Stuttgart 31981, Nr. 85, Die Mundorgel, Köln 2001, Nr. 104, Durch Hohes und Tiefes. Studentengesangbuch, München 2018, Nr. 261.
[4] Ausführliche Exegesen finden sich z. B. bei Hans-Joachim Kraus, Klagelieder (Threni), BK 20, Neukirchen 21960, 85-92 oder bei Otto Kaiser, Klagelieder. Übersetzt und erklärt, ATD 16/2, Göttingen 41992, 187-198.
[5] Dazu O. Kaiser, Klagelieder (s. Anm. 4) 191, der daraus sein Datierungskriterium für das 5. Klagelied gewinnt: „Die Wende vom 5. zum 4. Jh. v. Chr“.
[6] Nach der Deutschen Einheitsübersetzung 1980.
„Decretum dimissionis in sodalem professum latum vim habet simul ac ei, cuius interest, notificatur. Decretum vero, ut valeat, indicare debet ius, quo religious dimissus gaudet, recurrendi intra decem dies a recepta notificatione ad auctoritatem competentem. Recursus effectum habet suspensivum.“
„Das gegenüber einem Professen ausgestellte Entlassungsdekret hat Rechtskraft, sobald es dem Betroffenen zur Kenntnis gebracht wird. Das Dekret muss aber zu seiner Gültigkeit einen Hinweis auf das dem Entlassenen zustehende Recht enthalten, innerhalb von zehn Tagen nach Empfang der Bekanntgabe Beschwerde an die zuständige Autorität einzulegen. Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.“
von Martin Rehak
Mit dem Motu Proprio Competentias quasdam decernere vom 11.02.2022 (dt. Übersetzung hier), welches am 15.02.2022 sowohl vom Vatikanischen Pressesaal vorgestellt als auch durch Abdruck im L’Osservatore Romano promulgiert und mit sofortiger Wirkung in Kraft gesetzt worden ist, hat Papst Franziskus ein „Artikelgesetz“ erlassen, mit dem auf einen Schlag eine Vielzahl unterschiedlicher Normen sowohl des Codex Iuris Canonici (CIC) als auch des Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO) geändert wurden. Insgesamt haben nicht weniger als elf Kanones des CIC und neun Kanones des CCEO eine Änderung erfahren. In einer vergleichsweise knapp gehaltenen Einleitung (Arenga) erläutert der Papst das Generalthema des Motu Proprio, nämlich im Sinne einer „heilsamen Dezentralisierung“ (vgl. dazu auch Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium vom 24.11.2013, in: AAS 105 [2013], 1019–1137, hier 1027 [Ziff. 16]) „den Sinn für die Kollegialität und die pastorale Verantwortlichkeit der Diözesan- und Eparchialbischöfe […] wie auch der höheren Oberen zu fördern und darüber hinaus die Grundsätze der Rationalität, der Wirksamkeit und der Effizienz zu begünstigen.“
Der nachstehende Beitrag wird zunächst eine dieser Änderungen im CIC – nämlich jene zu c. 700 CIC – in rechtsgeschichtlicher und systematischer Rücksicht näher beleuchten, um anschließend in einem summarischen Überblick auch die weiteren Änderungen kurz zu skizzieren. Dabei kommt der Verfasser dieses Beitrags nicht umhin, auf zwei Verständnisprobleme hinzuweisen, die durch unterschiedliche Textversionen in der lateinischen Fassung des Motu Proprio einerseits, in dessen deutscher Übersetzung (und anderen Übersetzungen) andererseits hervorgerufen werden.
C. 700 CIC zählt zu den Normen, welche das Verfahren der Entlassung von Ordensmitgliedern regeln. Dabei kommen – neben Entlassungen von Rechts wegen (vgl. c. 694 CIC) – zum einen strafweise Entlassungen gemäß c. 695 CIC, zum anderen Entlassungen aus anderen gewichtigen Gründen gemäß c. 696 CIC in Betracht. Handelnde Akteure im Verfahren sind insbesondere der höhere Obere (Superior maior), der Rat des höheren Oberen, sowie der höchste Obere (supremus Moderator, oberster Leiter). Als „höhere Obere“ werden dabei gemäß c. 620 CIC jene Oberen bezeichnet, die entweder das ganze Ordensinstitut oder eine Ordensprovinz oder eine rechtlich selbständige Ordensniederlassung leiten. In Frauenorden wird das Amt der höheren Oberin selbstredend von einer Frau wahrgenommen. In den klerikalen Ordensgemeinschaften päpstlichen Rechts haben die höheren Oberen zugleich die Rechtsstellung eines (Ordens-)Ordinarius, vgl. dazu c. 134 § 1 CIC. Im Entlassungsverfahren ist der höhere Obere bzw. die höhere Oberin verpflichtet, seinen bzw. ihren Rat im Sinne des c. 627 CIC einzubeziehen. Bezüglich dieses Beratungsorgans trifft das kodikarische Recht keine näheren Regelungen, sondern verweist auf die Konstitutionen, also die grundlegenden Normen des ordensinternen Rechts. Oberster Leiter bzw. oberste Leiterin ist dabei gemäß c. 622 CIC jene Person, die (gemäß dem jeweiligen Eigenrecht der Gemeinschaft je unterschiedlich ausgestaltete) Vollmacht über alle Provinzen, Niederlassungen und Mitglieder des Ordensinstituts innehat. Im Entlassungsverfahren obliegt es dann zunächst dem höheren Oberen bzw. der höheren Oberin, gemeinsam mit seinem bzw. ihrem Rat den entscheidungserheblichen Sachverhalt festzustellen. Dabei hat das betroffene Mitglied gemäß c. 698 CIC das Recht, sich jederzeit an den obersten Leiter bzw. die oberste Leiterin zu wenden, um bei ihm bzw. ihr rechtliches Gehör zu finden. Nach Feststellung des Sachverhalts ist die Angelegenheit dem obersten Leiter bzw. der obersten Leiterin zu übergeben, der bzw. die wiederum gemeinsam mit seinem bzw. ihrem Rat eine Entscheidung über Entlassung oder Verbleib im Orden trifft. Das Entlassungsdekret ist danach vom obersten Leiter bzw. von der obersten Leiterin auszustellen.
In diesem Zusammenhang hatte nun c. 700 CIC a.F. bestimmt:
„Das Entlassungsdekret hat keine Rechtskraft, wenn es nicht vom Heiligen Stuhl bestätigt worden ist, dem das Dekret und sämtliche Akten zuzuleiten sind; handelt es sich um ein Institut diözesanen Rechts, so steht die Bestätigung dem Bischof der Diözese zu, in der die Niederlassung liegt, welcher der Ordensangehörige zugeordnet ist. Das Dekret muss aber zu seiner Gültigkeit einen Hinweis auf das dem Entlassenen zustehende Recht enthalten, innerhalb von zehn Tagen nach Empfang der Bekanntgabe Beschwerde an die zuständige Autorität einzulegen. Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.“
Wie sich der mit einem Quellenapparat versehenen, von der Päpstlichen Kommission für die authentische Interpretation des CIC (jetzt: Päpstlicher Rat für die Gesetzestexte) herausgegebenen Ausgabe des CIC/1983 entnehmen lässt, hatte c. 700 CIC a.F. keine unmittelbare Vorgängernorm im Kodex des kanonischen Rechts von 1917, sondern vereint die aus cann. 647 § 2 Nr. 4, 650 § 2 Nr. 2 und 666 CIC/1917 bekannten Rechtsgedanken und normativen Elemente. Dies hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass das Recht der Entlassungen von Ordensleuten im alten Recht wesentlich differenzierter ausgestaltet war und drei Fallgruppen zu unterscheiden waren (cann. 647–648 CIC/1917: Ordensleute, die zeitliche Gelübde abgelegt haben; cann. 649–653 CIC/1917: Ordensleute, die ewige Gelübde in einem nicht exemten klerikalen oder in einem laikalen Institut abgelegt haben; cann. 654–668 CIC/1917: Ordensleute, die ewige Gelübde in einem exemten klerikalen Institut abgelegt haben). Dabei hatte can. 647 § 2 Nr. 4 CIC/1917 das Recht eröffnet, beim Apostolischen Stuhl das Rechtsmittel des Rekurses mit Suspensiveffekt einzulegen. Aus cann. 650 § 2 Nr. 2, 666 CIC/1917 hatte sich ergeben, dass Entlassungsdekrete erst nach Bestätigung durch den Apostolischen Stuhl, näherhin durch die Religiosenkongregation, rechtliche Wirkung haben sollten.
In c. 700 CIC a.F. waren diese Rechtsgedanken in der Weise miteinander kombiniert worden, dass nunmehr in allen Fällen eine außerhalb des Ordens stehende Autorität das Entlassungsdekret zu bestätigen hatte. Im Falle einer Ordensgemeinschaft bischöflichen Rechts war dies der zuständige Diözesanbischof, im Falle einer Ordensgemeinschaft päpstlichen Rechts hingegen der Papst und die Römische Kurie. Ferner wurde bereits in c. 700 CIC a.F. auf die Notwendigkeit einer Rechtsmittelbelehrung und die Möglichkeit einer Beschwerde (Rekurs) hingewiesen.
Dabei wurde die Bestätigung des Entlassungsdekrets anscheinend als integrierender Bestandteil des Entlassungsverfahrens verstanden. Denn mit einer Responsio ad dubia vom 21.03.1986, in: AAS 78 (1986), 1323, hatte die Päpstliche Kommission für die authentische Interpretation des CIC (PCI) klargestellt, dass die Bekanntgabe des Entlassungsdekrets an die betroffene Person erst nach erfolgter römischer Bestätigung zu geschehen habe. In der Literatur wurde daran kritisiert, dass damit die Betroffenen „unter Umständen unangemessen lange über den Ausgang des Verfahrens im Unklaren“ (MKCIC–Henseler, c. 700, Rz. 3) gelassen werden.
Ebenso wurde nach Inkrafttreten des CIC die Frage gestellt, wer innerhalb der Kurie die zuständige Instanz für nachfolgende Rekurse wäre. Nachdem gemäß c. 700 CIC a.F. die Kongregation für die Institute geweihten Lebens und für die Gesellschaften apostolischen Lebens bei Betroffenen aus Ordensgemeinschaften päpstlichen Rechts bereits im Entlassungsverfahren beteiligt war, wurde von namhaften Ordensrechtlern (Dammertz, Primetshofer, Henseler) die Auffassung vertreten, das Rechtsmittel könne unmittelbar bei der Apostolischen Signatur als Verwaltungsgerichtshof eingelegt werden. Auch diese Ansicht wurde indes mit einer weiteren Responsio ad dubia vom 21.03.1986, in: AAS 78 (1986), 1323, von der Päpstlichen Kommission zurückgewiesen; ihr zufolge war für die Befassung mit einem Rekurs erneut die Ordenskongregation als Verwaltungsbehörde zuständig, obwohl diese sich bereits im Zuge der Bestätigung eine für das betroffene Ordensmitglied negative Meinung in der Sache gebildet hatte. Damit förderte die alte Regelung eine unnötig lange Verfahrensdauer, insofern vor einer gerichtlichen Entscheidung durch die Apostolische Signatur zunächst eine (nochmalige) Verwaltungsentscheidung der Kongregation (zusätzlich zur Bestätigung des Entlassungsdekrets) ergehen musste, ohne dass dadurch der Rechtsschutz der Betroffenen signifikant verbessert worden wäre.
Mit der jetzt von Papst Franziskus verfügten Neuregelung wird auf die externe Bestätigung des Entlassungsdekrets des supremus Moderator gänzlich verzichtet. In etwa wird damit jene Rechtslage etabliert, die bereits in can. 626 des SchemaCIC von 1980 vorgesehen gewesen war; dessen § 1 hatte für Orden päpstlichen Rechts einen Rekurs beim Apostolischen Stuhl vorgesehen, in § 2 allerdings für Gemeinschaften diözesanen Rechts sowie für rechtlich selbständige Klöster im Sinne des jetzigen c. 615 CIC, die mangels höherer Oberer der Aufsicht des Diözesanbischofs anvertraut sind, eine Bestätigung des Diözesanbischofs vorgesehen, die dann in c. 700 CIC a.F. auch geltendes Recht wurde.
Zusammenfassend kann man sagen, dass mit der jetzigen Neuregelung die Autonomie der Orden gestärkt und ein rascher Abschluss des Verfahrens insbesondere in den Fällen gewährleistet wird, in denen das betroffene Ordensmitglied innerlich mit der Entlassung einverstanden ist, also keine Rechtsmittel einlegt. Zugleich bleibt durch die unveränderte Regelung zum Rechtsmittel des Rekurses ein angemessener Rechtsschutz sichergestellt.
Damit lässt sich feststellen, dass die Neufassung des c. 700 CIC sich bestens in das Generalthema einer heilsamen Dezentralisierung einfügt. Wie dieses Thema bei den übrigen mit dem Motu Proprio Competentias quasdam decernere verfügten Änderungen zur Geltung gebracht wird, zeigt der nachstehende Durchgang durch die weiteren Neuregelungen:
- Gemäß Artt. 1–2 u. 8 des Motu Proprio tritt in den cc. 237 § 2, 242 § 1 u. 775 § 2 CIC n.F., in denen es um die Zuständigkeiten der Bischofskonferenz für die Errichtung überdiözesaner Seminare, die Ordnung für die Priesterbildung, sowie die Herausgabe von Katechismen geht, an die Stelle einer „Genehmigung (approbatio)“ eine „Bestätigung (confirmatio)“. Das Instrument der Bestätigung war bereits vom Motu proprio Magnum principium vom 03.09.2017, in: AAS 109 (2017), 967–970, eingesetzt worden, um in c. 838 § 3 CIC n.F. die Stellung der Bischofskonferenzen zu stärken.
- Gemäß Art. 3 des Motu Proprio wird in c. 265 CIC n.F. die Aufzählung möglicher geistlicher Heimatverbände für die Inkardination von Klerikern um jene öffentlichen (vgl. dazu c. 301 § 3 CIC) klerikalen (vgl. dazu c. 302 CIC) Vereine erweitert, denen der Apostolische Stuhl ein Inkardinationsrecht gewährt hat. Damit wird eine längere Debatte um das Für und Wider eines Inkardinationsrechts bei in der Rechtsform des kirchlichen Vereins organisierten neuen geistlichen Gemeinschaften bzw. Priesterbruderschaften zugunsten dieser Gruppierungen beendet; eine Regelung die nun allerdings die Stellung der Diözesanbischöfe schwächt.
- Zum speziellen Vereinigungsrecht für geweihte Jungfrauen nach c. 604 § 2 CIC stellt ein mit Art. 4 des Motu Proprio neu eingefügter § 3 klar, dass für die Anerkennung und Errichtung derartiger Vereinigungen auf Bistumsebene der Diözesanbischof und auf nationaler Ebene die Bischofskonferenz zuständig sind.
- Während bislang der oberste Leiter bzw. die oberste Leiterin einer Ordensgemeinschaft gemäß c. 686 § 1 CIC a.F. ein Exklaustrationsindult für längstens drei Jahre gewähren konnte, verlängert Art. 5 des Motu Proprio die Zeitdauer eines solchen Indults auf bis zu fünf Jahre.
- In Ordensinstituten diözesanen Rechts sowie in Klöstern, die gemäß c. 615 CIC in besonderer Weise der Aufsicht des Diözesanbischofs anvertraut sind, bestimmte c. 688 § 2 CIC a.F., dass ein Austrittsindult für zeitliche Professen zur Gültigkeit einer Bestätigung durch den Diözesanbischof bedurfte. Art. 6 des Motu Proprio ändert diese Regelung dahingehend ab, dass eine solche Bestätigung künftig nur noch bei Indulten für Mitglieder eines monasterium sui iuris im Sinne des c. 615 CIC verlangt wird. Die Zuständigkeit des obersten Leiters bzw. der obersten Leiterin mit Zustimmung seines bzw. ihres Rates für die Gewährung des Austrittsindults bleibt unverändert.
- Gemäß Art. 7 des Motu Proprio wird die Stellung des höheren Oberen bzw. der höheren Oberin eines monasterium sui iuris im Sinne des c. 615 CIC dahingehend gestärkt, dass nunmehr er bzw. sie mit Zustimmung des Rates über die Entlassung eines Mitglieds entscheiden kann (vgl. c. 699 § 2 CIC n.F.); bislang kam diese Entscheidung dem Diözesanbischof zu.
- In den cc. 1308, 1310 CIC geht es um die Reduzierung von Messverpflichtungen bzw. sonstigen Verpflichtungen aufgrund frommer Stiftungen; die diesbezüglichen Zuständigkeiten werden gemäß Artt. 9–10 des Motu Proprio neu geregelt. Bislang durfte gemäß c. 1308 § 2 CIC a.F. die Herabsetzung einer Messverpflichtung nur dann durch den Ordinarius (Diözesanbischof, Generalvikar) verfügt werden, wenn eine Herabsetzung bei verminderten Einkünften bereits ausdrücklich in der Stiftungsurkunde gestattet worden war. In den Fällen, in denen eine solche Gestattung fehlte, war die eventuelle Herabsetzung der Verpflichtung gemäß c. 1308 § 1 CIC a.F. dem Apostolischen Stuhl vorbehalten. Das Motu Proprio streicht den bisherigen § 2 dieses Kanons und hebt die Reservation zugunsten des Apostolischen Stuhls auf, so dass künftig in allen Fällen, in denen aus gerechtem und notwendigem Grund eine Anpassung von Messverpflichtungen an verminderte Einkünfte aus der Messstiftung vorzunehmen ist, hierüber gemäß c. 1308 § 1 CIC n.F. nunmehr die Diözesanbischöfe bzw., sofern die Begünstigte der Messstiftung eine klerikale Ordensgemeinschaft ist, deren oberster Leiter bestimmen. Dies gilt auch dann, wenn es sich um eine Ordensgemeinschaft bischöflichen Rechts handeln sollte (vgl. c. 1308 § 5 CIC a.F. mit c. 1308 § 4 CIC n.F.).
Unklar ist, ob der Text von c. 1308 § 2 CIC n.F. gegenüber dem aus c. 1308 § 3 CIC a.F. eine Änderung erfahren hat. In der Bekanntmachung der lateinischen Version des Motu Proprio liest man zu c. 1308 § 2 CIC n.F. „… Missas legatorum, quae sint per se stantia …“, während der bisherige Text des c. 1308 § 3 CIC a.F. „… Missas legatorum vel quoquo modo fundatas, quae sint quae sint per se stantia …“ lautete. In der früher als alle anderen online verfügbar gemachten italienischen Version des Motu Proprio ist ebenfalls von „… le Messe dei legati che sono autonomi …“ die Rede, während die deutsche Übersetzung des Motu Proprio den alten Text („… Messverpflichtungen aus gesondertem Zweckvermögen, das aus Vermächtnissen stammt oder sonstwie gestiftet wurde …“) des c. 1308 § 3 CIC a.F. wiederholt.
Was die Reduzierung oder Umwandlung der Verpflichtungen aus sonstigen Willensverfügungen zu frommen Zwecken anbelangt, hatte c. 1310 CIC a.F. eine klare Unterscheidung von drei Fallgruppen vorgesehen. Demnach waren die Ordinarien für eine etwaige Reduzierung zuständig, wenn ihnen entweder vom Stifter selbst eine ausdrückliche diesbezügliche Vollmacht eingeräumt worden war (vgl. c. 1310 § 1 CIC a.F.) oder wenn die Erfüllung der vom Stifter auferlegten Verpflichtungen wegen verminderter Einkünfte oder aus einem anderen, unverschuldeten Grund unmöglich geworden war (vgl. c. 1310 § 2 CIC a.F.). Die dritte Fallgruppe bildeten jene Fälle, in denen eine Herabsetzung der Verpflichtung vom Stifter nicht vorgesehen und die Erfüllung der Verpflichtung an sich noch möglich war; in diesen Fällen war der Apostolische Stuhl für eine eventuelle Veränderung der Verpflichtungen zuständig (vgl. c. 1310 § 3 CIC a.F.).
Bei der durch Art. 10 des Motu Proprio vorgenommenen Neukonzeption dieses Kanons bereiten unterschiedliche Textfassungen in den verschiedenen Sprachen erhebliche Probleme, die jetzt geltende Rechtslage zu erkennen und die innere Logik des c. 1310 CIC n.F. zu verstehen. Vorab sei festgestellt, dass der neue Kanon nur noch zwei Paragraphen umfasst, wobei der neue § 1 auf den ersten Blick wie eine Kompilation der bisherigen §§ 1–2 wirkt, während der alte § 3 unverändert als neuer § 2 beibehalten wird. Die Probleme stecken nun im Detail. Der lateinische Text für c. 1310 § 1 CIC n.F. bietet nach wie vor die Klausel „… si fundator potestatem hanc Ordinario expresse concesserit …“, macht also eine Abänderung einer bestehenden Verpflichtung von einer vorgängigen Bewilligung seitens des Stifters abhängig. Die Sinnspitze der Gesetzesänderung wäre dann darin zu sehen, dass künftig in den bisherigen Fällen des c. 1310 § 1 CIC a.F. der Ordinarius nicht sofort allein entscheiden kann, sondern die bislang nur für Fälle des c. 1310 § 2 CIC a.F. vorgesehene Anhörung der Beteiligten und des Vermögensverwaltungsrats durchführen und auf die bestmögliche Wahrung des ursprünglichen Stifterwillens achten muss. In den Übersetzungen in die modernen Sprachen hingegen fehlt zu c. 1310 § 1 CIC n.F. dieser Passus bezüglich einer vom Stifter selbst dem Ordinarius eingeräumten Änderungsvollmacht. Je nach dem, welche Textfassung dem wahren Willen des Gesetzgebers entspricht, ist daher unter „den übrigen Fällen“ im Sinne des c. 1310 § 2 CIC n.F. Unterschiedliches zu verstehen. Ist der lateinische Text authentisch, dann sind die übrigen Fälle jene, in denen der Stifter dem Ordinarius keine Änderungsvollmacht eingeräumt hat. Bilden hingegen die Übersetzungen den wahren Willen des Gesetzgebers ab, dann sind die übrigen Fälle jene, in denen es für eine Herabsetzung oder Umwandlung von Willensverfügungen bzw. der hierdurch auferlegten Verpflichtungen keinen gerechten und notwendigen Grund gibt.
Eine Gesetzesänderung, die in sich derartige Fragen aufwirft, ist weniger geeignet, „die Grundsätze der Rationalität, der Wirksamkeit und der Effizienz zu begünstigen.“
„Episcopus dioecesanus, qui septuagesimum quintum aetatis annum expleverit, rogatur ut renuntiationem ab officio exhibeat Summo Pontifici, qui omnibus inspectis adiunctis providebit.“
„Ein Diözesanbischof, der das fünfundsiebzigste Lebensjahr vollendet hat, ist gebeten, seinen Amtsverzicht dem Papst anzubieten, der nach Abwägung aller Umstände entscheiden wird.“
von Martin Rehak
Erinnerlich war es Elmar Maria Kredel (1922–2008), der langjährige Bamberger Erzbischof (1977–1994), von dem man sich erzählt, er habe trotz massiver gesundheitlicher Beschwerden die Einreichung seines Gesuchs um vorzeitigen Amtsverzicht gemäß c. 401 § 2 CIC deshalb um Monate wenn nicht Jahre hinausgezögert, weil es ihm unanständig und unmoralisch erschien, die bayerische Staatskasse gemäß Art. 10 des Bayerischen Konkordats mit Leistungen für zwei emeritierte Bamberger Erzbischöfe zu belasten. Denn seinerzeit lebte ja noch Kredels unmittelbarer Amtsvorgänger Josef Schneider (1906–1998), der das Erzbistum Bamberg von 1955 bis 1976 geleitet hatte. Dagegen hat sich, wie katholisch.de berichtet, der amtierende Bamberger Erzbischof Ludwig Schick (*1949, Erzbischof seit 2002) vor einigen Tagen in einem Interview mit der Zeitung „Fränkischer Tag“ dafür ausgesprochen, die kirchlichen Leitungsämter, darunter auch das Amt des Diözesanbischofs, künftig grundsätzlich nur befristet, beispielsweise für sieben Jahre, zu vergeben.
Es ist bemerkenswert, dass sich der Erzbischof damit auch eine der Überlegungen des Grundtextes „Macht und Gewaltenteilung in der Kirche – Gemeinsame Teilnahme und Teilhabe am Sendungsauftrag“ des Synodalforums I des deutschen Synodalen Weges zu eigen macht, der in diesen Tagen auf der Dritten Synodalversammlung am 03.–05.02.2022 in Zweiter Lesung verhandelt wird; dort heißt es:
„Für die katholische Kirche ist es wichtig, dass Entscheidungsprozesse an die Interessen und Vorstellungen der Gläubigen zurückgebunden sind, die in ihrem Glaubenssinn wurzeln. Diese Rückbindung verlangt eine qualifizierte und rechtlich garantierte Partizipation in allen Beratungs- und Entscheidungsprozessen der Kirche […] durch zeitliche Begrenzung der Wahrnehmung von kirchlichen Leitungsämtern“ (a.a.O., Ziff. 7.2, S. 18).
Dies wird durch den Hinweis abgesichert, es könne hier „aus bewährten Traditionen der Ordensgemeinschaften und der katholischen Verbände geschöpft werden“ (Ziff. 7.2, S. 18). In der wesentlich längeren Fassung des Grundtextes für die Erste Lesung war dazu näher ausgeführt worden: „In den Orden ist es verbreitete Praxis, dass Obere Jurisdiktions-, aber keine Weihegewalt haben. Die Jurisdiktionsgewalt wird ihnen von Rechts wegen nach einer Wahl oft lediglich befristet übertragen“ (a.a.O., Ziff. 6.2, S. 24). „In vielen Orden ist die Wahl auf Zeit üblich“ (a.a.O., Ziff. 7.2, S. 32).
Zu diesen Hinweisen kann man die kritische Rückfrage stellen, ob der Verweis auf Organisationsformen für jene Gläubigen, die nicht der kirchlichen Hierarchie zugehören bzw. sich im Fall der Ordensmitglieder freiwillig zu einem geistlichen Verband zusammenschließen, sachgerecht und zielführend ist – oder ob, salopp gesagt, auf dem Gebiet der Weiheämter andere Regeln gelten (und womöglich aus theologischen Gründen gelten müssen). Hierzu seien mehrere Aspekte in den Blick genommen.
Erstens sei daran erinnert, dass im Arbeitspapier des Vorbereitenden Forums aus der Gemeinsamen Konferenz vom 13./14.09.2019 (Stand: 20.01.2020) ein korrektes Verständnis der kirchlichen Hierarchie herausgearbeitet worden war:
„Das ‚Priestertum des Dienstes‘ (sacerdotium ministeriale seu hierarchicum) hat […] eine dienende Funktion. Es stärkt und leitet das Volk, damit die Gläubigen ihre eigene Sendung […] erfüllen (Lumen gentium 10). ‚Hierarchisch‘ ist das Priestertum des Dienstes innerhalb des dreifachen Amtes des Bischofs, Priesters und Diakons, nicht im Gegenüber zum Gottesvolk, sondern im Blick auf Jesus Christus als Haupt seines Leibes“ (a.a.O., Ziff. 2, S. 12).
Die Kategorie Hierarchie stellt also in erster Linie auf die Verwurzelung des kirchlichen Amts in einem heiligen Ursprung ab. Das ständische (Miss-)Verständnis, welches die Kleriker den Laien vor- und überordnet, ist abzulehnen. Und anders gesagt: Die einfachen Gläubigen bilden gerade nicht die unterste Stufe eines hierarchisch strukturierten Gottesvolkes, weil sich nach der Lehre der Kirchenkonstitution Lumen Gentium des Zweiten Vatikanischen Konzils „das gemeinsame Priestertum der Gläubigen […] das Priestertum des Dienstes […] dem Wesen und nicht bloß dem Grade nach [unterscheiden]“ (LG 10,2). In diesem Punkt differiert das katholische Amts- und Weiheverständnis grundlegend von der bekannten Ansicht Martin Luthers, dem zufolge „was aus der Taufe gekrochen ist, […] sich rühmen [kann], dass es schon zum Priester, Bischof und Papst geweiht sei, obwohl es nicht einem jeglichen ziemt, solch Amt auszuüben“ (WA 6, 408, 11f.).
Zweitens ist zu sehen, dass sich der Grundtext des Synodalforums I erklärtermaßen gegen eine Ekklesiologie und Praxis des kirchlichen Amts wendet, die „Macht einseitig an die Weihe bindet und sie für sakrosankt erklärt“ (a.a.O., Hinführung, S. 2). Dazu wird zum einen zwischen christologisch legitimierter Vollmacht, die (exklusiv) mit dem „Dienst der Evangeliumsverkündigung in Wort und Tat“ (a.a.O., Ziff. 6, S. 12) assoziiert wird, und „organisatorisch notwendigen Formen der Machtausübung“, deren präzise Herleitung und Legitimation an dieser Stelle offen bleibt, unterschieden. Zum anderen thematisiert der Grundtext das Weihesakrament nur kursorisch (vgl. das Vorkommen der Begriffe „ordo“ bzw. „Weihe“ a.a.O., Hinführung, S. 3; Ziff. 6.1, S. 13; Ziff. 6.2, S. 14 mit Anm. 3; Ziff. 7.1, S. 16; Ziff. 8.3, S. 20f.). Im Vergleich der Textfassungen für die Erste und Zweite Lesung fällt zudem in Ziff. 6.1. auf, dass die Formulierung: „Das besondere Priestertum des Dienstes (ordo) ist um des gemeinsamen Priestertums aller willen notwendig, weil […]“ (a.a.O., Ziff. 6.1, S. 23) der Aussage gewichen ist: „Amtliche Vollmacht ist gegeben, um […]“, (a.a.O. Ziff. 6.1, S. 13). Ferner sei bemerkt, dass der Grundtext zutreffend darlegt, dass sich das kirchliche Leitungsamt „auf dem Fundament der Apostel und Propheten entwickelt“ (a.a.O., Ziff. 5.2, S. 11) hat (ausführlicher zum exegetischen Befund die Fassung der Ersten Lesung, a.a.O., Ziff. 5.2, S. 19), aber nicht mehr eigens hervorhebt, dass bereits im neutestamentlichen Zeugnis Handauflegung und Gebet als Grundelemente einer sakramentalen Weihe begegnen. Im Weiteren könnten die Ausführungen zur Gewaltentheorie des CIC/1983 (vgl. a.a.O., Ziff. 6.1, S. 13) der Annahme Vorschub leisten, dass Sinn und Bedeutung der sakramentalen Weihe sich in der Vermittlung von Weihegewalt erschöpften. Demgegenüber ist jedoch zu betonen, dass – wie im Grundtext eingangs der Ziff. 6.1. zutreffend dargelegt – sich die sakramental verliehene amtliche Vollmacht (im Schema der Tria Munera-Lehre) auf deren sämtliche drei Funktionen, also Heiligen, Lehren und Leiten, erstreckt. Dies entspricht der Ekklesiologie der Alten Kirche, die mit dem Prinzip der relativen Ordination Amt und Weihe strikt aneinander gekoppelt hatte, wie sich markant aus can. 6 des Konzils von Chalkedon (a. 451) ergibt: „Niemand darf absolut [d.h. losgelöst von einem bestimmten Weihetitel] ordiniert werden, weder ein Presbyter noch ein Diakon noch überhaupt jemand, der zum kirchlichen Stand gehört; <das heißt, die Ordination ist> nur <gültig>, wenn der Ordinierte in besonderer Weise einer Kirche in der Stadt oder auf dem Land, einem Martyrium oder Kloster zugesprochen wird“ (vgl. Alberigo / Wohlmuth, Dekrete der ökumenischen Konzilien, Bd. 1, S. 90). Dies entspricht aber auch der Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils über das Bischofsamt: „Die Bischofsweihe überträgt mit dem Amt der Heiligung auch die Ämter der Lehre und der Leitung […]“ (LG 21,2). Die im Mittelalter vorherrschende und zuletzt vom Konzil von Trient bestätigte Auffassung, wonach die Bischofsweihe nur eine Sakramentalie sei und sich Priester und Bischof nicht der Weihe, sondern nur der (ganz unabhängig von der Weihe durch kanonische Sendung vermittelten) Jurisdiktion nach unterscheiden, wurde damit zurückgewiesen. In konsequenter Weiterführung dieser Lehre des Konzils wird seit der vatikanischen Liturgiereform – in Anlehnung an den Weiheritus der Traditio apostolica, einer wohl aus dem 3. Jh. stammenden Kirchenordnung – im Weihegebet für den Bischof ausdrücklich erbeten, dass Gott dem Weihekandidaten den „spiritum principalem, den Geist der Führung“ verleiht.
All dies führt nun jedoch drittens zu der Frage, wie (theologisch) das Verhältnis von Weihe und Amtsdauer zu bestimmen ist. Der traditionsbildende Schlüsseltext ist dabei der erste Klemensbrief, zumal diese frühpatristische Schrift gerne als autoritative Wortmeldung der ersten Kirche der Christenheit mit primatialem Anspruch gedeutet wurde. In der Kirche von Korinth war es offenbar zu einem Streit „περὶ τοῦ ὀνόματος τῆς ἐπισκοπῆς“ (1 Clem 44,1), also zu einem Streit über den „Begriff der ἐπισκοπή (wörtl.: Aufsicht)“ (vgl. dazu auch Apg 1,20) oder – so die gängige Übersetzung – über die „Würde des Episkopenamtes“ gekommen. Dabei war es (nach römischer Wahrnehmung und Diktion) zur Absetzung („ἀποβάλλειν“) von Presbytern (im zeitgenössischen Sinn, d.h. von Mitglieder des kollegialen Leitungsgremiums der Ortskirche) gekommen. Hiergegen wendet sich nun der Verfasser des Traktats, indem er eine grundlose, nicht durch Fehlverhalten im Amt motivierte Absetzung als Sünde und Unrecht zurückweist und die Korinther zur Wiederherstellung des status quo ante ermahnt. Dazu werden in einem Makarismus jene Presbyter seliggepriesen, die bereits im Dienst verstorben sind und so einer Absetzung entgingen. Bei alledem bleiben zwar die Einzelheiten des korinthischen Streits im Dunkeln. (Nach meiner unmaßgeblichen Meinung wäre bei einer Spätdatierung des Briefs daran zu denken, dass sich in Korinth gerade der Umbruch von einer kollegialen Gemeindeleitung durch Presbyter hin zur monepiskopalen Gemeindeleitung durch den Bischof vollzog.) Hell leuchtet dagegen die Wirkungsgeschichte dieser alten Positionierung, gemäß der es bis in das 20. Jh. hinein als Selbstverständlichkeit angesehen wurde, dass – abgesehen von Fällen einer strafweisen Absetzung oder der Translation auf ein anderes Bistum – ein Diözesanbischof bis zu seinem Tod in einer geistlichen Ehe mit seinem Bistum verbunden blieb. In Fällen, in denen der amtierende Diözesanbischof aufgrund altersbedingter körperlicher und geistiger Einschränkungen seinem Amt in keiner Weise mehr gewachsen war, behalf man sich mit der Ernennung von Koadjutoren (vgl. dazu jetzt c. 403 §§ 2–3 CIC).
Im Ringen um eine Änderung oder Beibehaltung dieser Tradition beschränkte sich das Zweite Vatikanische Konzil im Dekret Christus Dominus über die Hirtenaufgabe der Bischöfe auf eine bloße Empfehlung. Jene Diözesanbischöfe, die „nicht mehr recht in der Lage sind, ihr Amt zu versehen, werden inständig gebeten, von sich aus […] den Verzicht auf ihr Amt anzubieten“ (CD 21). Nach diesem Denkanstoß vom Oktober 1965 dauerte es indes kein Jahr, bis Papst Paul VI. mit dem Motu Proprio Ecclesiae sanctae vom 06.08.1966, in: AAS 58 (1966) 757–787, dort Ziff. 11, eine Ausführungsbestimmung zur konziliaren Regelung erließ, gemäß welcher „enixe rogantur omnes dioecesani Episcopi […] ut, non ultra expletum septuagesimum quintum aetatis annum, renuntiationem ab officio sua sponte exhibeant Auctoritati competenti […]“. Diese Regelung ist ohne substanzielle Änderung in das geltende Recht des c. 401 § 1 CIC übernommen worden.
In einem Zwischenfazit lässt sich somit feststellen, dass das Kirchenrecht – in Anwendung des klassischen Maßstabs und der Rechtfertigungsfigur für Neuerungen: Notwendigkeit und Nützlichkeit – das vermeintlich unabänderliche Prinzip einer Berufung zur lebenslangen Nachfolge bzw. Amtsinhaberschaft bis zum Tod, jedenfalls in den Fällen einer sakramentalen Weihe, neu geformt hat. Dabei war mit der Neuregelung der Amtsdauer durch eine Altersgrenze ein klar definiertes Ziel verfolgt, nämlich etwaige, durch altersbedingt amtsunfähige Diözesanbischöfe hervorgerufene Missstände im Ansatz zu unterbinden.
Man wird geteilter Meinung darüber sein dürfen, ob der Schritt von der altehrwürdigen Tradition vor 1966 hin zur damaligen Neuregelung einerseits und von der geltenden Rechtslage hin zu einer nun debattierten generellen Amtszeitbegrenzung andererseits ein vergleichsweise kleiner oder ein enormer wäre. Ohne Zweifel jedoch wäre eine Amtszeitbegrenzung eine Änderung, die weitreichende praktische Nebenwirkungen nach sich zöge. Das eingangs erwähnte Argument der Rücksichtnahme auf den Konkordatspartner wird zwar angesichts der gegenwärtigen politischen Bestrebungen, die verfassungsrechtlich geforderte Ablösung der Staatsleistungen endlich in die Wege zu leiten (vgl. dazu Koalitionsvertrag 2021-2025, S. 111), auf längere Sicht wohl keine Rolle mehr spielen. Dafür stellen sich jedoch andere Fragen:
Besteht denn Grund zu der Hoffnung, dass nach Einführung einer Amtszeitbegrenzung die Amtsführung künftiger Bischöfe so vorbildlich ist, dass sie mit Begeisterung von den zuständigen Instanzen für eine zweite, dritte, vielleicht gar vierte Amtszeit bestätigt werden? Wird also eine solche Neustrukturierung dazu beitragen, dass die Redeweise vom Dienstcharakter des Amtes nicht mehr als verbrauchte Rhetorik empfunden wird, die ohne Resonanz in der Lebenswirklichkeit des Gottesvolkes bleibt? Werden von befristet mandatierten Amtsträgen die Gläubigen neu jene Wertschätzung, Stärkung und anleitende Unterstützung erfahren, die sie als mündige Christen verdienen? Kann anders gesagt davon ausgegangen werden, dass eine solche Neuerung die Bistumsleitung in Zukunft davor bewahrt, sich in einer beratungsresistenten Aura unnahbarer Abgehobenheit von Presbyterium und Volk zu entfremden? Wird umgekehrt der Kirche mit solchen Amtsträgern gedient sein, die sich in ihren Entscheidungen und ihrem Auftreten vielleicht allein danach richten, was für eine Wiederwahl opportun ist?
Und wenn es zu keiner weiteren Amtszeit kommt: Im Lichte der Lehre von der Sakramentalität der Bischofsweihe steht außer Frage, dass man es bei aus dem Amt geschiedenen Ex-Diözesanbischöfen faktisch mit Weihbischöfen zu tun hat. Für sie gilt gemäß c. 408 § 2 CIC der Grundsatz, dass der neue Diözesanbischof sie gemäß ihrer bischöflichen Rechte und Aufgaben einzusetzen hat. Von daher werden, ungeachtet gewisser Planungsunsicherheiten, diese Ex-Diözesanbischöfe mittelfristig wohl die Auxiliarbischöfe bisheriger Prägung verdrängen. Dennoch kann man sich fragen, ob ein inflationärer Zuwachs des Episkopats sinnvoll ist. An dem in c. 407 §§ 1–2 CIC entfalteten Prinzip der vertrauensvollen Beratung zwischen Diözesanbischof und Weihbischöfen wird man auf Dauer kaum festhalten können; denn was wird der Rat eines bei der Amtszeitverlängerung durchgefallenen Ex-Diözesanbischofs wohl wert sein?
Und last, but not least: Soll für den Bischof der Stadt Rom ein Sonderrecht gelten?
Jedenfalls ist festzustellen, dass der katholischen Kirche die Vorstellung einer „Weihe auf Zeit“ bislang vollkommen fremd ist. Hier stellen sich weitere Fragen: Würde im Falle einer solchen „Weihe auf Zeit“ im Anschluss an die bisherige Doktrin dem Geweihten ein unauslöschliches Prägemal (character indelebilis) verliehen? Und wie ist zu verfahren, wenn ein Ex-Diözesanbischof nach ein, zwei Amtsperioden mit einem anderen Diözesanbischof nochmals in Amt und Würden kommt: Erneute Weihe oder bloße Amtseinführung? Im Falle der nun zur Debatte gestellten Amtszeitbefristung für Diözesanbischöfe müsste man in letzter Konsequenz aber wohl genau über diese Fragen rund um eine „Weihe auf Zeit“ nachdenken. Aber könnte man hierfür, in Abwägung aller Umstände und unter Berücksichtigung weniger drastischer Alternativen, wirklich überragende Gründe der Nützlichkeit oder Notwendigkeit beibringen?
So viele Fragen, die demütig erahnen lassen: „Das Leben muss rückwärts verstanden und vorwärts gelebt werden“ (Sören Kierkegaard).
„Ut quis ad sacros ordines promoveri possit, sequentia requiruntur documenta:
1° testimonium de studiis rite peractis ad normam can. 1032;
2° si agatur de ordinandis ad presbyteratum, testimonium recepti diaconatus;
3° si agatur de promovendis ad diaconatum, testimonium recepti baptismi et confirmationis, atque receptorum ministeriorum de quibus in can. 1035; item testimonium factae declarationis de qua in can. 1036, necnon, si ordinandus qui promovendus est ad diaconatum permanentem sit uxoratus, testimonia celebrati matrimonii et consensus uxoris.“
„Damit jemandem die heiligen Weihen erteilt werden dürfen, sind folgende Dokumente erforderlich:
1° ein Zeugnis über den ordnungsgemäßen Abschluss der Studien nach Maßgabe von can. 1032;
2° sofern es sich um Weihebewerber für den Presbyterat handelt, ein Zeugnis über den Empfang des Diakonates;
3° sofern es sich um Bewerber für den Diakonat handelt, ein Zeugnis über den Empfang der Taufe und der Firmung sowie die Übernahme der Dienste nach can. 1035; ebenso ein Zeugnis über die abgegebene Erklärung nach can. 1036 sowie, wenn der Weihebewerber, dem der ständige Diakonat übertragen werden soll, verheiratet ist, Zeugnisse über die Eheschließung und die Zustimmung der Ehefrau.“
von Martin Rehak
Am 1. Januar 2022 ist im Bistum Würzburg die Ordnung über die Führung von Personalakten und Verarbeitung von Personalaktendaten von Klerikern und Kirchenbeamten (Personalaktenordnung) vom 30.11.2021, promulgiert durch Veröffentlichung im Amtsblatt (Abl) Würzburg 167 (2021) = Nr. 12 vom 17.12.2021, 311–322, in Kraft getreten.
Der Plan zur Schaffung einer Personalaktenordnung reicht zurück in den Herbst 2018. Unter dem Eindruck der sogenannten MHG-Studie „Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“ hatte der deutsche Episkopat in einer Erklärung vom 27.09.2018 sich auf ein mehrere Punkte umfassendes Maßnahmenpaket verpflichtet. Neben einer Neuregelung des Verfahrens zu Leistungen in Anerkennung zugefügten Leids, der Einrichtung eines überdiözesanen Monitorings für die Bereiche der Intervention und der Prävention sowie dem Angebot externer, unabhängiger Anlaufstellen für Opfer sexuellen Missbrauchs war damals auch angekündigt worden, „eine Standardisierung in der Führung der Personalakten der Kleriker“ zu erarbeiten. Im Pressebericht vom 26.09.2019 anlässlich der Herbst-Vollversammlung 2019 der Deutschen Bischofskonferenz konnte der seinerzeitige Vorsitzende, Reinhard Kardinal Marx, zum Stand der Dinge berichten, dass eine aus Personalverantwortlichen, Juristen und Verwaltungsfachleuten zusammengesetzte Arbeitsgruppe die gegenwärtige Praxis der Personalaktenführung in den deutschen (Erz-)Bistümern erhoben habe und auf dieser Basis bis zum Frühjahr 2020 eine Musterordnung abfassen werde. Deren erklärtes Ziel sollte insbesondere darin bestehen, eine im gesamten Konferenzgebiet einheitliche, transparente und verbindliche Dokumentation von Missbrauchsbeschuldigungen sicherzustellen. Im Pressebericht vom 25.02.2021 anlässlich der Frühjahrs-Vollversammlung 2021 verlautbarte der amtierende Vorsitzende der Bischofskonferenz, dass das Projekt einer Standardisierung in der Personalaktenführung nicht nur einschlägige Empfehlungen der MHG-Studie aufgreifen, sondern darüber hinaus die gesamte Personalaktenführung zu Klerikern in Deutschland vereinheitlichen werde. Auf der Herbst-Vollversammlung 2021 wurde schließlich am 22. September 2021 eine Musterordnung zur Personalaktenführung beschlossen (vgl. Pressebericht vom 23.09.2021), die sodann in den deutschen (Erz-)Bistümern als diözesanes Partikularrecht einzuführen war.
Wie eine Durchsicht der online zugänglichen Amtsblätter der deutschen (Erz-)Bistümer zeigt, scheint diese Vorgabe nahezu überall akkurat umgesetzt worden zu sein, vgl. im Einzelnen Abl Berlin 93 (2021), 165 (Nr. 206) nebst Anlage; Abl Dresden-Meißen 31 (2001), 232–245 (Nr. 91); Abl Freiburg (2021), 257–263 (Nr. 177); Abl Görlitz (2021), 33–45 (Nr. 98); Abl Hamburg 27 (2021), 226–232 (Art. 133); Abl Limburg (2021), 432–438 (Nr. 315); Abl Münster 155 (2021), 514–523 (Art. 227); Abl Osnabrück 63 (2021), 266–272 (Art. 192); Abl Paderborn 164 (2021), 202–207 (Nr. 153); Abl Passau 151 (2021), 289–304 (Nr. 110); Abl Regensburg (2021), 121–127; Abl Rottenburg-Stuttgart 65 (2021), 491–496; Abl Trier 165 (2021), 632–638 (Nr. 259). In den Amtsblättern der (Erz-)Bistümer Essen, Fulda, Hildesheim, Köln, Magdeburg und Speyer war dagegen bei Redaktionsschluss (30.12.2021, 20:00 Uhr) dieses Beitrags bedauerlicherweise eine Fehlanzeige zu konstatieren. Aber – wie nicht zuletzt die Erfahrung jener lehrt, für die Heiligabend schon einmal die „Nacht der langen Gesichter“ gewesen ist: Über Weihnachtsgeschenke sollte man grundsätzlich nicht vor Heilig Dreikönig bilanzieren, wenn auch die Weisen aus dem Morgenland ihre Gaben gebracht haben.
Die neue Personalaktenordnung (PAO) ist durch eine kurze Präambel sowie eine Unterteilung in 23 Artikel strukturiert. Gleichsam im Zentrum der Regelungen stehen die Artt. 7–10 PAO, die sich zum Inhalt der Personalakte äußern. Dabei liest sich Art. 7 PAO, der diese Frage im Allgemeinen behandelt, wie ein Kompendium von best practice-, aber auch von worst practice-Beispielen aus der bisherigen Praxis, nachdem Art. 7 Abs. 3 PAO ausführlich darlegt, welches Schriftgut nicht zum Inhalt von Personalakten zu machen ist.
In einer Gesamtbetrachtung des Regelwerks wird deutlich, dass diese Ordnung aus Sachgründen mit einer ganzen Reihe gesamtkirchlicher oder teilkirchlicher Normen und Ordnungen vernetzt ist.
Mit Blick auf das gesamtkirchliche Recht betrifft dies zum einen das kodikarische Weiherecht nebst dem kodikarischen Recht der Klerusausbildung. Insoweit nennt die Personalaktenordnung in Art. 8 Abs. 2 lit. a) PAO explizit c. 241 CIC sowie in Artt. 9 lit. g), 10 Abs. 2 lit. c) PAO jeweils die cc. 1050, 1051 CIC.
Dies betrifft zum anderen das gesamtkirchliche Strafprozessrecht. Gemäß Art. 7 Abs. 2 lit. g) PAO sind „abschließende Dekrete oder Urteile einer kanonischen Voruntersuchung eines Disziplinar- oder Strafprozesses“ zur Personalakte zu nehmen. Diese Regelung ist in mehrfacher Hinsicht interessant. Anfänglich verwundert es ein wenig, dass man auf der einen Seite anscheinend der Ansicht ist, kanonische strafrechtliche Voruntersuchungen könnten auch mit einem Urteil abgeschlossen werden; auf der anderen Seite aber anscheinend am Ausgang eines ggf. nachfolgenden Strafprozesses kein gesteigertes Interesse zeigt. Dass in Wahrheit wohl durchaus beides, d.h. sowohl Dekrete der Voruntersuchungen als auch Dekrete oder Urteile nachfolgender Strafverfahren, gemeint ist und nur die sprachliche Formulierung etwas missglückte, ergibt sich indes schlüssig aus dem insoweit eindeutig formulierten Art. 18 Abs. 2 PAO. Die Spannung der Regelung des Art. 7 Abs. 2 lit. g) PAO zum geflissentlich unerwähnt gelassenen c. 1719 CIC, wonach das eine kanonische Voruntersuchung abschließende Dekret nirgendwo anders als im Geheimarchiv der Kurie aufzubewahren ist, wird dadurch gemildert, dass unsere Norm erstens für die Dokumentation eines solchen Vorgangs in der Personalakte eine Kopie des Dekrets genügen lässt und zweitens in Art. 7 Abs. 2 PAO am Ende verlangt, dass u.a. diese Unterlagen „gesondert gesichert [also doch im Geheimarchiv?] zu verwahren“ sind. Vom kanonistischen Standpunkt besehen wäre es an dieser Stelle wünschenswert, wenn die Deutsche Bischofskonferenz nicht nur Normsetzungen veranlasst, die zu höherrangigem Recht augenscheinlich in Spannung stehen, sondern der deutsche Episkopat selbst an höherer Stelle eine klärende Debatte über das rechtspolitische Für und Wider der bischöflichen Geheimarchive als solcher anstieße.
Des Weiteren betrifft diese Vernetzung das partikulare Kirchenrecht. Dabei verweist die Personalaktenordnung zum einen in Art. 2 PAO auf jene kirchlichen Gesetze, welche schon länger die Verarbeitung personenbezogener Daten regeln, nämlich das Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG; vgl. dazu auch hier), die Durchführungsverordnung zum Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG-DVO) sowie die Anordnung über die Sicherung und Nutzung der Archive der katholischen Kirche (Kirchliche Archivordnung – KAO). In diesem Zusammenhang wird der Begriff der Verarbeitung in Art. 3 lit. e) PAO im Anschluss an § 4 Nr. 3 KDG legaldefiniert und in Art. 4 Abs. 3 PAO klargestellt, dass hinsichtlich Datenschutzverletzungen bei der Personalaktenführung der Verantwortliche im Sinne des § 4 Nr. 9 KDG und des § 2 der Kirchlichen Datenschutzgerichtsordnung (KDSGO) die jeweilige Diözese ist. Sodann wird in Artt. 19, 20 Abs. 1 PAO auf das KDG Bezug genommen. Art. 17 Abs. 4–5 PAO regelt unter Bezugnahme auf § 3 Abs. 4 KAO die Überführung von Personalakten aus der Registratur des bischöflichen Ordinariats in das Diözesanarchiv.
Zum anderen bezieht sich die Personalaktenordnung auf jene kirchlichen Normen, die zur Bekämpfung sexueller Missbräuche durch Kleriker erlassen worden sind, näherhin in Art. 7 lit. h) PAO auf die Rahmenordnung Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen (Präventionsordnung) – zur Übernahme in das Diözesanrecht des Bistums Würzburg vgl. Abl Würzburg 165 (2019), 492–500 – und in Artt. 7 Abs. 2 lit. j), 15 Abs. 2 PAO die Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst – zur Übernahme in das Diözesanrecht des Bistums Würzburg vgl. Abl Würzburg 165 (2019), 475–491.
Schließlich betrifft die besagte Vernetzung der Personalaktenordnung auch staatliches Recht. Insoweit ist vom kirchlichen Gesetzgeber zum einen das staatliche Straf- und Strafprozessrecht in den Blick genommen. In Art. 7 Abs. 2 lit. g) PAO wird daran erinnert, dass gemäß der bundesrechtlichen Verwaltungsvorschrift Mitteilungen in Strafsachen (MiStra) dort näher bezeichnete Unterlagen über Ermittlungs- und Strafverfahren durch staatliche Strafverfolgungsbehörden gegen Geistliche und Kirchenbeamte der öffentlich-rechtlich verfassten Religionsgesellschaften mit dem Vermerk „Vertrauliche Personalsache“ an Letztere zu übermitteln sind. Gemäß Art. 15 Abs. 1–2 PAO wird Dritten eine Auskunft aus, jedoch keine Einsicht in die Personalakte dann eingeräumt, wenn diese glaubhaft machen, dass ein kirchlicher Bediensteter „Handlungen nach dem 13. Abschnitt des Besonderen Teils des Strafgesetzbuches begangen hat und der Dritte als Betroffener der Straftat oder dessen Angehörige ersten Grades auf konkrete Anfragen hin Auskunft begehren“ (Art. 15 Abs. 2 PAO).
Zum anderen wird in Artt. 1, 23 Abs. 3 PAO klargestellt, dass die personalaktenrechtlichen Bestimmungen für Beamte des Freistaates Bayern, soweit diese auch auf Kirchenbeamte angewendet werden, als lex specialis anzusehen sind.
Die Gliederung der Personalakten von Klerikern soll nunmehr nach zeitlichen und sachlichen Gesichtspunkten erfolgen (Art. 8 Abs. 1 PAO). Eine entscheidende Zäsur für die chronologische Gliederung ist die Diakonenweihe, mit der gemäß cc. 1008, 207 § 1, 265 CIC von Rechts wegen die Aufnahme in den Klerus sowie die Inkardination in einen geistlichen Heimatverband verbunden sind. Daher schreibt Art. 8 Abs. 2 PAO vor, die Personalakten von Klerikern künftig in zwei Hauptteile zu gliedern, von denen der erste die Zeit bis zur Diakonenweihe eines Weihebewerbers, der zweite die Zeit ab der Diakonenweihe betrifft. Sodann bestimmt Art. 8 Abs. 3 PAO: „Die sachliche Gliederung erfolgt innerhalb dieser beiden Abschnitte, wobei die einzelnen Dokumente chronologisch abzulegen sind.“ Im Weiteren findet sich in Art. 9 PAO ein acht Buchstaben umfassender Katalog personalaktenpflichtiger Dokumente, beginnend mit der Bewerbung als Alumnus des Priesterseminars bzw. für das Ständige Diakonat und endend mit der Urkunde zur Diakonenweihe. Ebenso bietet Art. 10 Abs. 2 PAO einen zwölf Punkte umfassenden Katalog weiterer personalaktenpflichtiger Schriftstücke, beginnend mit den Urkunden über die Inkardination bis hin zu den letztwilligen Verfügungen des Klerikers.
Dabei ergibt sich mit Art. 9 lit. f) und g) PAO eine gewisse inhaltliche Doppelung, insofern es beide Male um die für die Zulassung zur Diakonenweihe erforderlichen Dokumente geht. Dies betrifft a.a.O. sowie in Art. 10 Abs. 2 lit. b) und c) PAO namentlich den auch in c. 1051 Nr. 1 CIC sub voce „Zeugnis“ thematisierten Abschlussbericht des Regens. In den Katalogen nicht eigens erwähnt, aber zumindest als Annex sachlich zugehörig sind Dokumente betreffend die Übernahme der Zölibatsverpflichtung (vgl. c. 1037 CIC) sowie zu eventuellen weiherechtlichen Dispensen.
Die besagten beiden Kataloge sind nicht abschließend, wie durch das Signalwort „insbesondere“ in Art. 9 bzw. Art. 10 Abs. 2 PAO deutlich gemacht wird. Dies ermöglicht es der personalaktenführenden Stelle (vgl. dazu Art. 4 Abs. 2 PAO), auch sonstiges, nicht dem Verdikt des Art. 7 Abs. 3 PAO unterfallendes Schriftgut aufzunehmen, sofern dies „den allgemeinen Standards und Regeln der Schriftgutverwaltung“ (Art. 5 Abs. 1 PAO; dazu ferner, leider veraltet DIN ISO 15489) entspricht und insbesondere „für die Begründung, Durchführung, Beendigung oder Abwicklung des Dienstverhältnisses oder zur Durchführung organisatorischer, personeller oder sozialer Maßnahmen, insbesondere zum Zwecke der Personalplanung und des Personaleinsatzes erforderlich ist“ (Art. 5 Abs. 3 PAO).
Vor diesem Hintergrund ist also leicht vorstellbar, dass noch weitere Dokumente zur Personalakte eines Klerikers zu nehmen sind. Nach Durchsicht des Katalogs aus Art. 10 Abs. 2 PAO ließe sich beispielsweise denken an Urkunden bzw. deren Abschriften und Korrespondenz anlässlich
- der dauerhaften Verleihung der Firmbefugnis (vgl. c. 884 § 1 CIC);
- der Ausstellung von Zelebreten (vgl. c. 903 CIC);
- der Verleihung einer Beichtbefugnis (vgl. cc. 967 § 2, 969 § 2, 973, 970 CIC; ferner c. 971 CIC) wie auch anlässlich einer Verwehrung der Ausübung der Beichtbefugnis (vgl. c. 967 § 2) oder eines Widerrufs derselben (vgl. c. 974 §§ 2–3 CIC); und
- von Einschränkungen oder Entzug der Predigtbefugnis eines Klerikers (vgl. c. 764 CIC).
Es mag dahinstehen, ob die Macher der neuen Ordnung auf die eben genannten Verwaltungsvorgänge vielleicht deshalb nicht näher eingegangen sind, weil gerade die Beichtbefugnis (auch kumulativ) auf unterschiedlichen Rechtstiteln (von Amts wegen; kraft Verleihung) beruhen kann und dabei der verleihende Ordinarius nicht zwingend der personalaktenführende Inkardinationsordinarius ist – also, kurz gesagt, die Personalakte auch bei gewissenhafter eigener Führung ein unvollständiges Bild von der tatsächlichen Beichtbefugnis des einzelnen Priesters vermitteln könnte. Davon abgesehen könnte man bei großzügiger Auslegung – auch wenn der Gesetzgeber meiner Vermutung nach nicht an die eben thematisierten Dokumente gedacht hat – diese unter Art. 10 Abs. 2 lit. i) PAO subsumieren („Schriftwechsel zwischen Kleriker und Bistumsleitung [Diözesanbischof, Ordinariat], soweit sie mit dem Dienstverhältnis des Klerikers in einem inneren Zusammenhang stehen“).
Auch unabhängig von der Frage, ob nach alldem Art. 10 Abs. 2 lit. i) PAO zur Sammelstelle für anderswo sachlich nicht zuordenbare Unterlagen werden soll, schweigt sich – soweit ersichtlich – die neue Personalaktenordnung zu der Frage aus, ob erstens die einzelnen Buchstaben der Kataloge in Art. 9 bzw. Art. 10 Abs. 2 PAO die „sachliche Gliederung“ im Sinne des Art. 8 Abs. 1 u. 3 PAO definieren; und zweitens diese – wie gesehen: nicht abschließende – Gliederung dann ggf. um weitere sachliche Gesichtspunkte erweitert werden kann. Diese Frage ist nicht zuletzt deshalb von Belang, weil zuvor hinsichtlich der Grundsätze der Aktenführung in Art. 5 Abs. 6 S. 1 PAO bestimmt wurde: „Der Akteninhalt ist innerhalb der in den Art. 8 bis 10 festgelegten Struktur fortlaufend und fälschungssicher zu paginieren.“
Anscheinend ist dies dahingehend zu verstehen, dass die Dokumente, die jeweils in einen bestimmten der (mindestens bis zu) 20 Unterabschnitte künftiger Personalakten einsortiert werden, dort jeweils beginnend mit Blatt 1 zu paginieren sind. Sodass es in künftigen Personalakten das Blatt 1 der Akte öfters geben wird, nämlich so viele Male wie neue sachliche Gliederungspunkte zu beginnen sind. Weswegen es überdies erwägenswert erscheint, im Sinne der Fälschungssicherheit noch unbefüllte Abschnitte der Personalakte durch ein leeres Blatt mit dem Vermerk „vacat“ zu kennzeichnen.
Die neue Personalaktenordnung trägt auch deshalb den Charakter eines modernen, an weltlichen Mustern orientierten Verwaltungsgesetzes, weil es in Art. 3 PAO einen sieben Buchstaben umfassenden Katalog mit Definitionen der vom Gesetzgeber verwendeten Begriffe bietet. Dabei ist dem Würzburger Diözesangesetzgeber in Art. 3 lit. a) PAO bei der Adaption der Bonner Vorgaben insofern ein kleiner redaktioneller Fehler unterlaufen, als Würzburg implizit als Erzdiözese bezeichnet wird. Der Metropolit – das ist der Erzbischof des Erzbistums Bamberg (gegründet am 1. November 1007, Erhebung zum Erzbistum im Jahre 1818) – möge mit Milde über diese Anmaßung aus dem rund 265 Jahre älteren Suffraganbistum Würzburg (gegründet 741/742) hinwegsehen.
* * *
Scherzfrage: Besteht der „Katalog“ aus sechs oder sieben Buchstaben?
* * *
Das Team des Lehrstuhls für Kirchenrecht wünscht allen Leserinnen und Lesern dieses Beitrags ein erfolgreiches, gesundes und gesegnetes neues Jahr 2022!
„Leges ecclesiasticae universales promulgantur per editionem in Actorum Apostolicae Sedis commentario officiali, nisi in casibus particularibus alius promulgandi modus fuerit praescriptus,
et vim suam exserunt tantum expletis tribus mensibus a die qui Actorum numero appositus est,
nisi ex natura rei illico ligent aut in ipsa lege brevior aut longior vacatio
specialiter et expresse fuerit statuta.“
„Allgemeine kirchliche Gesetze werden durch Veröffentlichung im offiziellen Publikationsorgan Acta Apostolicae Sedis promulgiert, wenn nicht in einzelnen Fällen eine andere Promulgationsweise vorgeschrieben ist; sie erlangen ihre Rechtskraft erst nach Ablauf von drei Monaten, von dem Tag an gerechnet, der auf der betreffenden Nummer der Acta Apostolicae Sedis angegeben ist, wenn sie nicht aus der Natur der Sache sogleich verpflichten oder im Gesetz selbst eine kürzere oder längere Gesetzesschwebe besonders und ausdrücklich festgesetzt ist.“
von Martin Rehak
Am 8. Dezember 2021 tritt das neue Buch VI (cc. 1311–1399) des CIC/1983, d.h. die Reform des kirchlichen Strafrechts, in Kraft. Rechtsgrundlage hierfür ist die Apostolische Konstitution Pascite gregem Dei vom 23. Mai 2021 [dt. Übersetzung], die am 1. Juni 2021 der Öffentlichkeit vorgestellt worden ist, und mit welcher der erneuerte Text des sechsten Buchs des Kodex des kanonischen Rechts promulgiert wurde (Normtext lat.; Normtext dt.).
Dabei ist unter Promulgation die autoritative Bekanntmachung eines Gesetzes zu verstehen (vgl. dazu auch c. 7 CIC). Dieser formale Aspekt der Gesetzgebung ist beispielsweise bereits von dem aus vier Elementen (Vernünftigkeit, Gemeinwohlförderung, zuständige Autorität, Promulgation) bestehenden Gesetzesbegriff des Thomas von Aquin bekannt (vgl. STh I/II, q. 90 art. 4 conclusio: „Et sic ex quatuor praedictis potest colligi definitio legis, quae nihil est aliud quam quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata“).
Die besagte Apostolische Konstitution Pascite gregem Dei vom 23. Mai 2021 als „Einführungsgesetz“ zum neuen kirchlichen Strafgesetzbuch bedurfte dabei ihrerseits einer Promulgation, welche zwischenzeitlich durch Abdruck im L’Osservatore Romano erfolgt ist. Aus dem sattsam bekannten Grund – notorisch verspätetes Erscheinen mit einem Rückstand von mittlerweile über zwei Jahren, so dass bei strikter Beachtung des c. 8 CIC das Datum der Promulgation sowie das Datum des Inkrafttretens von Gesetzen oft erst im Nachhinein bestimmbar wären – hat die in c. 8 CIC als Promulgationsakt vorgesehene Veröffentlichung in den Acta Apostolicae Sedis lediglich dokumentarische Funktion. (Aus diesem Grund war es auch wichtig, dass sich die besagte Apostolische Konstitution explizit zur Frage des Datums des Inkrafttretens des neuen Strafrechts geäußert hat.)
C. 8 CIC befasst sich nun aber nicht nur mit Quisquilien der Promulgation von Gesetzen, sondern auch und vor allem mit der Frage, wann ein promulgiertes Gesetz in Kraft tritt. Als Regelfall bestimmt unsere Norm, dass ein neues Gesetz erst nach Ablauf von drei Monaten nach dem Datum seiner Promulgation in den Acta Apostolicae Sedis rechtskräftig wird. Als Promulgationsdatum gilt dabei dasjenige Datum, welches als Ausgabetag des fraglichen Faszikels angegeben ist. Nach zutreffender Auslegung bedeutet dies, dass die Frist – entgegen dem in c. 203 § 1 CIC beschriebenen Normalfall eines Fristanlaufs am darauffolgenden Tag – bereits an dem angegebenen Tag anläuft, d.h. in Sinne von c. 203 § 1 CIC der Beginn des fraglichen Tages und der Beginn der Frist zusammenfallen. Sodann sind die besagten drei Monate kalendarisch zu bestimmen, wie in c. 203 § 2 CIC beschrieben. Insoweit besteht allerdings die Besonderheit, dass der die Frist auslösende Tag mitgezählt wird. Dementsprechend endet die Dreimonatsfrist des c. 8 CIC nicht an dem Tag, der seiner Zahl nach dem Promulgationsdatum entspricht, sondern mit Ablauf des Vortags. Der Tag, der seiner Zahl nach dem Promulgationsdatum entspricht ist mit anderen Worten der Tag des Inkrafttretens des neuen Gesetzes. (Ein Beispiel mag dies verdeutlichen: Das Motu Proprio Omnium in mentem vom 26.10.2009 wurde veröffentlicht in AAS 102 [2010] 8–10, näherhin im ersten Heft des Jahrgangs, das unter dem Datum des 08.01.2010 erschienen ist. Die dreimonatige Gesetzschwebe begann somit an diesem Tag und endete am 07.04.2010. In Kraft getreten sind die dortigen Regelungen folglich am 08.04.2010.)
Der Zeitraum zwischen Promulgation und Inkrafttreten wird in der Fachsprache als vacatio legis oder Gesetzesschwebe bezeichnet. Dazu lässt sich feststellen, dass der Begriff der vacatio rechtssprachlich eine gewisse inhaltliche Breite aufweist. Denn der Terminus kann neben der Gesetzesschwebe (vgl. cc. 8, 31 § 2 CIC) auch das Freiwerden eines Kirchenamts bzw. eine Sedisvakanz (vgl. cc. 153 § 2, 158 § 1, 165, 272, 421 § 1, 481 § 1, 541 § 2 CIC) bezeichnen. Außerdem wurde er im Kodex von 1917 als Synonym zu Ferien verwendet (vgl. cc. 34 § 2 Nr. 2, 354 CIC/1917).
Zweck der Gesetzesschwebe ist es, den Normunterworfenen ebenso wie den Rechtsanwendern ausreichend Zeit zu geben, um sich auf die neue Rechtslage einzustellen und mit ihr vertraut zu machen. Der Vergleich von c. 8 § 1 CIC (drei Monate vacatio für gesamtkirchliche Gesetze) mit c. 8 § 2 (ein Monat vacatio für partikulare, nur in Teilkirchen bzw. Verbänden von Teilkirchen geltende Gesetze) weist zudem darauf hin, dass nach Ansicht des Gesetzgebers für die tatsächliche Kenntnisnahme in der Weltkirche ein etwas längerer Zeitraum realistisch erscheint.
Eine dreimonatige Gesetzesschwebe ist allerdings nur der Regelfall, zu dem bereits in der Norm des c. 8 § 1 CIC selbst Ausnahmen vorgesehen sind.
Eine erste Ausnahme betrifft jene Fälle, in denen ein Gesetz „aus der Natur der Sache“ mit sofortiger Wirkung verpflichtet. Hierbei ist insbesondere an solche Gesetze gedacht, die lediglich in Fragen der Glaubens- und der Sittenlehre das seit jeher geltende ius divinum (Naturrecht, Offenbarungsrecht) nochmals authentisch feststellen und verpositivieren.
Eine zweite Ausnahme betrifft jene Fälle, in denen der Gesetzgeber im neuen Gesetz selbst eine abweichende Regelung zum Zeitraum der Gesetzesschwebe bzw. zum genauen Datum des Inkrafttretens trifft. Die einzelfallbezogen abgeänderte vacatio kann dabei kürzer oder auch länger als die besagten drei Monate dauern.
Wiederholt ist in jüngerer Zeit ein Sonder- und Extremfall der verkürzten Gesetzesschwebe begegnet, insofern ein sofortiges Inkrafttreten neuer Gesetze angeordnet wurde, ohne dass dies bereits aus der Natur der Sache selbst geboten gewesen wäre. Hingewiesen sei insoweit auf
- Motu Proprio Fidelis dispensator vom 24.02.2014 über die Errichtung einer neuen Koordinierungsstelle für die wirtschaftlichen und administrativen Angelegenheiten des Heiligen Stuhls und des Staates der Vatikanstadt;
- Motu Proprio Confermando una tradizione vom 08.07.2014 über Überführung der Ordentlichen Abteilung der Administratur des Patrimomiums des Apostolischen Stuhls (APSA) an den Wirtschaftsrat;
- Motu Proprio I beni temporali vom 04.07.2016 über Zuständigkeiten in wirtschaftlichen Angelegenheiten;
- Motu Proprio Maiorem hac dilectionem vom 11.07.2017 über Lebenshingabe als Thema der Selig- und Heiligsprechungen;
- Motu Proprio Summa familiae cura vom 08.09.2017 zur Errichtung des Theologischen Instituts Johannes Paul II. für die Wissenschaften von Ehe und Familie;
- Motu Proprio Imparare a congedarsi vom 12.02.2018 betreffend den Amtsverzicht vom Papst ernannter Amtsträger;
- Apostolische Konstitution Episcopalis communio vom 15.09.2018 über die Bischofssynode;
- Motu Proprio Fin dalla sua antica vom 17.01.2019 über den Päpstlichen Chor der Sixtinischen Kapelle;
- Motu Proprio L’esperienza storica vom 22.10.2019 zur Umbenennung des Vatikanischen Geheimarchivs in Vatikanisches Apostolisches Archiv;
- Rescriptum ex Audientia SS.mi nebst Instruktion vom 06.12.2019 betreffend die Aufhebung des Päpstlichen Geheimnisses bei der Verfolgung bestimmter Straftaten;
- Motu Proprio Una migliore organizzazione vom 26.12.2020 über bestimmte Zuständigkeiten in wirtschaftlichen und finanziellen Angelegenheiten des Apostolischen Stuhls;
- Motu Proprio Spiritus Domini vom 10.01.2021 zur Änderung des c. 230 § 1 CIC (vgl. dazu auch hier);
- Motu Proprio Un futuro sostenibile vom 23.03.2021 betreffend die Personalausgaben des Apostolischen Stuhls sowie des Governatorats der Vatikanstadt;
- Motu Proprio La fedeltà vom 26.04.2021 mit Vorkehrungen zur Transparenz in der Verwaltung öffentlicher Finanzen
- Motu Proprio Antiquum ministerium vom 10.05.2021 zur Einführung des Dienstes des Katecheten; sowie
- Motu Proprio Traditionis custodes vom 16.07.2021 über den Gebrauch der Römischen Liturgie in der Gestalt vor der Reform von 1970 (vgl. dazu auch hier).
Eine solche Praxis ist zwar mit dem Sinn und Zweck einer Gesetzesschwebe nicht zu vereinbaren und daher aus kanonistischer Warte kritisch zu sehen. Der Gesetzgeber wollte damit aber – kirchenpolitisch durchaus nachvollziehbar – anscheinend die herausgehobene Bedeutung und besondere Dringlichkeit der jeweiligen Maßnahme oder Rechtsänderung unterstreichen.
Im Fall der reformierten Normen des Buches VI des CIC/1983, die schon lange mit Spannung erwartet worden waren, hat der Gesetzgeber – anders als in den aufgezählten Fällen – einen besonders langen Zeitraum der Gesetzesschwebe vorgesehen. Damit sollte offenbar dem Umfang der Normänderungen, mit denen erstmals nicht nur einzelne Normen, sondern ein komplettes Buch der sieben Bücher des Kodex eine Revision erfahren hat, ebenso Rechnung getragen werden wie der Bedeutung dieses sensiblen Bereichs der kirchlichen Rechtspflege. Den Kanonist*innen in Wissenschaft und Praxis stand somit hinreichend Zeit zur Verfügung, sich dem Studium der neuen Normen zu widmen und erste Erschließungen des neuen kirchlichen Strafgesetzesbuchs vorzunehmen. Wie eine erste Bestandsaufnahme zeigt, hat die Kanonistik diese ihr durch die vacatio legis gebotene Möglichkeit und Aufgabe auch tatsächlich angenommen (siehe die beigefügte Publikationsumschau). Weitere Analysen werden im Laufe der Zeit folgen. Eigens hingewiesen sei ferner auf die bisherigen (und künftigen) Beiträge zum neuen Strafrecht in dieser Reihe, in denen Anna Krähe sich bereits die Frage gestellt hat, wer als Täter und was als Tathandlung im Sinne des neuen c. 1389 CIC in Betracht kommt (siehe hier); und ob insgesamt bzw. in welchen Strafnormen im Einzelnen das neue Recht milder und für den Täter günstiger im Sinne von c. 1313 CIC als das alte Recht ist (siehe hier).
Seit der Vorstellung des Normtextes am 1. Juni 2021 werden genau sechs Monate und sechs Tage verstrichen sein, wenn am 8. Dezember 2021, 0 Uhr, das neue Strafrecht in Kraft tritt. (Für die Katholiken westlich der entlang des 180. Längengrads verlaufenden Datumsgrenze rund elf Stunden früher als hierzulande in der Mitteleuropäischen Zeitzone [Greenwich Mean Time plus 1].) Dann wird sich das neue Strafrecht auch in der Praxis beweisen müssen und dort durch die usuelle Auslegung der Rechtsanwender noch eingehender analysiert werden.
Die „Flitterwochen“ der Gesetzesschwebe sind dann vorbei.
㤠1. Si post delictum commissum lex mutetur, applicanda est lex reo favorabilior.
§ 2. Quod si lex posterior tollat legem vel saltem poenam, haec statim cessat.“
„§ 1. Wird nach Begehen einer Straftat ein Gesetz geändert, so ist das für den Täter günstigere Gesetz anzuwenden.
§ 2. Setzt ein später erlassenes Gesetz ein Gesetz oder wenigstens eine Strafe außer Kraft, so entfällt diese sofort.“
von Anna Krähe
Mit der Apostolischen Konstitution „Pascite gregem Dei“ vom 23. Mai 2021 hat Papst Franziskus nach über zehnjähriger Überarbeitungszeit die lang erwarteten neuen Normen des kirchlichen Sanktionsrechts im Buch VI des CIC/1983 promulgiert (Text der neuen Kanones [dt.]). Sie treten am 8. Dezember 2021 in Kraft. Die Zeit der „alten“ Sanktionsgesetze des sechsten Buches im CIC/1983 neigt sich demnach dem Ende entgegen und zunehmend drängender stellt sich die Frage, was denn kurz nach Beginn des neuen Kirchenjahres 2021 so gelten wird im kirchlichen Strafrecht.
Der c. 1313 hat, als einer der wenigen Kanones dieser bisher umfassendsten Gesetzesänderung des CIC/1983, keine Neuerung erfahren und zugleich hat er doch eine Schlüsselstellung im Rahmen dieser Reform inne, denn er formuliert zwei Grundregeln der Sanktionsanwendung bei Gesetzesänderung, die auch in den kommenden Monaten und vielleicht auch Jahren Berücksichtigung werden finden müssen.
Seine Wurzel reicht bis in das Buch I des Kodex zurück, der in seinen allgemeinen Normen, genauer c. 9, für alle neu zu erlassenden Gesetze den schon im römischen Recht herrschenden Grundsatz des Rückwirkungsverbots betont. Durch Gesetzesänderungen, -streichungen und -erweiterungen will der Gesetzgeber das zukünftige Leben innerhalb der Rechtsgemeinschaft gestalten. Damit reagiert er zwar zumeist auf Geschehnisse der Vergangenheit, diese Änderung darf aber nicht zum Nachteil für denjenigen oder diejenige werden, der oder die bei der Handlung nur von den geltenden gesetzlichen Voraussetzungen ausgehen konnte. Zur Wahrung der Gerechtigkeit und aus Gründen der Rechtssicherheit wird daher deutlich gemacht, dass für die rechtliche Bewertung eines (abgeschlossenen) Vorgangs nur gilt, was zum Zeitpunkt der Handlung auch Rechtskraft besaß.
Von dieser Grundregel in c. 9 macht c. 1313, wie schon cann. 2226 §§ 2,3 iVm can. 2216 § 1 CIC/1917, eine doppelte Ausnahme. Der § 1 hat die Situation im Blick, dass eine Person – „reus“ meint auch nur den Beschuldigten bzw. Angeklagten – eine Straftat begeht und es nach Abschluss der Tathandlung, aber bevor die Strafe verhängt worden ist, zu einer Gesetzesänderung kommt, die für den Straftäter und das Delikt relevant ist. In diesem Fall ist es für die Beurteilung der Strafbarkeit nicht ausschlaggebend, was rechtlich zum Tatzeitpunkt galt, sondern es findet das mildere der in Frage kommenden Gesetze Anwendung.
Ist nicht nur die Tathandlung zur Zeit der alten Rechtslage vorgenommen, sondern ist auch die Sanktion bereits vor der Gesetzesänderung verhängt worden – egal, ob auf dem Weg des Eintritts der Tatstrafe, deren Feststellung, durch Strafdekret oder Urteil im Strafprozess –, liegt der zweite Ausnahmefall von c. 9 in c. 1313 § 2 vor. Hintergrund dieser Regelung ist das Ansinnen insbesondere auch des kirchlichen Gesetzgebers, dass Sanktionen immer nur das allerletzte Mittel sein sollen, um Gefahren, Schäden und Verletzungen für die ganze Gemeinschaft und alle ihre Glieder abzuwenden oder zumindest weitere negative Auswirkungen zu verhindern. Wenn der Gesetzgeber Normen streicht oder mildert, verdeutlicht er, dass er das zuvor sanktionierte Verhalten für nicht mehr so schädlich oder die konkrete Strafe für nicht mehr angemessen hält. Der ursprüngliche Grund der Bestrafung bzw. das vorgesehene Strafmaß fallen weg. Dies hat sich dann auch zugunsten von bereits Verurteilten auszuwirken. Wird eine Deliktsnorm gestrichen, endet demnach die Bestrafung; wird lediglich das vorgesehene Strafmaß verringert, mildert sich entsprechend auch für bereits mit einer Strafe Belegte ihr Strafmaß. Wenn die genannten Sanktionsmittel nicht logisch oder automatisch stufenweise angepasst werden können, entsteht aus c. 1313 § 2 für Bestrafte zumindest ein Anspruch auf erneute Strafzumessung.
Was ist nun aber das „mildere“ Gesetz? Es ist dasjenige, welches eine Regelung vorsieht, die der beschuldigten Person mehr zugutekommt und die günstigeren Folgen für sie hat als die andere. Diese Tendenz zur „Besserstellung“ des einzelnen Rechtssubjekts durchzieht die ganze kirchliche Rechtsordnung und ist gerade in den Allgemeinen Normen neben c. 9 auch c. 18 zu entnehmen, der gerade für Sanktionsnormen, die enge und damit auch die mildere Interpretation fordert. Das heißt aber nicht, dass es überhaupt nicht zu einer Bestrafung kommt und ebenso wenig ist entscheidend, ob die betreffende Person die Bestrafung subjektiv als milder empfindet. In Anschlag zu bringen ist, welches Zusammenspiel der für den Fall relevanten Normen jeweils nach objektiven Maßstäben die günstigere Beurteilung herbeiführt. Für die Bewertung der „Milde“ einer Bestrafung spielen dabei zum Beispiel die gesetzlich festgelegten Tatbestandsvoraussetzungen, Beweislastregelungen, das vorgesehene Strafmaß, Fragen der Zurechenbarkeit oder auch Verjährungsregeln eine Rolle.
Welches sind denn nun aber mit Blick auf die am 8. Dezember 2021 in Kraft tretenden Normen eigentlich die „milderen“ Gesetze? Und welche Auswirkungen werden die Vorgaben des c. 1313 auf diejenigen haben, die bereits kirchlich bestraft sind (§ 2) oder Delikte des kirchlichen Sanktionsrecht begangen haben, dafür aber noch keine Strafe verhängt wurde (§ 1)?
Weitet man den Blick über den CIC/1983 hinaus wird schnell klar, dass sich gar nicht so viel ändert wie im ersten Moment vermutet, denn schon in den letzten 20 Jahren wurden die universalkirchlichen Sanktionsnormen kontinuierlich erweitert – allerdings nicht im Codex, sondern mittels außerkodikarischer Gesetze. Johannes Paul II. erweiterte 2001 das kirchliche Strafrecht durch das Motu proprio, „Sacramentorum sanctitatis tutela“ (= SST; dt.) bezüglich der schwerwiegenden Straftaten. Diese „Normae de gravioribus delictis“ (= Normae/2010; dt.) wurden allerdings erst 2010 durch Papst Benedikt XVI. in veränderter Form approbiert und veröffentlicht. Mit dem Ap. Schreiben „Vos estis lux mundi“ (dt.) veröffentlichte Papst Franziskus am 7. Mai 2019 ein weiteres außerkodikarisches Gesetz, welches die materiellen Bestimmungen bei Straftaten im Bereich des sexuellen Missbrauchs in der Kirche präzisiert und zugleich die Zuständigkeiten sowie das Vorgehen in diesen Fällen näher regelt. Viele dieser Normen haben mit der nun bevorstehenden Gesetzesänderung Eingang in den CIC/1983 gefunden, womit sich aber die bereits bestehende Rechtslage nicht grundsätzlich ändert.
Zusätzlich hat der Gesetzgeber aber dennoch, insbesondere im ersten Teil des sechsten Buches, einige grundlegende Änderungen vorgenommen, weswegen es sich lohnt den oben gestellten Fragen im Folgenden überblickshaft nachzugehen. Es ist im Rahmen dieser Darstellung nicht möglich, auf alle Kanones und ihre Inhalte ausführlich einzugehen. Um der Darstellung im Einzelnen besser folgen zu können, empfiehlt es sich zum einen selbst einen Blick in die geltenden Normen des sechsten Buches CIC/1983 (vgl. lat. und dt.) [Bezeichnung mit „aF“ = alte Fassung] sowie die durch ApK „Pascite gregem Dei“ geänderten Kanones (vgl. lat. und dt.) [Bezeichnung mit „nF“ = neue Fassung] zuwerfen. Zum anderen kann eine Synopse der Kanones im Buch VI CIC/1983 aF, des ersten Gesetzesentwurfs zum kirchlichen Sanktionsrecht von 2011 (Schema/2011) und der neuen Gesetze im Buch VI CIC/1983 nF dabei helfen, die Änderungen besser nachzuvollziehen.
Für Viele mag die wichtigste Frage dieser Gesetzesänderung (oder auch schon generell) sein, womit man sich in der Kirche eigentlich strafbar machen kann und welche – ggf. strengeren – Sanktionen für dieses strafbare Verhalten denn – vor allem zukünftig – vorgesehen sind. Das alles ist im zweiten Teil des Buches VI geregelt. Dieser „Besondere Teil“ des kirchlichen Sanktionsrechts, also der Abschnitt, in welchem – nach neuer Betitelung deutlicher hervorgehoben – die einzelnen Delikte und die für sie zu verhängenden Strafen dargestellt werden, hat einerseits in systematischer Hinsicht eine umfassende Überarbeitung erfahren, denn sowohl die einzelnen Titel selbst wurden teils verändert als auch die Ordnung der Kanones entsprechend umgestellt. Aber durch ApK „Pascite gregem Dei“ sind auch zahlreiche neue Delikte hinzugekommen und die Strafzumessungsvorschriften wurden verschärft:
- Neue Straftaten: cc. 1371 § 4 nF (Verletzung des päpstlichen Geheimnisses); 1371 § 5 nF (Verletzung der Pflicht zur Ausführung eines rechtskräftigen Urteils oder Strafdekrets); 1371 § 6 nF (Verletzung der Pflicht zur Weitergabe einer Strafanzeige); 1376 nF (verschiedene Delikte im Zusammenhang mit dem unrechtmäßigen Umgang mit Kirchengütern); 1377 § 2 nF (Korruption im Amt); 1379 § 3 nF (vgl. Art. 5 Normae/2010; Versuch der Frauenweihe); 1379 § 4 nF (Sakramentenspendung denjenigen, denen der Empfang verboten ist); 1382 § 2 nF (Konsekration in sakrilegischer Absicht); 1386 § 3 nF (vgl. Art. 4 § 2 Normae/2010; Mitschneiden oder Verbreitung von Inhalten aus der Beichte); 1388 § 2 nF (Weihe trotz absichtlich verschwiegener Beugestrafe oder Irregularität); 1392 nF (rechtswidrige Aufgabe des Klerikerdienstes über 6 Monate); 1393 § 2 nF (Straftaten im wirtschaftlichen Bereich durch Kleriker und Ordensleute); 1398 nF (vgl. teilweise Art. 6 Normae/2010; Straftaten im Bereich der Verstöße gegen das 6. Gebot des Dekalogs und der Pornographie an Minderjährigen und Personen, die in ihrem Vernunftgebrauch habituell eingeschränkt sind).
- Erweiterung der Straftatbestände: c. 1370 § 3 nF ergänzt im potentiellen Kreis der Betroffenen „alium christifidelem“, bei der Ausübung physischer Gewalt aufgrund der Missachtung des Glaubens, der Kirche usw. [Einfügung fehlt in dt. Übersetzung]; c. 1395 § 3 nF fügt dem Tatbestand zum einen das Merkmal „durch Missbrauch seiner Autorität“ und zum anderen den Zwang zur Vornahme oder zum Ertragen sexueller Handlungen über Verfehlungen gegen das 6. Gebot des Dekalogs hinaus hinzu.
- Erweiterung / Präzisierung des Strafmaßes: cc. 1380 nF; 1383 nF; 1389 nF; c. 1397 § 3 nF (für Kleriker nun auch Entlassung aus dem Klerikerstand).
- Umwandlung in obligatorische Bestrafung (zuvor fakultativ; größtenteils Ersetzung von „puniri potest“ durch „puniatur“): cc. 1371 § 1 nF; 1372 nF; 1378 § 1 nF (zumindest insofern, als eine Bestrafung nicht mehr deswegen unterbleiben kann, weil bereits eine Strafe festgesetzt ist); 1389 nF; 1390 §§ 2,3 nF (in § 3 neu: Verpflichtung zu angemessenen Wiedergutmachung zusätzlich zur Bestrafung); 1391 nF; 1394 § 1 nF.
Keine ganz eindeutige Bewertung zur Frage nach Milderung oder Verschärfung des Gesetzes ergibt sich für folgende Fälle:
- Milderung eines Straftatbestands (?): Der einzige Straftatbestand der möglicherweise aufgrund der Neu-Betitelung „Straftaten gegen die Sakramente“ einen eingeschränkteren Anwendungsbereich erfahren hat, ist c. 1384 aF = c. 1389 nF (vgl. zur näheren Auslegung KdM 39).
- Verdeutlichung des Strafmaßes: Insbesondere die unbestimmte Strafandrohung „iusta poena“, die letztlich wohl schon in Buch VI CIC/1983 aF, mit den verschiedenen Sühnestrafen aus c. 1336 aF zu konkretisieren war, wird in einer ganzen Reihe von Kanones nun durch die Nennung von „c. 1336 §§ 2-4“ nF ersetzt: cc. 1365 nF, 1371 §§ 1,2 nF; 1377 § 1; 1378 § 2 nF; 1383 nF; 1390 § 2 nF; 1391 nF; 1393 § 1 nF [hier Erweiterung der Bestrafung je nach Schwere des Verbrechens um Bestrafung mittels Sühnestrafen]. Dass es sich beim Verweis auf den Reigen der Sühnestrafen um eine Konkretisierung der „gerechten Strafe“ handelt, deutet c. 1377 § 1 nF wohl an, wenn er festlegt, die zu bestrafende Person „soll nach den can. 1336 §§ 2-4 mit einer gerechten Strafe belegt werden“.
- Wie genau die Strafzumessungsregelung in c. 1385 nF zu verstehen ist, bleibt etwas unklar. Die dortige Aufzählung entspricht zwar wohl dem, was die Nennung der Suspension und des c. 1336 §§ 2-4 auch ausgesagt hätten, der Gesetzgeber hat dies aber, anders als in anderen Kanones, wohl nicht in dieser Art umschreiben wollen.
Die cc. 1364-1399 nF sind für die Frage nach der Bewertung von Einzelfällen aufgrund des c. 1313 allerdings nicht allein ausschlaggebend. Denn Bestrafung aufgrund eines kirchlichen Delikts und insbesondere die konkrete Strafzumessung fußen auf den allgemeinen Regelungen zu Straftaten und Strafen im ersten Teil des Buches VI CIC/1983. Während der Besondere Teil letztlich ein recht einheitliches Bild der grundsätzlichen Verschärfung des kirchlichen Sanktionsrechts zeichnet, fällt der Befund für den Allgemeinen Teil etwas differenzierter aus.
Klare Verschärfungen in der Gesetzgebung zeigen sich in folgenden Fällen:
- Nach c. 1325 aF wurde es bei der Strafzumessung nicht entsprechend mildernd berücksichtigt, wenn Trunkenheit, andere Geistestrübungen oder Leidenschaft beim Dritten absichtlich zur Begehung der Straftat oder um sich nachträglich auf entsprechende Strafausschließungs- und Strafmilderungsgründe berufen zu können, herbeigeführt worden waren. Bestraft werden musste demnach so, als hätte keiner der genannten Umstände vorgelegen. Diese Regelung wird zwar grundsätzlich in den neuen Gesetzestext übernommen, dort führt dieses Verhalten aber nicht nur nicht zur Strafmilderung, sondern ist nach c. 1326 § 1 n. 4 nF ein Grund, die Strafe zu verschärfen. Außerdem wird die Strafverschärfung dahingehend konkretisiert, dass bei Vorliegen eines entsprechenden Grundes eine im Normalfall fakultative Bestrafung verpflichtend wird (vgl. c. 1326 § 3 nF), was nach c. 1343 nF auch den Ermessensspielraum des Rechtsanwenders in diesem Fall aufhebt. Kurz: Liegen Strafverschärfungsgründe nach c. 1326 nF vor, wird die Strafzumessung zukünftig wohl noch strenger sein.
- Bei der Suspension gemäß c. 1333 nF ist der Adressatenkreis nun auf alle Gläubigen erweitert worden, indem die einschränkende Formel „quae clericos tantum afficere potest“ gestrichen wurde. Auch wenn natürlich die Rechtsfolgen in ihrer Gesamtheit weiterhin nur Kleriker treffen kann (Verbot zur Setzung von Akten der Weihevollmacht) wird diese Änderung, gerade mit Rücksicht auf c. 1313, wahrscheinlich die umfassendste Wirkung entfalten, denn Laien, die sich vor Inkrafttreten des Buches VI CIC/1983 nF strafbar gemacht haben, wird die Suspension in keinem Fall treffen können.
- Mit c. 1335 § 1 nF wird allgemein die Möglichkeit eröffnet, Zensuren (Beugestrafen), die als Spruchstrafen verhängt werden, unter bestimmten Umständen Sühnestrafen hinzuzufügen. Dies scheint wohl eine generelle Erweiterung des Strafrahmens im Fall von Beugestrafen zu sein – über die Möglichkeiten, die jeweils die entsprechende Deliktsnorm als Strafmaß vorgibt hinaus. Dies bedeutet auch, dass zwar bei Aufhabe der sog. contumacia, der Widerspenstigkeit, die Delikte mit Beugestrafen prägen, zwar die Zensur wegfällt, die möglichen zusätzlichen Sühnestrafen aber Bestand haben.
- Auch c. 1345 nF macht, ähnlich wie wohl auch von c. 1335 nF angezielt, deutlich, dass die Besserung des Straftäters allein nicht mehr ausreicht, um milder zu sanktionieren.
- In c. 1350 § 2 nF wird zwar weiterhin sichergestellt, dass der Ordinarius denjenigen aus dem Klerikerstand Entlassenen, die in Not geraten sind, soweit möglich helfen soll, aber klargestellt wird auch, dass dies nicht durch die Übertragung von Ämtern, Diensten und Aufgaben geschehen darf.
- Eine deutliche Verschärfung im Rahmen der Gesetzesänderung haben auch die Verjährungsregeln in c. 1362 nF (vgl. teilweise Art. 7 Normae/2010) erhalten, demnach auch für deutlich mehr Fälle die verlängerte Verjährungsfrist von sieben Jahren gilt (§ 1 n. 2 nF) und §§ 2,3 teils einen späteren Beginn des Fristenlaufs bzw. die Möglichkeit zur Aussetzung der Verjährungsfrist regeln.
Des Weiteren finden sich im neuen Gesetzestext von 2021 einige Formulierungen, die sich im Vergleich mit der alten Fassung durchaus strenger lesen, die aber wohl bei genauerer Betrachtung nicht zu einer strengeren Auslegung führen:
- In c. 1314 nF wird nach wie vor der Eintritt der Sanktion als Tatstrafe (also mit Begehung und in der Regel Vollendung der Tat selbst tritt auch die Strafe ein) oder Spruchstrafe (Verhängung durch Strafurteil oder Strafdekret) festgehalten. Es wird nun sprachlich deutlicher gemacht, was schon im Kanon alter Fassung gewollt war, dass nämlich die Spruchstrafe den Regelfall darstellt und darüber hinaus Tatstrafen nur bei ausdrücklicher Androhung durch Gesetz oder Strafgebot eintreten können. Die angedrohten Tatstrafen im Buch VI CIC/1983 nF haben sich aber nicht verringert.
- In c. 1315 § 2 nF sind die Möglichkeiten der Partikulargesetzgeber zur Aufstellung von Strafnormen bzw. zur Hinzufügung und Veränderung von Strafandrohungen zu bestehenden Gesetzen etwas übersichtlicher gestaltet. Statt der Begründung in c. 1315 § 3 aF, dass die Hinzufügung „nur aus einem sehr schwerwiegenden Grund“ erfolgen darf, wird in c. 1315 § 2 nF mit Verweis auf c. 1317 nF die Erforderlichkeit zur Sicherstellung der kirchlichen Disziplin gefordert. Dies kann klarstellend verstanden werden, dass Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit bei der partikularen Strafgesetzgebung noch deutlicher zu beachten sind.
- Die Rechtsfolgen der Exkommunikation nach c. 1331 § 1 nF machen, durch die Untergliederung in nun sechs Nummern und die sprachliche Präzisierung, nun deutlicher, dass die Exkommunikation Ausübungs- und Betätigungsverbote in jedem Bereich des Handelns innerhalb der kirchlichen Gemeinschaft umfasst. Ob die Einbeziehung des Ausübungsverbots von „functiones“ (§ 1 n. 5) die Verbotswirkung der Exkommunikation tatsächlich erweitert, wird noch zu diskutieren sein; es erscheint aber möglich.
- Die vielleicht (oder bestenfalls – je nach Blickwinkel –) empfindlichste Verschärfung enthält c. 1341 nF, dessen Subtext nicht mehr die möglichst umfassende Zurückhaltung bei der Beschreitung des Gerichts- oder Verwaltungswegs zur Straffeststellung oder -verhängung beinhaltet, sondern der deutlich macht, dass diese Wege zu beschreiten sind, wenn nur so „Gerechtigkeit wiederhergestellt, der Täter gebessert und das Ärgernis behoben werden kann.“ Der Gesetzgeber bleibt dem Ansatz der alten Fassung – Strafe als ultima ration – treu und auch die Grundvoraussetzung für Strafanwendung bleiben gleich. Insofern ist fraglich, ob hier tatsächlich eine Verschärfung des Gesetzes vorliegt. Entgegen dem unmissverständlichen Anliegen des Gesetzgebers von 1983 die Strafanwendung auf ein Minimum zu beschränken und pastoralen Mitteln einen Vorrang einzuräumen, macht der Gesetzgeber im Jahr 2021 mit c. 1341 nF jedoch deutlicher, dass die Durchführung von Strafverfahren auch notwendig anzuwendendes Mittel sein kann und muss, was wohlmöglich zur Folge haben wird, dass zukünftig auch Fälle bestraft werden, die bisher nicht mittels des kirchlichen Sanktionsrechts zu lösen versucht wurden.
- Die Möglichkeit, kirchliche Sanktionen neben dem gerichtlichen Strafprozess auch auf dem Verwaltungsweg zu verhängen, wird in c. 1342 § 1 nF beibehalten und auch nicht deutlicher als Ausnahmefall gegenüber dem Gerichtsweg gekennzeichnet. Hervorgehoben werden aber das Rechtsschutzinteresse und das Verteidigungsrecht des bzw. der Beschuldigten, die auch im Verwaltungsverfahren zu schützen sind.
- Der Ermessensspielraum im Fall der Strafhäufung wird zur Ausnahme gegenüber der nach c. 1346 § 1 nF nun auch explizit genannten Regel, dass für gewöhnlich so viele Strafen verhängt werden wie Straftaten begangen wurde.
- Mit c. 1349 nF wird für die Verhängung unbestimmter Strafen (zumeist durch „iusta poena“ bezeichnet), hinzugefügt, dass diese dem Ärgernis und entstandenen Schaden angemessen sein sollen, was wohl ebenso, wenn auch ungeschrieben, auch bisher galt.
Schließlich muss für einige Normänderungen in der neuen Fassung des sechsten Buches gesagt werden, dass eine strengere oder mildere Wirkung nur im konkreten Einzelfall genau zu bestimmen ist:
- Das Interdikt wird nach c. 1332 § 2 nF flexibler, was die konkreten Rechtsfolgen betrifft, da einerseits auch „nur noch“ einzelne Verbote der c. 1331 § 1 nn. 1-4 nF eintreten können, was im Einzelfall zu milderen Bestrafungen führen kann. Andererseits können der zu bestrafenden Person nach neuer Regelung aber auch – alternativ – andere bestimmte Rechte entzogen werden können, was wohl zumindest teils als strengere Bestrafung ausgelegt werden kann.
- Bei den Sühnestrafen hat sich der Gesetzgeber in c. 1336 nF für eine massive Ausdifferenzierung der bisher fünf vorgesehenen Rechtsfolgen entschieden. Die jeweils in den Kategorien „Gebote“, „Verbote“ und „Rechtsentzüge“ aufgelisteten möglichen Einzelstrafen sowie die bereits bekannte Entlassung aus dem Klerikerstand können alle auf Dauer, für bestimmte oder unbestimmte Zeit verhängt werden und enthalten bspw. mit der Möglichkeit von Geldstrafen (§ 2 n. 2 nF), dem Verbot zur Stimmenrechtsausübung bei kanonischen Wahlen (§ 3 n. 6 nF) oder mit der Erweiterung von Ausübungsverboten bzw. dem Entzug von Zuständigkeiten (§ 3 n. 3 bzw. § 4 n. 1 nF) deutlich mehr Mittel auch Laien zu bestrafen. Wie diese Erweiterung der Sanktionsmöglichkeiten sich im Einzelfall auswirkt, kann kaum pauschal gesagt werden. Einerseits wird es mit Blick Laien – ähnlich wie bei der Suspension – eher als Verschärfung zu sehen sein; andererseits gibt die neue Regelung des c. 1336 nF sehr viel mehr Möglichkeiten im Einzelfall angemessener zu entscheiden, sodass gerade bei Klerikern, die vielfältigen Möglichkeiten der Bestrafung eher als die mildere Variante zu sehen sind.
„Es war nötig, [die Strafgesetzgebung] auf eine Weise zu verändern, die es den Hirten erlaubt, sie als flexibleres therapeutisches und korrigierendes Instrument zu benutzen, das zeitgerecht und mit pastoraler Liebe eingesetzt werden kann, um größerem Übel zuvorzukommen und die durch menschliche Schwäche geschlagenen Wunden zu heilen“, so beschreibt Papst Franziskus das Anliegen der Strafrechtsreform in ApK „Pascite gregem Dei“ (Abs. 3). Der hier skizzierte Überblick zeigt, dass dies vor allem zu teils deutlich strengeren Regelungen und einer Erweiterung der von der Kirche sanktionierten strafbaren Handlungen geführt hat. Ob es der Kirche auf diesem Weg tatsächlich gelingt, die kirchliche Strafe in ihrer „Funktion der Wiedergutmachung“, als „heilsam[e] Medizin“ sowie „auf das Wohl des Gläubigen gerichtet“ und so als „positives Mittel zur Verwirklichung des Reiches Gottes“ (ebd., Abs. 9) einzusetzen, wird sich ab dem 8. Dezember 2021 zeigen.
„Si sacerdotibus in solidum cura pastoralis alicuius paroeciae aut diversarum simul paraoeciarum committantur, singuli eorum, iuxta ordinationem ab iisdem statutam, obligatione tenentur munera et functiones parochi persolvendi, de quibus in cann. 528, 529 et 530; facultas matrimoniis assistendi, sicuti et potestates omnes dispensandi ipso iure parocho concessae, omnibus competent, exercendae tamen sunt sub directione moderatoris.“
„Wenn Priestern solidarisch die Hirtensorge einer Pfarrei oder verschiedener Pfarreien zugleich anvertraut wird, ist jeder einzelne von ihnen gehalten, die in den cann. 528, 529 und 530 genannten Aufgaben und Amtshandlungen des Pfarrers gemäß der von ihnen selbst festgelegten Ordnung wahrzunehmen; alle besitzen die Befugnis zur Eheassistenz sowie sämtliche dem Pfarrer von Rechts wegen zukommenden Dispensvollmachten, die aber nur gemäß der Weisung des Moderators ausgeübt werden dürfen.“
von Martin Rehak
Am 01.10.2021 ist für das Bistum Würzburg die Neuordnung der Seelsorge und Hirtensorge im Pastoralen Raum vom 28.07.2021, veröffentlicht im Abl WÜ 167 (2021) 178–184 (Ausgabe Nr. 8 vom 18.08.2021), in Kraft getreten. Damit gewinnt das Programm „Gemeinsam Kirche sein – Pastoral der Zukunft“, welches im Jahr 2025 abgeschlossen sein soll und einer Neustrukturierung des Bistums Würzburg in „Pastorale Räume“ dient, an rechtlicher Kontur. Dieses Programm startete im Jahr 2017 mit einer Erprobungsphase, in der unterschiedliche pastorale Modelle an verschiedenen Orten des Bistums ausprobiert und evaluiert wurden. Nachdem im Oktober 2020 ein Diözesanforum das Konzept der Pastoralen Räume (anstelle von Großpfarreien) befürwortet hatte, wurden Ende des vorigen Jahres die künftigen insgesamt 40 Pastoralen Räume unter Benennung der zugehörigen Pfarreiengemeinschaften und/oder der Einzelpfarreien, Filialen sowie Kuratien geographisch umschrieben (vgl. dazu hier und Abl WÜ 166 (2020) 291–317 (Ausgabe Nr. 12 vom 18.12.2020).
Der Neuordnung der Seelsorge und Hirtensorge im Pastoralen Raum ist eine Präambel mit pastoraltheologischen Überlegungen vorangestellt. Der normative Teil umfasst 13 Paragraphen, welche in drei Abschnitte (Pastoraler Raum, §§ 1–4; Leitung, §§ 5–12; Inkrafttreten, § 13) gruppiert sind.
Im ersten Abschnitt werden dabei die für das künftige Würzburger Pastoralkonzept relevanten Ebenen zur Strukturierung und Untergliederung des Bistums vorgestellt. Dazu wird in § 1 erläutert, dass der Pastorale Raum „aus den – i.d.R. in Pfarreiengemeinschaften als Untergliederungen – verbundenen Pfarreien [besteht]“ und damit einen Zusammenschluss benachbarter Pfarreien im Sinne des c. 374 § 2 CIC darstellt. Wie sich sodann aus § 2 und § 4 ergibt, gibt es als weitere Strukturebenen der Diözese noch andere Zusammenschlüsse im Sinne des c. 374 § 2 CIC, nämlich zum einen die Pfarreiengemeinschaften (bzw. sonstige neue Zusammenschlüsse benachbarter Pfarreien) und die Dekanate, in denen Pfarreien aus mehreren Pastoralen Räumen zusammengefasst sind. Die untere Ebene des Pastoralen Raums bilden gemäß § 3 die Pfarreien und Kuratien.
Dazu wird in § 2 Abs. 2 erläutert, dass Pfarreiengemeinschaften dazu dienen, „ortsnahe Angebote zu schaffen, die die einzelnen Pfarreien nicht alleine gewährleisten können“. Sodann heißt es: „Konkrete personelle Zuständigkeiten für Pfarreiengemeinschaften bzw. Untergliederungen legen Moderator und Pastoralteam fest, wo die Leitung des Pastoralen Raums nach c. 517 § 1 CIC ‚in solidum‘ etabliert ist.“
Das Leitungskonzept für die Pastoralen Räume wird sodann in den §§ 5–12 der Neuordnung näher entfaltet. Das in § 5 ausführlich erläuterte Leitungsverständnis kann in etwa dahingehend zusammengefasst werden, dass den Pfarrern die Letztverantwortung für die Hirtensorge in ihrer Fülle zukommt, während an der Verwirklichung und Ausführung der Hirtensorge potenziell die gesamte Herde – Priester, Diakone, Haupt- und Ehrenamtliche – zu beteiligen ist. „Eigenverantwortung und Subsidiarität sind dabei unerlässlich“, denn alle Gläubigen sind je nach ihrer Stellung und Aufgabe zur Auferbauung des Leibes Christi berufen. Es verbietet sich von daher, gemäß einem uralten Kalauer „Team“ als Akronym für „Toll, ein anderer macht’s“ zu deuten.
In § 6 a) wird zunächst deutlich, dass einerseits seitens der Bistumsleitung eine solidarische Leitung der im Pastoralen Raum zusammengeschlossenen Pfarreien durch ein Priesterteam gemäß c. 517 § 1 CIC gewünscht wird. Andererseits garantiert § 6 b) jenen Pfarrern, die sich (derzeit) nicht auf das solidarische Leitungsmodell einigen können, jedenfalls für eine Übergangsphase den derzeitigen Status quo, gemäß welchem sie Einzelpfarrer ihrer Pfarrei bzw. Pfarreiengemeinschaft bleiben.
Im kanonischen Recht des CIC begegnet das Konzept eines solidarischen Handelns an mehreren Stellen. Außer in dem soeben erwähnten c. 517 § 1 CIC findet sich die Wendung „in solidum“ noch in c. 543 § 1 CIC und in vier weiteren Kanones:
- In c. 140 § 1 CIC wird das Konzept solidarischen Handelns für den spezifischen Kontext der Delegation legaldefiniert und dabei gegen das in c. 140 § 2 CIC beschriebene Gegenkonzept einer kollegialen Delegation abgegrenzt. Eine solidarische Delegation besagt, dass jeder der solidarisch Delegierten sich alleine der delegierten Aufgabe widmen kann – und, sobald er mit der Ausführung begonnen hat, die Aufgabe dann auch im Normalfall alleine, unter Ausschluss der übrigen Delegierten, zu Ende führen darf. Im Gegensatz hierzu wäre es bei einer kollegialen Delegation erforderlich, dass alle Delegierten sich gemeinsam der ihnen gestellten Aufgabe widmen und sich dabei hinsichtlich der Art und Weise der Ausführung nach Maßgabe des c. 119 CIC einigen.
- Gemäß c. 1121 § 2 CIC sind im Falle einer Noteheschließung (vgl. c. 1116 CIC) die laikalen Trauzeugen sowie die Brautleute solidarisch dazu verpflichtet, den Ortspfarrer oder Ortsordinarius über die Eheschließung zu informieren. Die Pflicht ist – nach allem, was uns bereits c. 140 § 1 CIC gelehrt hat – also mit Wirkung für die anderen drei erfüllt, wenn eine der vier Personen der besagten Meldepflicht nachgekommen ist. Es müssen hingegen nicht alle vier gemeinsam beim Pfarrer bzw. Ordinarius vorstellig werden.
- Falls in einem Rechtsstreit vor einem kirchlichen Gericht beide Parteien prozessabwesend sein sollten, haben laut c. 1595 § 2 CIC beide solidarisch die Kosten des Prozesses zu tragen. In dieser Norm kommen die wirtschaftlichen Implikationen einer solidarischen Haftung sehr deutlich in den Blick. Denn die Gerichtskasse wird sich in einem solchen Fall klugerweise an die Partei halten, die solventer ist bzw. von der die Gerichtskosten einfacher und schneller beizutreiben sind. Dass es im Innenverhältnis der beiden Parteien gerecht wäre, wenn sie die Gerichtskosten hälftig tragen, ist bei der gegebenen Solidarschuld nicht das Problem des Gerichts (sondern der zur Begleichung der Prozesskosten im Außenverhältnis herangezogenen Partei).
An dieser Stelle sei angemerkt, dass das kanonische Recht mit dem „in solidum“-Konzept eindeutig in der Tradition des antiken römischen Rechts steht. Denn bereits das römische Recht kannte für die Fälle einer Mehrheit von Gläubigern oder Schuldnern die Rechtsfiguren der aktiven und passiven Gesamt- oder Solidarobligation. Bei einer Gesamtforderung mehrerer Gläubiger kann jeder einzelne Gläubiger die ganze Leistung (und nicht nur eine anteilige Leistung) an sich selbst fordern, wobei der Schuldner aber nur einmal leisten muss. Bei einer Gesamtschuld kann der Gläubiger von allen Schuldnern die ganze Leistung fordern, wobei aber alle Schuldner von der Schuld befreit werden, wenn einer (oder mehrere) die Leistung bewirkt haben (vgl. zu alldem etwa Kaser / Knütel, Römisches Privatrecht, München 192008, 298; Honsell, Römisches Recht, Heidelberg u.a. 72010, 112 f.).
- Zu den prozessrechtlichen Konsequenzen aus einer solidarischen Schuld äußert sich schließlich c. 1637 § 2 CIC. Wenn in einem Rechtsstreit, bei der sich eine Mehrheit von Klägern oder Beklagten um eine unteilbare Sache bzw. eine solidarische Verpflichtung streiten, wirkt ein von einem Einzelnen eingelegtes Rechtsmittel für und gegen alle Streitgenossen.
Doch zurück zu unserer Neuordnung der Seelsorge und Hirtensorge im Pastoralen Raum und den dortigen Regelungen zur Leitung. Im Fall einer solidarischen Anvertrauung der Hirtensorge gemäß c. 517 § 1 CIC an ein Team von Priestern ist – völlig konform mit der genannten kodikarischen Norm – ebenfalls in § 6 a) Abs. 1 vorgesehen, dass einer im Priesterteam die Rolle des Moderators übernimmt. Über die weiteren Priester im Team wird gesagt, dass diese – jedenfalls in der Ordnung, vielleicht aber auch im Leben – als Teampfarrer bezeichnet werden.
Dazu wird in § 7 erläutert, dass die Teampfarrer die Hirtensorge gemäß unserem c. 543 § 1 CIC ausüben. Es gilt also gewissermaßen der von Alexandre Dumas populär gemachte Slogan: „Einer für alle, alle für einen“. Jeder Teampfarrer ist grundsätzlich dazu angehalten, den gesamten Pflichtenkreis eines Pfarrers wahrzunehmen, ungeachtet der Spezialisierung, die im Team vereinbart ist. Wenn also beispielsweise ein Teampfarrer schwerpunktmäßig für Kasualien und ein anderer für Katechese und Erwachsenenbildung zuständig sein soll, so ist doch letzterer befugt, beispielsweise auch Taufen zu spenden und Eheschließungen zu assistieren – auch wenn er damit vielleicht gegen die interne Ordnung des Teams und die Dirigentschaft des Moderators verstößt.
Die Aufgabe des Moderators nämlich ist, in engem Anschluss an die Aufgabenbeschreibung in c. 517 § 1 CIC, gemäß § 8 in erster Linie darin zu sehen, dass er die Zusammenarbeit des Pastoralteams leitet, deren Aktivitäten gegenüber dem Bischof verantwortet, und die Pfarreien des Pastoralen Raums – vorbehaltlich Sonderregelungen hinsichtlich der Vertretung von Kirchen- bzw. Pfründestiftungen – nach außen rechtlich vertritt. Außerdem ist er regelmäßig der Dienstvorgesetzte „der Diakone, Pastoral- und Gemeindereferentinnen/-referenten, Mitarbeiter/-innen aus sozialen Berufen, Verwaltungsmitarbeiter/-innen sowie der Angestellten der Pfarrkirchenstiftungen im Pastoralen Raum“. Er nimmt repräsentative Aufgaben wahr und pflegt „den Kontakt zu kommunalen, lokalen und ökumenischen Partner/-innen.“ Darüber hinaus ist er auch der Dienstvorgesetzte jener Priester, die im Pastoralen Raum tätig werden, ohne zum Team der Teampfarrer zu gehören; damit ist wohl an jene Priester gedacht, die zwar für den Pastoralen Raum angewiesen wurden, aber nicht im Sinne von c. 521 i.V.m. c. 542 Nr. 1 CIC für die Übernahme des Amts eines Pfarrers qualifiziert sind.
Der Moderator wird nach einer Wahl im Pastoralteam dem Bischof präsentiert und von ihm für sechs Jahre ernannt. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass eine Mehrheit im Pastoralteam mit der Person des Moderators einverstanden ist.
Über die Zusammensetzung des Pastoralteams klärt im Weiteren § 10 der Neuordnung auf: „Das Pastoralteam besteht aus den im Pastoralen Raum tätigen Priestern, Diakonen, Pastoral- und Gemeindereferentinnen/-referenten und gegebenenfalls Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern aus sozialen Berufen.“
Gemäß § 12 der Neuordnung wird dem Moderator eine pastorale Mitarbeiterin oder ein pastoraler Mitarbeiter als Koordinator/-in an die Seite gestellt. Unter Berücksichtigung des Votums des Rates im Pastoralen Raum – vgl. dazu näherhin Satzung der Räte in den Pastoralen Räumen im Bistum Würzburg, in: Abl WÜ 167 (2021) 142–147 (Nr. 6 vom 21.06.2021) – hat das Pastoralteam für dieses Amt ein Vorschlagsrecht; die Beauftragung für sechs Jahre erfolgt dann durch den Moderator. Der/die Koordinator/-in hat die Aufgabe, die Sitzungen der in § 11 beschriebenen Koordinationsgruppe sowie die Sitzungen des gesamten Pastoralteams vor- und nachzubereiten und in den Sitzungen selbst „für eine verlässliche und transparente Struktur […] (Moderation, Ergebnissicherung, verbindliche Entscheidungsfindung)“ zu sorgen. Zudem verfolgt er oder sie „die konsequente Umsetzung der diözesanen Vorgaben“.
Nicht nur, aber auch wegen dieses leicht militärischen Zungenschlags erinnert damit das Leitungskonzept der Neuordnung der Seelsorge und Hirtensorge im Pastoralen Raum mit den Rollen des Moderators und der Koordinatorin bzw. des Koordinators ein Stück weit an jene in den Streitkräften im angloamerikanischen Raum geläufige Struktur der Befehlskette, in welcher der CO (Commading Officer) die Befehle erteilt und der XO (Executive Officer) ihre Ausführung anleitet und überwacht.
Hinsichtlich der Zusammensetzung der bereits erwähnten Koordinationsgruppe erläutert § 11, dass diese neben dem Moderator und dem/der Koordinator/-in aus zwei bis vier weiteren aus der Mitte des Pastoralteams gewählten Mitgliedern besteht und in den der Rat des Pastoralen Raums eine/n Vertreter/-in entsendet. Der Koordinationsgruppe kommt dabei in etwa eine zukunftsorientierte Entwicklung der Pastoralziele des Pastoralen Raums sowie ein gegenwartsorientiertes Qualitätsmanagement der aktuellen Pastoral zu.
Jeder Theologe (und damit auch jeder Kirchenrechtler) – so heißt es in der Schrift (vgl. Mt 13,52) – der „ein Jünger des Himmelreiches geworden ist, gleicht einem Hausvater, der aus seinem reichen Vorrat Neues und Altes hervorholt“. Vielleicht lässt sich auch die Neuordnung der Seelsorge und Hirtensorge im Pastoralen Raum in diesem Sinne deuten: Alt ist das Konzept des solidarischen Handelns und der gesamtschuldnerischen Haftung, wie sie kodikarisch und jetzt auch partikularrechtlich in Gestalt der Priesterteams aus Moderator und Teampfarrern begegnet. Neu ist die Ergänzung einer derartigen Pfarreileitung durch die Rechtsfigur des/der Koordinator/-s/-in sowie durch eine Koordinationsgruppe nebst Einbindung des gesamten Pastoralteams durch Wahl- und Vorschlagsrechte. Dabei ist die Neuordnung nicht nur neu, sondern auch modern, wie ein Seitenblick auf den Entwurf des Handlungstextes „Leitung von Pfarreien, Gemeinden und pastoralen Räumen“ zeigt, der ebenfalls am 01.10.2021 von der Zweiten Synodalversammlung des Synodalen Weges in erster Lesung behandelt wurde.
In diesem Text wird nämlich zunächst an das Lehramt Papst Franziskus‘ erinnert, der in seinem Nachsynodalen Schreiben Querida Amazonia vom 02.02.2020 ausgeführt hatte, dass „Frauen […] Zugang zu Aufgaben und auch kirchlichen Diensten haben [sollten], die nicht die heiligen Weihen erfordern“ (QA 103), so dass sie „einen echten und effektiven Einfluss in der Organisation, bei den wichtigsten Entscheidungen und bei der Leitung von Gemeinschaften haben“ (ebd.). Auf dieser Basis ermutigt der Handlungstext des Synodalen Weges dazu, bei pfarrlichen Leitungskonzepten rechtliche Spielräume zu nutzen und empfiehlt dazu an erster Stelle die „Ernennung pastoraler Koordinator*innen oder Mitarbeiter*innen, die den Pfarrer in pastoralen und administrativen Leitungsaufgaben in Pfarreien, Pfarreiengemeinschaften oder neu zusammengelegten Pfarreien unterstützen und dabei mit dem Pastoralteam und den gewählten Gremien […] eng zusammenarbeiten“.
So gesehen hat sich das Bistum Würzburg anscheinend mit seiner Neuordnung zukunftsfähig aufgestellt. Offen bleibt nur die Frage, wie es nach Ablauf der Übergangszeit von drei Jahren mit jenen Pastoralen Räumen weitergeht, in denen die Pfarrer bis dahin keinen Gefallen an einer solidarischen Hirtensorge gefunden haben. Wird es dann zu einer Vereinheitlichung der jetzt noch pluralen Leitungsmodelle kommen? In jedem Fall ist allen, die sich künftig kooperativ der Seel- und Hirtensorge im Pastoralen Raum widmen, zu wünschen, dass durch gegenseitige Wertschätzung in Wort, Tat und Haltung jene Eintracht entsteht, die sich mit Augustinus, Confessiones 4,8,13 so auf den Punkt bringen lässt: „E pluribus unum“.
㤠1. Sit in curia dioecesana archivum quoque secretum, aut saltem in communi archivo armarium seu scrinium, omnino clausum et obseratum, quod de loco amoveri nequeat, in quo scilicet documenta secreto servanda cautissime custodiantur.
§ 2. Singulis annis destruantur documenta causarum criminalium in materia morum, quarum rei vita cesserunt aut quae a decennio sententia condemnatoria absolutae sunt, retento facti brevi summario cum textu sententiae definitivae.“
„§ 1. In der Diözesankurie muss es außerdem ein Geheimarchiv geben, wenigstens aber einen eigenen Schrank oder ein eigenes Fach im allgemeinen Archiv, das fest verschlossen und so gesichert ist, dass man es nicht vom Ort entfernen kann; in ihm müssen die geheim zu haltenden Dokumente mit größter Sorgfalt aufbewahrt werden.
§ 2. Jährlich sind die Akten der Strafsachen in Sittlichkeitsverfahren, deren Angeklagte verstorben sind oder die seit einem Jahrzehnt durch Verurteilung abgeschlossen sind, zu vernichten; ein kurzer Tatbestandsbericht mit dem Wortlaut des Endurteils ist aufzubewahren.“
von Jessica Scheiper
Auf diözesaner Ebene sieht der Gesetzgeber der Funktion nach drei Archive vor: das Verwaltungsarchiv (gemeint ist damit die laufende Registratur; c. 486 § 2), das historische Archiv (c. 491 § 2) und das Geheimarchiv (c. 489 § 1). Im Verwaltungsarchiv befinden sich die aktuellen Bestände, die die geistlichen und zeitlichen Angelegenheiten der Diözese betreffen. Im historischen Archiv werden geschichtlich bedeutsame Akten aufbewahrt. Bestückt wird es regelmäßig mit Schriftgut, das von internen wie von externen Stellen bzw. privaten Personen dorthin abgegeben wird. Das bischöfliche Geheimarchiv (archivum secretum), um das es in c. 489 geht, enthält schließlich „jeweils einen Sonderbestand des Verwaltungsarchivs oder des historischen Archivs“ (Stephan Haering, Zur rechtlichen Ordnung des kirchlichen Archivwesens, in: AfkKR 171 [2002] 442–457, hier 447).
C. 489 normiert in § 1, dass es an jeder Diözesankurie ein Geheimarchiv geben muss. Die konkrete Beschaffenheit bleibt dabei dem verantwortlichen Diözesanbischof überlassen. Es kann schon ein eigener Schrank bzw. ein Fach als Geheimarchiv genügen, sofern es nur fest verschlossen und gegen Diebstahl gesichert ist. Diese Vorgabe knüpft an can. 379 § 1 CIC/1917 an, wonach auch im alten Recht schon im allgemeinen Archiv (das heutige Verwaltungsarchiv) ein Schrank oder ein Fach als Geheimarchiv genügen konnte. Während die Dokumente, die sich auf das Bistum oder die Pfarreien beziehen, mit größter Sorgfalt („maxima cura“) zu verwahren sind (c. 486 § 1), wird in c. 489 § 1 ein Umgang cautissime gefordert. In der approbierten deutschen Übersetzung des CIC wird „cautissime“ zwar auch mit „größter Sorgfalt“ übersetzt, üblicherweise ist das lateinische „cautus“ aber mit vorsichtig oder sicher bzw. gesichert zu übersetzen. Zudem verwendet der Gesetzgeber hier einen Superlativ, womit er die besondere Sicherungspflicht hervorhebt. Die Aufbewahrung mit dem Attribut „cautissime“ zielt deshalb vielmehr auf die höchste Vorsichts- oder Sicherheitsstufe im Umgang mit den dortigen Dokumenten im Sinne einer Zugangsbeschränkung ab.
Verpflichtend vorgesehen ist das Geheimarchiv in jeder Diözese, damit an einem Ort gesammelt alle Schriftstücke delikater Angelegenheiten sicher aufbewahrt werden, die schon ihrer Natur nach geheim sind oder zum Schutz der Kirche und ihres Auftrags besondere Diskretion erfordern. Vorgaben zu den einzelnen Schriftstücken, die der Geheimarchivierungspflicht unterliegen, befinden sich im CIC an verschiedenen Stellen: Neben den Akten von Strafsachen in Sittlichkeitsverfahren (c. 489 § 2) bzw. kirchenrechtlichen Voruntersuchungsakten (c. 1719) unterliegt das Buch über geheime Eheschließungen und die außerhalb der Beichte erteilten Dispensen von einem geheimen Ehehindernis (cc. 1082 u. 1133) der Geheimarchivierungspflicht. Auch solche Dokumente, durch die eine Verwarnung oder ein Verweis beurkundet wird (c. 1339 § 3), sind im Geheimarchiv aufzubewahren.
Geheim zu verwahren sind außerdem die Liste der Vertreter des Bischofs im Falle seiner Amtsbehinderung (c. 413 § 1) und die Urteilsvoten der Richter eines Kollegialgerichts (c. 1609 § 2). Ob damit eine Aufbewahrung im Geheimarchiv gemeint ist, ist nicht eindeutig, erscheint aber zumindest nur wenig sinnvoll. So hat z.B. der Kanzler der Kurie die Liste der Bischofsvertreter zwar geheim aufzubewahren, hätte aber womöglich ohne den verantwortlichen Diözesanbischof gar keinen Zugriff auf das Geheimarchiv. Außerdem kann diskutiert werden – auch vor dem Hintergrund möglicher Vor- und Nachteile –, weiteres Schriftgut im Geheimarchiv zu deponieren, wenn der Diözesanbischof befindet, es sei von dem in c. 489 § 1 genannten Kriterium „documenta secreto servanda“ erfasst (vgl. Peter Platen, Stephan Haering, Handreichung zum Geheimarchiv der Kurie [vom 1. März 2013], in: Sekretariat der DBK [Hg.], Päpstliche Kommission für die Kulturgüter der Kirche: Die pastorale Funktion der kirchlichen Archive [= Arbeitshilfen 142], Bonn 2016, 128–134, hier 129 f.) Zumindest kann der Bischof Schriftstücke, die nicht ausdrücklich im Geheimarchiv aufbewahrt werden müssen, bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt wieder aus dem Geheimarchiv entfernen und anderweitig unterbringen. Die Verkleinerung der Aktenmenge bedeutet für ihn dann eine Entlastung „von der Aufgabe der Verwaltung des Geheimarchivs. Es dürfte sich daher anbieten, dass sich der Diözesanbischof hierzu mit seinem Generalvikar und dem Leiter des Diözesanarchivs berät, welche Form der gesicherten Aufbewahrung für die Vorgänge in Frage kommt, die nach seinem persönlichen Urteil nicht länger im Geheimarchiv aufbewahrt werden müssen. Hierbei geht es um eine Schnittstelle zwischen dem Geheimarchiv der Kurie und dem historischen Archiv“ (ebd., 131). Hinsichtlich dieser Dokumente sei es zudem als zweckdienlich zu betrachten, wenn der Diözesanbischof schon frühzeitig verfüge, ob und ggf. wann oder zumindest „bei welcher Gelegenheit (z. B. Tod des Betreffenden) dieses Material aus dem Geheimarchiv entfernt und dem historischen Archiv angeboten werden kann“ (ebd., 132).
Neben der Aufbewahrungspflicht sieht der Gesetzgeber auch eine Pflicht zur Vernichtung von Aktenbeständen vor. Gemäß c. 489 § 2 unterliegen dieser Kassationspflicht die Akten von Strafverfahren in Sittlichkeitsdelikten. Näherhin sind Voruntersuchungs- bzw. Prozessakten von Strafsachen in Sittlichkeitsverfahren bei der jährlichen Durchsicht zu kassieren, wenn die Beschuldigten bereits verstorben sind oder ihre Verurteilung ein Jahrzehnt zurückliegt. Nach geltendem Recht ist in diesen Fällen ein „kurzer Tatbestandsbericht mit dem Wortlaut des Endurteils […] aufzubewahren“ (c. 489 § 2). Diese Regelung ist nicht gänzlich neu, aber auch nicht identisch mit früherem Recht: Bereits can. 379 § 1 CIC/1917 kannte die Kassationspflicht. Der Gesetzgeber wollte damals allerdings das Offenbarungsrisiko möglichst minimieren: Dort hieß es explizit, die entsprechenden Dokumente seien zehn Jahre nach Verurteilung bzw. nach dem Tod des Angeklagten zu verbrennen. Der kurze Tatbestandsbericht und der Wortlaut des Endurteils waren auch nur dann anzufertigen und aufzubewahren, wenn der Angeklagte noch lebte, die Verurteilung also zu Lebzeiten mehr als zehn Jahre zurücklag. Ob nach dem Tod des Angeklagten die Unterlagen vernichtet werden mussten oder vernichtet werden konnten, ist uneindeutig; zumindest mussten sie nicht zwingend aufbewahrt werden (vgl. PCI, Responsum vom 05.08.1941, in: AAS 33 [1941] 378). Verstarb der Angeklagte binnen zehn Jahren seit seiner Verurteilung, bestand keine Pflicht, einen Tatbestandsbericht mit ergangenem Urteil anzufertigen.
Nicht erfasst von den Kassationen sind die übrigen Dokumente im bischöflichen Geheimarchiv. Wenn diese Akten also weder vernichtet noch dem historischen Archiv übergeben werden, wächst das bischöfliche Geheimarchiv damit „im Laufe der Zeit zu einem historischen Archiv ‚delikater Unterlagen‘ an“ (Platen/Haering, Handreichung, 133).
Im Unterschied zum Verwaltungs- bzw. zum historischen Archiv (cc. 486 § 3 u. 491 § 1) ist der Diözesanbischof nicht eindeutig verpflichtet, über die im Geheimarchiv lagernden Dokumente ein Verzeichnis anzulegen. Während im CIC/1917 mit can. 379 § 2 noch die Pflicht bestand, von den Inhalten des Geheimarchivs ein Inventarverzeichnis wie von den übrigen diözesanen Archiven anzufertigen, findet sich eine solche Bestimmung im CIC von 1983 nicht mehr. Mit Blick auf die jährliche Sichtung der Akten böte sich eine solche um des besseren Überblickes willen gleichwohl an. Ohne ein brauchbares Verzeichnis wird auch die Kontinuität im Wissensbestand gefährdet, erst recht, wenn es zu einem plötzlichen Wechsel im Amt des Diözesanbischofs kommt.
Die Bestimmungen des c. 489 werden schließlich durch c. 490 ergänzt, der die Nutzung des Archivs regelt und damit zugleich Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der geheim aufzubewahrenden Dokumente trifft. In den übrigen beiden diözesanen Archiven wird die Aufbewahrung und systematisierte Ordnung der Dokumente dem Kanzler der Kurie (c. 482 § 1) bzw. einem ausgebildeten Archivar anvertraut, wohingegen gemäß c. 490 nur der Bischof über einen Schlüssel zum Geheimarchiv verfügen darf. So kann – theoretisch – niemand ohne seine Zustimmung und Kenntnis die geheimen Akten einsehen, geschweige denn entfernen oder gar vernichten. Aus der Praxis ist allerdings bekannt, dass der Zugang zum Geheimarchiv oftmals nicht so strikt gehandhabt wird, wie es der CIC vorsieht. Berichte belegen den unberechtigten Zugriff Dritter auf das Geheimarchiv in unterschiedlichem Umfang.
Anstatt den Personenkreis mit Zugriff auf das Geheimarchiv zu vergrößern, hat der Gesetzgeber ihn noch verkleinert. So sprach noch der CIC von 1917 von zwei Schlüsseln für das Geheimarchiv: Über einen verfügte der Diözesanbischof (bzw. der Apostolische Administrator) und der andere Schlüssel lagerte beim Generalvikar (bzw. beim Kanzler) (can. 379 § 3). Das Schloss des Geheimarchivs musste so beschaffen sein, dass es nur mit beiden Schlüsseln geöffnet werden konnte. Der zweite Schlüssel war demnach nicht einfach nur eine Kopie des ersten; es waren verschiedene Schlüssel. Verlangte der Bischof nach dem zweiten Schlüssel, der beim Generalvikar deponiert war, musste dieser ihn aushändigen, damit der Bischof allein das Archiv öffnen und die dort befindlichen Dokumente einsehen konnte (can. 379 § 4). Ein explizites Verbot, wonach nicht auch umgekehrt der Bischof seinen Schlüssel dem Generalvikar aushändigen konnte, damit dieser Akten einsehen konnte, um etwa ein Verzeichnis anzufertigen, sprach der Gesetzgeber im CIC/1917 nicht aus. Jedenfalls konnte keiner der beiden ohne Kenntnis des Anderen Zugriff auf das Archiv haben. Mit der Änderung im CIC/1983 wird dagegen unmissverständlich die alleinige Verantwortung des Bischofs betont.
Solange der Diözesanbischof im Amt ist, gibt es dem Wortlaut nach keine Ausnahme für diese strikte Begrenzung. Erst für den Fall der Sedisvakanz kennt der CIC/1983 eine Ausnahmeregelung: Dann darf gemäß c. 490 § 2 ausschließlich der Diözesanadministrator persönlich und zudem nur bei wirklicher Notwendigkeit das Geheimarchiv öffnen. Schließlich verbietet der Gesetzgeber in c. 490 § 3 ausdrücklich die Herausgabe von Dokumenten aus dem Geheimarchiv. Daraus ergibt sich auch das Verbot, Kopien oder Abschriften von den dort gelagerten Schriftstücken anzufertigen. Wenn also mancherorts separate Aktenordner mit geheimen Dokumenten außerhalb des Archivs angelegt werden, muss geprüft werden, ob der Bischof seine Geheimarchivierungspflicht verletzt hat, weil er möglicherweise entsprechende Dokumente dem Geheimarchiv nicht zugeführt oder unrechtmäßig Kopien von solchem Schriftgut angefertigt hat.
Die bestehende Geheimarchivierungspflicht hat wiederholt Diskussionen entfacht. Verstärkt werden diese Diskussionen zudem durch manchen nachlässigen Umgang mit dem Geheimarchiv. Wiederholt kam ans Licht, dass entgegen geltendem Recht mancherorts auch andere Personen als der Bischof Zugriff auf das Geheimarchiv hatten (vgl. etwa Björn Gercke u.a., Gutachten: Pflichtverletzungen von Diözesanverantwortlichen des Erzbistums Köln im Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen und Schutzbefohlenen durch Kleriker oder sonstige pastorale Mitarbeitende des Erzbistums Köln im Zeitraum von 1975 bis 2018, Köln 2021, hier 27). Auch die rechtlich vorgesehenen Säuberungsaktionen, die auch teilweise noch Dritte durchführten (vgl. dazu Stefan Heße im Interview mit Christ & Welt vom 23.09.2020), lassen vor allem im Kontext der Missbrauchsvorwürfe deutliche Kritik laut werden, weil die Vernichtung von Dokumenten eine umfassende Missbrauchsaufarbeitung erschweren kann. Kommt es beispielsweise zu erneuten Vorwürfen gegen einen Wiederholungstäter, verkompliziert es die Untersuchung, wenn frühere Unterlagen nicht mehr oder nur noch unvollständig verfügbar sind. Vorgeschlagene „Kniffe“, wie ein Informationsverlust trotz der Kassationspflicht möglichst verhindert werden kann, bieten keine Garantie, weil sie vom Willen der beteiligten Personen abhängig sind (etwa wie knapp bzw. doch ausführlicher der „kurze“ Tatbestandsbericht wirklich gehalten wird o.ä.). Gerade hinsichtlich der Missbrauchsaufarbeitung wäre es deshalb ein wichtiger Schritt und ein eindeutiges Zeichen, wenn die verantwortlichen Diözesanbischöfe oder ganze Bischofskonferenzen alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen und beim Apostolischen Stuhl die Dispens von der Geheimarchivierungspflicht erbitten würden. Wenn ein größerer Personenkreis rechtskonform auf diese Bestände zugreifen könnte, wäre so dem Vorwurf der Vertuschung begegnet und die Aufarbeitung erleichtert.
„Christifideles Sacrificium eucharisticum participare et sacram communionem suscipere possunt quolibet ritu catholico, firmo praescripto can. 844.“
„Die Gläubigen können in jedwedem katholischen Ritus am eucharistischen Opfer teilnehmen und die heilige Kommunion empfangen, unbeschadet der Vorschrift des can. 844.“
von Martin Rehak
In der theologischen Fachsprache zählt die Vokabel „Ritus“ zu jenen Begriffen, die sich durch eine besondere inhaltliche Breite und Mehrdeutigkeit auszeichnen. Der Terminus kann zunächst erstens einzelne Elemente – elementare Beispiele: Kreuzzeichen, Segnung u.v.a.m. – einer liturgischen Feier bezeichnen. Für die Verwendung von „ritus“ in dieser Bedeutung war in der Ära des CIC/1917 die Paarformel „Riten und Zeremonien“ charakteristisch, vgl. dazu etwa cann. 2, 249 § 1, 253 § 1 und 733 § 1 CIC/1917. Auch im geltenden Recht begegnet die Vokabel mit diesem Sinngehalt, vgl. cc. 918, 1119, 1167 § 2 und 1237 CIC. Sodann wird als (liturgischer) Ritus zweitens die Summe jener Einzelriten bezeichnet, die zusammen in geordneter Abfolge die typische Feiergestalt der verschiedenen Gottesdienste (z.B. Tauffeier, Altarweihe etc.) bilden. In diesem Sinne begegnet „Ritus“ im geltenden kanonischen Recht insbesondere in den cc. 206 § 2, 230 § 1, 604 § 1, 1034 § 1, 1037, 1120, 1127 § 3, 1211, 1217 § 2 und 1229 CIC. Etwas schillernd erscheint die Norm des c. 2 CIC, bei dem wohl beide bislang genannten Sinngehalte zusammenfließen. In einem nächsten Schritt dient „Ritus“ drittens der Bezeichnung der Gesamtheit aller liturgischen Riten im vorgenannten Sinn bzw. mehr noch der Gesamtheit des liturgischen Rechts (das neben der Regelung des einzelnen Gottesdienstes u.a. auch Regelungen zum liturgischen Kalender, zur liturgischen Gewandung, zu geweihten Örtlichkeiten und Zeiten, u.a.m. umfasst), vgl. dazu cc. 112 § 2, 214, 372, 383 § 2, 450 § 1, 476, 479 § 2, 518, 846 § 2, 991, 1015 § 2, 1021, 1127 § 1, 1248 § 1 CIC. Innerhalb der einen katholischen Kirche gibt es insoweit nicht nur einen einzigen Ritus, sondern – sowohl in der Gegenwart, aber mehr noch in liturgiegeschichtlicher Perspektive – eine Vielzahl unterschiedlicher Riten. Dabei wird „Ritus“ zugleich zum Synonym für eine personal verfasste Strukturebene der Kirche, die zwischen der Gesamtkirche und dem Bistum bzw. der Eparchie angesiedelt ist. Insoweit hatte das Zweite Vatikanische Konzil im Dekret Orientalium Ecclesiarum über die katholischen Ostkirchen vom 21.11.1964, dort Art. 3, von den „particulares ecclesiae seu ritus (Teilkirchen oder Riten)“ gesprochen, während der CIC/1983 in der ursprünglichen Textfassung vor dem Motu Proprio De concordia inter codices vom 31.05.2016 den Ausdruck „ecclesia ritualis sui iuris (Rituskirche eigenen Rechts)“ bzw. kurz „ecclesia ritualis (Rituskirche)“ kannte, vgl. c. 111 § 2 bzw. § 1 CIC a.F. Durch das genannte Motu Proprio wurde c. 111 CIC rechtssprachlich angeglichen, so dass sich dort nun der bereits aus can. 27 CCEO geläufige Terminus „ecclesia sui iuris (Kirche eigenen Rechts)“ findet. Diese (teil-)kirchenkonstituierende Funktion des Ritus, wie er als Gesamt der Liturgie in den einzelnen Kirchen eigenen Rechts unterschiedlich gefeiert wird, klingt dabei bereits in den cc. 372, 1015 § 2 und 1021 CIC an. Im Kontext der Gleichsetzung von „Ritus“ und „Kirche eigenen Rechts“ hat die Vokabel schließlich viertens auch eine Weitung über den Bereich der Liturgie hinaus erfahren, wie sie im Anschluss an OE 3 prägnant in can. 28 § 1 CCEO zum Ausdruck kommt: „Ritus est patrimomium liturgicum, theologicum, spirituale et disciplinare (der Ritus ist das liturgische, theologische, geistliche und disziplinäre Erbe)“.
In c. 923 CIC wird der Begriff „Ritus“ in der dritten der vier beschriebenen Bedeutungen verwendet. Die Norm gestattet somit eine „interrituelle“ Gottesdienstgemeinschaft über die Grenzen der verschiedenen Kirchen eigenen Rechts hinweg. Was wie eine Selbstverständlichkeit erscheinen mag, offenbart seine Tragweite und Sinnspitze in historischer Perspektive. Im schleichenden Prozess einer Entfremdung zwischen der okzidentalen (dominante Liturgiesprache: Latein) und der orientalischen (dominante Liturgiesprache[n]: Griechisch [und Syrisch, später auch Arabisch]) Christenheit unterschied man im Mittelalter – begünstigt durch die weitgehende Monopolstellung des Römischen Ritus infolge der karolingischen Renaissance – zunächst nur den lateinischen vom griechischen Ritus. Erst im Gefolge einerseits der mittelalterlichen Re-Pluralisierung der okzidentalen Liturgie v.a. durch die Entwicklung unterschiedlicher Riten in der Liturgie der verschiedenen Orden (vgl. zu dieser neuen Vielfalt auch hier), andererseits der Erkundung der orientalischen Liturgien durch Pioniere der Liturgiewissenschaft im 17./18 Jh., wuchs allmählich das Bewusstsein dafür, dass der lateinische und der griechische Ritus differenzierter zu betrachten sind. So unterschied etwa Papst Benedikt XIV. in seiner Enzyklika Allatae sunt vom 26.07.1755, dort Nr. 3, für den Bereich der Ostkirche den byzantinischen, armenischen, syrischen und koptischen Ritus, für die Westkirche den römischen, ambrosianischen und mozarabischen Ritus sowie die besagten Eigenriten der Orden.
Dabei blieb freilich die generelle abendländische Wahrnehmung der orientalischen Riten überschattet von dem Narrativ, dass alle großen Häresien der Kirchengeschichte im Osten aufgekommen seien, um anschließend von Rom und dem Westen erfolgreich bekämpft zu werden. Hieraus wurde abgeleitet, dass also allein die lateinische Liturgie und der Römische Ritus die Stützen des wahren Glaubens und der reinen Lehre seien; und umgekehrt die orientalischen Liturgien (vielleicht nicht aktuell, aber doch wenigstens potenziell) dem Irrglauben Vorschub leisten würden. Diese Erwägungen wurden schlagwortartig zur Doktrin von der „praestantia ritus Latini“ gebündelt, das heißt der Überzeugung, dass die lateinische (faktisch die römische) Liturgie theologisch den orientalischen Liturgien überlegen sei. Nachdem vor allem Papst Leo XIII. mit dem Apostolischen Schreiben Orientalium Dignitas vom 30.11.1894, in: AAS 27 (189/95) 257–264, bezüglich dieser Lehre eine Kehrtwende eingeläutet hatte, hat sich das Zweite Vatikanische Konzil mit Nachdruck zur gleichen Würde und Wertigkeit aller katholischen Riten bekannt. So spricht die Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium vom 04.12.1963 allen Riten „gleiches Recht und gleiche Ehre“ (SC 4) zu, während im Ostkirchendekret in Bezug auf die Rituskirchen davon die Rede ist, dass „aufgrund ihres Ritus keine von ihnen einen Vorrang vor den anderen hat“ (OE 3).
Auf dieser theologischen Basis erweist sich c. 923 CIC daher im Vergleich mit seiner Vorgängernorm can. 866 CIC/1917 als nochmal großzügiger. Denn dort war zwar in § 1 ebenfalls ein interritueller Gottesdienstbesuch und Kommunionempfang gestattet, jedoch gemäß § 2 mit dem Rat verbunden worden, die österliche Kommunionpflicht gemäß dem eigenen Ritus zu erfüllen.
Erst in jüngerer Zeit haben einzelne Liturgiewissenschaftler wie Cassian Folsom OSB und Hans Jürgen Feulner überlegt, ob es sachgerecht wäre, innerhalb des Römischen Ritus verschiedene Unterformen (Usancen) zu unterscheiden, anstatt vorschnell von einem anderen Ritus zu sprechen. Diese Überlegungen berücksichtigen in besonderer Weise die lehramtliche Vorgabe aus Art 38 der Liturgiekonstitution, bei aller berechtigter Vielfalt und Anpassung der Liturgie „die substantielle Einheit des römischen Ritus im Wesentlichen“ zu wahren. So wird man nämlich aus heutiger Sicht ohne weiteres sagen können, dass die abendländischen Ordensriten keinen „Ritus“ neben dem Römischen Ritus gebildet haben, weil sie sich in der Substanz der jeweiligen Liturgie nicht von der Regelform des Römischen Ritus unterschieden. Ebenso würde die Redeweise von einem zairischen bzw. kongolesischen Usus dem kurialen Standpunkt entgegenkommen, wonach die Eucharistiefeier gemäß dem für den Kongo approbierten Missale (vgl. dazu Kongregation für den Gottesdienst, Le Missel Romain pour les dioceses du Zaïre vom 30.04.1988, in: Notitiae 24 [1988] 455–472) lediglich eine Anpassung des Römischen Ritus im Sinne von Art. 38, 40 SC darstellt. Ferner sei daran erinnert, dass sich für jene liturgische Mischform, die seit den 1980er Jahren in den USA von Konvertit*innen von der anglikanischen zur katholischen Kirche gepflegt wurde, die Bezeichnung „Anglican Use“ eingebürgert hatte.
Vermutlich die erwähnten Erwägungen von Cassian Folsom aufgreifend, hat Papst Benedikt XVI. mit dem Motu Proprio Summorum Pontificum (SP) vom 07.07.2007, in: AAS 99 (2007) 777–781, dem Konzept von mehreren Usus innerhalb ein- und desselben Ritus zu einer nicht unerheblichen Popularität verholfen. Der Papst hatte mit diesem Motu Proprio die „tridentinische Messe“, wie sie in den nach dem Konzil von Trient herausgegebenen römischen Messbüchern und zuletzt im Missale Romanum von 1962 verkörpert war, per Gesetz wieder als rechtmäßige Feiergestalt der Eucharistie zugelassen. Zuvor hatte Paul VI. im Zuge der vatikanischen Liturgiereform mit der Apostolischen Konstitution Missale Romanum vom 03.04.1969, in: AAS 61 (1969) 217–222, ein erneuertes Messbuch eingeführt. Dabei durften gemäß Kongregation für den Gottesdienst, Instruktion De Constitutitione Apostolica „Missale Romanum“ vom 20.10.1969, in: AAS 61 (1969) 749–753, dort Nr. 19, insbesondere ältere und kranke Priester – Genehmigung ihres Ordinarius vorausgesetzt – das alte Missale weiterverwenden. In den 1980er Jahren war diese Möglichkeit von Papst Johannes Paul II. mit dem Indult Quattuor abhinc annos vom 03.10.1984, in: AAS 76 (1984) 1088 f., sowie dem Apostolischen Schreiben Ecclesia Dei vom 02.07.1988, in: AAS 80 (1988) 1495–1498, ausgeweitet worden.
Mit Papst Franziskus, Motu Proprio Traditionis custodes (TC) vom 16.07.2021, ist nunmehr erneut der gesamtkirchliche Gesetzgeber in der Frage der Weiterverwendung des Missale Romanum von 1962 tätig geworden und hat dabei die Regelungen seines Amtsvorgängers praktisch komplett widerrufen. Seit dem Inkrafttreten des Motu Proprio mit Abdruck im L’Osservatore Romano ist die Feier der Eucharistie in der forma extraordinaria, dem usus antiquior, wieder genau wie vor dem Inkrafttreten von Summorum Pontificum genehmigungspflichtig. Wie bei einer derart einschneidenden Reform der Rechtslage kaum verwunderlich, hat der Akt des Papstes eine Fülle konträrer und teils heftiger Reaktionen hervorgerufen (vgl. etwa hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier und hier; mit Proben auf’s Exempel hinsichtlich der Motive des Papstes ferner hier, hier und hier), auf die hier nicht im Einzelnen einzugehen ist. Stattdessen seien einige kursorische Anmerkungen zum neuen Motu Proprio aus kanonistischer Sicht gestattet.
- Art. 1 TC erklärt, dass die von Paul VI. und Johannes Paul II. promulgierten Editiones typicae des Missale Romanum „die einzige Ausdrucksform der lex orandi des Römischen Ritus“ sind.
Wohl dem, der den Sinn dieser Einlassung auf Anhieb versteht. Der Römische Ritus generiert also eine lex orandi; und diese lex orandi wiederum hat ihre einzige Ausdrucksform (soweit es die Eucharistiefeier anbelangt), im Messbuch der vatikanischen Liturgiereform gefunden. Aber ist das nicht zirkelschlüssig, insofern der Ritus seinerseits in den liturgischen Büchern verkörpert ist? Nachdem „lex orandi“ ein bereits im 5. Jh. von Prosper Tiro von Aquitanien geprägtes Schlagwort ist (vgl. DenzH 246), wäre es an sich durchaus der Mühe wert zu untersuchen, welchen Sinngehalt Prosper Tiro wohl selbst mit der Vokabel „lex“ verbunden hat. (Bemerkenswert ist nämlich, zumal im hiesigen Kontext, die Auskunft der Gelehrten, dass der Begriff im ältesten römischen Recht weniger das von der Staatsmacht erlassene Gesetz, sondern ein formalisiertes, rituelles [!] Verfahren zur Durchsetzung von Rechtsansprüchen bezeichnet habe.) Doch kann diese Frage wohl offenbleiben.
Denn jenseits sprachlicher Analysen ist zunächst festzustellen, dass Art. 1 TC auf Art. 1 Abs. 1 SP antwortet. Dort hatte Benedikt XVI. erklärt, das Missale Pauls VI. und das (tridentinische) Missale Papst Pius V. seien „zwei Ausdrucksformen der lex orandi der Kirche“ (wobei der Begriff Kirche ebenda auch mit „katholischer Kirche des lateinischen Ritus“ spezifiziert wurde). Im Vergleich der beiden Motu Proprien wird somit deutlich, was das Anliegen von Art. 1 TC ist. Die (an sich theologische, nicht disziplinäre) Einlassung Benedikts XVI., es könne innerhalb eines Ritus zwei konkurrierende, in jeder Hinsicht gleichberechtigte leges orandi geben, wird als verfehlt zurückgewiesen. Der amtierende Papst folgt damit der Einschätzung der meisten Theolog*innen und Liturgiewissenschaftler*innen, wonach die „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ – also das Nebeneinander einer Liturgie, die das Konzil ausdrücklich als reformbedürftig gekennzeichnet hatte, vgl. SC 1; SC 15; und einer Liturgie, der die theologischen Fortschritte, die das Vaticanum II erzielt hat, notwendigerweise unbekannt bleiben – ein ernstzunehmendes Problem darstellt. In der Tat ist nicht ohne weiteres einsichtig, wie zwei leges orandi gleichermaßen Spiegelbild einer einzigen lex credendi sein können. (Eine Pluralität des Normativen intellektuell zu bewältigen, kann schwierig sein.)
Umgekehrt ist mit der umständlichen Formulierung aus Art. 1 TC gerade nicht die Erwägung Benedikts XVI. widerrufen, dass der Römische Ritus als solcher mehr als nur eine einzige Ausdrucksform kenne. Mit anderen Worten: Der usus antiquior bleibt auch nach Traditionis custodes eine (im Sinne von SC 4 anerkannte?) Ausdrucksform des Römischen Ritus. Indes kann diese Ausdrucksform – so Franziskus – nicht mehr für sich beanspruchen, normativer Erkenntnisort einer Theologie auf der Höhe der Zeit zu sein.
- Vor nicht unbeträchtliche Auslegungsschwierigkeiten wird Art. 3 § 2 TC die künftigen Rechtsanwender stellen. Hier begegnet – vielleicht erstmalig in der Rechtsgeschichte – der Fall einer Norm, die mit einem Klammerzusatz versehen ist. Für Gruppen, die Eucharistie in der forma extraordinaria feiern möchten, hat der Bischof „einen oder mehrere Orte zu bestimmen […] (jedoch nicht in den Pfarrkirchen und ohne neue Personalpfarreien zu errichten)“.
Man denkt unwillkürlich an das Jesuswort aus Mt 5,37 und darf rätseln, welche normative Qualität dem Klammerzusatz zukommt. Ist die Norm so zu lesen, als gäbe es die Klammer nicht? Oder so, als gäbe es den eingeklammerten Inhalt nicht? Oder erfüllt derjenige, der einen geeigneten Ort bestimmt, zwar das Minimalziel der Norm – während derjenige, der dabei nicht auf Pfarrkirchen zurückgreift, sie besser erfüllt? Nachdem das Gesetz selbst hier offenkundig einen Rechtszweifel provoziert, wäre es gemäß c. 14 CIC als nicht verpflichtend anzusehen (wobei man insoweit den Streit fortsetzen könnte, ob die Nichtverpflichtung die gesamte Norm des Art. 3 § 2 TC oder nur den Klammerzusatz erfasst). Spätestens jetzt stellen sich dann weitere Fragen auf der Metaebene: Was hat sich der Päpstliche Rat für die Gesetzestexte, sofern er – wie es üblich wäre – in den Gesetzgebungsprozess eingebunden war, dabei gedacht, als er diese Gestaltung des Rechtstextes akzeptierte? Welchen Nutzen und Mehrwert birgt mit anderen Worten eine absichtlich mehrdeutige und mindestens partiell nichtverpflichtende Norm? (Eine Pluralität des Normativen intellektuell zu bewältigen, kann schwierig sein.)
Ein besonders offensiver Umgang mit dieser Norm wird übrigens aus dem Bistum Knoxville im schönen Tennessee (USA) berichtet. Mit offenem Brief an Klerus und Volk seines Bistums hat Diözesanbischof Richard F. Stika festgestellt, dass in seinem Bistum die Gottesdienste in der außerordentlichen Form des Ritus bislang ausschließlich in Pfarrkirchen gefeiert würden und praktikable Alternativen nicht zur Verfügung stünden. Daher hat der Bischof kurzerhand unter Berufung auf c. 87 § 1 CIC von Art. 3 § 2 TC dispensiert.
Von einem rein kanonistischen Standpunkt besehen, ist dies (auch hinsichtlich ihrer rechtlichen Wirksamkeit) eine äußerst zweifelhafte Entscheidung. Denn Dispensen sind im geltenden Recht per definitionem Verwaltungsakte im Einzelfall. Die „Dispens“ von Bischof Richard ist dagegen in der Sache ein diözesanes Partikulargesetz, und zwar ein solches, das im Widerspruch zum höheren Recht des Motu Proprio steht und daher gemäß c. 135 § 2 CIC nicht von einem dem Papst untergeordneten Gesetzgeber erlassen werden kann.
Die Überlegung, die besagte Dispens diene dem geistlichen Wohl der dadurch begünstigten Gläubigen (inklusive der zelebrierenden Priester), führt sodann mittenhinein in eine theologische und kirchenpolitische Grundsatzdebatte. Braucht es eine solche Dispens, wenn eine ohne weiteres gangbare Alternative darin besteht, die Eucharistiefeier gemäß der forma ordinaria des Römischen Ritus mitzufeiern bzw. zu zelebrieren? Dass auch die Eucharistiefeier in der forma ordinaria ein geistliches Wohl gewährt, kann niemand ernstlich in Frage stellen. Ist mithin das geistliche Wohl aus der forma extraordinaria ein aliud – womöglich sogar ein plus – gegenüber dem geistlichen Wohl aus der forma ordinaria? Diese Frage ist meines Erachtens differenziert zu beantworten, wie folgt: Theo-logisch, also von Gott her, in der katabatischen Dimension der Liturgie, kann es meiner Überzeugung nach keinen Unterschied hinsichtlich des geistlichen Wohls für die Gläubigen aus der einen oder anderen Feiergestalt der Eucharistiefeier geben. Indes, wie schon Thomas von Aquin anerkannte: „Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur” (vgl. Summa Theologiae, 1a, q. 75, art. 5 co). Der subjektive, gefühlte Nutzen jedes einzelnen Gläubigen mag sich also danach unterscheiden, in welchem Setting und in welcher Feiergestalt sie oder er Eucharistie feiert. Dies mag im Einzelfall (!) eine entsprechende Dispens rechtfertigen.
- Ein weiteres handwerkliches Schmankerl begegnet sodann in Art. 3 § 3 TC. Nach einer Norm mit Klammerzusatz nun zur Abwechslung eine Norm mit Fußnote. Die Fußnote verweist auf die von der Kongregation für die Glaubenslehre jeweils am 22.02.2020 erlassenen Dekrete Quo magis und Cum sanctissima. In der Sache soll also allem Anschein nach zum Ausdruck gebracht werden, dass die Bezugnahme in Art. 3 § 3 TC auf das Missale von 1962 nicht so zu verstehen ist, dass beide Dekrete nicht mehr in Geltung stünden. Einst pflegte man derlei mit der Wendung „salvo praescripto …, unbeschadet der Vorschrift …“ zum Ausdruck zu bringen. (Eine Pluralität des Normativen intellektuell zu bewältigen, kann schwierig sein.)
- Gemäß Art. 3 § 6 TC haben die Bischöfe dafür Sorge zu tragen, die Bildung neuer Gruppen nicht zu genehmigen. Man ist versucht, in einem ersten Reflex laut aufzuschreien: Verstößt das nicht gegen „innerkirchliche Grundrechte“ wie sie in den cc. 213–215 CIC niedergeschrieben sind? Und liegt hier nicht eine unbillige Einschränkung des Normzwecks des c. 923 CIC vor, insofern quasi synchron die Riten der nichtlateinischen Ecclesiae sui iuris besser gestellt werden als diachron die alte Form des eigenen Ritus?
Allerdings wird man zu diesen Anfragen auch folgendes festhalten können: Was eine Berufung auf c. 213 CIC anbelangt, so geht es wie gesagt nicht an, die forma ordinaria und die forma extraordinaria hinsichtlich ihrer geistlichen Qualität gegeneinander auszuspielen. Was eine Berufung auf c. 214 CIC anbelangt, ist schon dem Wortlaut der Norm zu entnehmen, dass das Recht der Gläubigen nach und nicht vor der näheren Regelung des Ritus durch die Hirten der Kirche greift. Und was eine Berufung auf c. 215 CIC anbelangt, so bleibt meines Erachtens in der Tat die Frage, ob ein Bischof rechtlich die Bildung neuer Gruppen durch deren „Nicht-Genehmigung“ unterbinden kann. Der Sinn und Zweck des Art. 3 § 6 TC dürfte dennoch klar sein: Neue Interessenten für die Mitfeier der Eucharistie im usus antiqior sind gehalten, sich bereits bestehenden Gruppen anzuschließen. (Eine Pluralität des Faktischen praktisch zu bewältigen, kann schwierig sein.)
- Art. 4 TC erklärt für nach Inkrafttreten des Motu Proprio geweihte Priester die Zelebration in der forma extraordinaria zu einer erlaubnispflichtigen Angelegenheit. Es fällt auf, dass die in Art. 2 S. 1 TC besonders betonte, aber bereits in Art. 2 S. 2 TC mit Blick auf Weisungsbefugnisse des Apostolischen Stuhls gleich wieder relativierte Stellung des Diözesanbischofs hier besonders eingehegt und bürokratisiert wird. Der Bischof wird vor Erteilung einer Genehmigung erst den Apostolischen Stuhl konsultieren. Anscheinend besteht hier also seitens des Heiligen Vaters ein gewisses Misstrauen gegenüber einzelnen Bischöfen, so dass Vorsorge getroffen wird gegen kirchenpolitische Fehlentwicklungen nach dem Motto „Liberal ist das neue reaktionär“.
- Die hohe Kunst der Kanonistik scheint nach alledem jedoch zu guter Letzt in Art. 5 TC auf. Jene Priester, die bereits vor dem Inkrafttreten von Traditionis custodes nach dem Missale von 1962 zelebriert haben, „erbitten vom Diözesanbischof die Genehmigung, weiterhin von dieser Befugnis Gebrauch zu machen.“ Man muss sich dieses Wording auf der Zunge zergehen lassen.
Der Gesetzgeber geht also davon aus, dass es gleichsam ein wohlerworbenes Recht (oder in der Diktion von Traditionis custodes also eine Befugnis) zur Zelebration im usus antiquior geben kann, welche durch eine – im Extremfall eine einmalige (!) – Zelebration in der forma extraordinaria während des Regimes von Summorum Pontificum erworben wurde.
Und der Gesetzgeber geht offenbar desweiteren davon aus, dass diese Befugnis als solche (als „Stammrecht“) unverlierbar ist; dass aber – nachdem unter dem Regime von Traditionis custodes die Zelebrationen im usus antiquior generell unter Genehmigungsvorbehalt gestellt werden – das tatsächliche Gebrauchmachen von dieser unverlierbaren Befugnis rechtmäßig oder unrechtmäßig sein kann, je nachdem, ob für zukünftige Zelebrationen die Genehmigung erteilt wurde oder nicht.
Vielleicht gibt es Gläubige, die sich spätestens an diesem Punkt die bange Frage stellen: Muss ich mich ab sofort eigentlich beim Zelebranten oder an höherer Stelle über ihn vergewissern, ob er eine Genehmigung des Bischofs hat, wenn ich durch einen sonntäglichen Gottesdienstbesuch in der forma extraordinaria meiner Sonntagspflicht gemäß c. 1247 CIC nachkommen möchte? Hierzu ist festzustellen, dass dies sicher nicht erforderlich ist. Denn gemäß c. 1248 § 1 CIC genügt der Sonntagspflicht, wer an einer Messfeier in irgendeinem katholischen Ritus teilnimmt. (Der Begriff des Ritus hat hier den selben Sinn wie in c. 923 und umfasst nach ganz herrschender Meinung selbstredend auch den usus antiquior). Dabei kommt es – gewissermaßen in einer Adaption des ex opere operato-Prinzips – gerade nicht darauf an, ob die Feier rechtmäßig zelebriert wird oder nicht. Dies folgt logisch zwingend aus dem Vergleich des jetzigen c. 1248 § 1 CIC mit der Formulierung in der ersten Entwurffassung der Norm während der Kodexreform, nämlich mit can. 47 des Schema de locis et temporibus sacris von 1977. Dort war noch verlangt, dass die Messe „legitime celebratur“. Im weiteren Verlauf der Kodexreform wurde „legitime“ ersatzlos gestrichen, so dass es nur auf die Frage der Gültigkeit, nicht aber die Frage der Erlaubtheit bzw. Rechtmäßigkeit der Zelebration ankommen kann.
Papst Franziskus hat – ähnlich wie seinerzeit Papst Benedikt XVI. – die Motive seiner Gesetzgebung in einem Begleitschreiben erläutert. Dabei wurde als Motiv besonders jener liturgische Missbrauch herausgestellt, der darin besteht, die Eucharistie nach dem Missale von 1962 zu theologischen und kirchenpolitischen Agitationen gegen das Zweite Vatikanische Konzil und die nachkonziliare Kirche selbst zu instrumentalisieren. Der Heilige Vater hat entschieden, dass dieses Problem nach drastischen gesetzgeberischen Maßnahmen verlangt. Wie dargelegt, wird dabei eine an sich disziplinäre Entscheidung mit einer lehrmäßigen Korrektur verknüpft, insofern also in Zukunft die Redeweise von zwei Ausdrucksformen der lex orandi des Römischen Ritus verfehlt ist. Es liegt gewissermaßen in der Natur der Sache, dass so mit anderen Worten gleichsam eine praestantia formae ordinariae gelehrt wird – und zwar, mea sententia, theologisch durchaus zurecht. Dennoch befremdet ein Stück weit die damit einhergehende Rhetorik, die letztlich einer „innerrituellen Rückkehrökumene“ das Wort redet: Es gilt demnach „für das Wohl derer zu sorgen, die […] Zeit brauchen, um zum Römischen Ritus zurückzukehren, wie er von den Heiligen Paul VI. und Johannes Paul II. promulgiert wurde“. Der Fähigkeit der (lateinischen) Kirche, eine innere Weite des Katholischen zu leben – dies das große Thema des c. 923 CIC –, stellt der Papst mit Blick auf den Zustand der Kirche im Jahr des Herrn 2021 also leider kein günstiges Zeugnis aus.
c. 1389 CIC n.F. (c. 1384 CIC a.F.)
„Qui, praeter casus, de quibus in cann. 1378-1383, sacerdotale munus vel aliud sacrum ministerium illegitime exsequitur, iusta poena puniri potest.“
„Wer, außer in den in cann. 1378-1383 genannten Fällen, eine priesterliche Aufgabe oder einen anderen geistlichen Dienst unrechtmäßig ausübt, kann mit einer gerechten Strafe belegt werden.“
von Anna Krähe
Der vorliegende Beitrag gehört zur sechsteiligen Reihe „Wann Kirche straft und warum“, in der ausgewählte Kanones aus dem besonderen Teil des kirchlichen Sanktionsrechts, cc. 1364–1398 CIC n.F., vorgestellt werden. Bisherige Teile: Teil 1 (c. 1368 CIC n.F. [c. 1369 CIC a.F.]); Teil 2 (c. 1374 CIC n.F.).
Hinweis: Mit der Apostolischen Konstitution „Pascite gregem Dei“ vom 23. Mai 2021 hat Papst Franziskus Kanones im Buch VI des CIC/1983 „Die Strafbestimmungen in der Kirche“ promulgiert (Kanones lat.; Kanones dt.). Sie sind am 8. Dezember 2021 in Kraft getreten. Der folgende Text wurde daher überarbeitet. Dabei wurden den Kanones des kirchlichen Strafrechts zur Unterscheidung der besprochenen Norm die Kürzel „a.F.“ (= alte Fassung) sowie „n.F.“ (= neue Fassung) hinzugefügt und teils auch Anpassungen des Textes vorgenommen.
„Alles und Nichts“ scheint es zu sein, was der Kanon dieses Monats da sanktionieren will. Im Gegensatz zu den ihn umgebenden Normen, die zum Beispiel recht gut vorstellbare Verstöße bei der Feier des Buß- und Weihesakraments thematisieren, lässt c. 1389 CIC n.F. (c. 1384 CIC a.F.) doch recht viel Raum für eine Vielzahl möglicher Einzelfälle – ganz typisch für eine klassische Auffangnorm. Nachdem der Gesetzgeber in zumeist vorausgehenden Normen schon konkrete Tatbestände genannt und mit entsprechenden Sanktionsandrohungen versehen hat, möchte er in bestimmten Fällen darüber hinaus auch anderes, ähnlich schädliches Verhalten verhindern, welches sich aber aufgrund der Vielgestaltigkeit des Lebens und der Einzelfälle (noch) nicht konkret benennen lässt. Gerade solche Regelungen bieten eine schöne Vorlage für ein paar eher grundsätzliche Gedanken und systematische Überlegungen.
Wie bereits in den anderen Teilen dieser Reihe zum kirchlichen Sanktionsrecht gilt der erste Blick den potentiellen Täter*innen. Zunächst scheint c. 1389 CIC n.F. (c. 1384 CIC a.F.) einmal mehr an einen unbestimmten Personenkreis gerichtet zu sein („qui“), sodass eine nähere Bestimmung über c. 11 CIC erfolgen muss. Daraus folgt nach herrschender Meinung, dass die Normen des kirchlichen Sanktionsrechts für alle Katholik*innen nach Vollendung des siebten Lebensjahres gelten (nach c. 1323 n. 1 CIC bleibt jedoch straffreich, wer das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat). Bei einem zweiten Blick auf die genannten Tathandlungen und in einen Teil der Kommentarliteratur (bisher noch Strafrecht a.F.) zu c. 1389 CIC n.F. (c. 1384 CIC a.F.) zeigt sich aber, dass die Frage, wer sich hier überhaupt strafbar machen könnte, wohl auch in enger Verbindung zum Verständnis der zu verhindernden Delikte steht. Daher ist im Fall dieses Kanons vor einer abschließenden Antwort zum angesprochenen Personenkreis erst einmal näher auf die Tatbestände zu schauen.
Sanktioniert wird eine Person nach c. 1389 CIC n.F. (c. 1384 CIC a.F.), wenn sie eine „priesterliche Aufgabe oder einen anderen geistlichen Dienst unrechtmäßig ausübt“. Fraglich ist also zunächst, was der Gesetzgeber unter „sacerdotale munus“ (Delikt 1) bzw. „aliud sacrum ministerium“ (Delikt 2) versteht. Beide Begriffspaare benennen keine ganz konkreten Handlungen, sondern umschreiben vielmehr bestimmte Handlungsbereiche. Bestenfalls lässt sich in solchen Fällen andernorts im Gesetzbuch, durch gefestigte Rechtsprechung oder durch authentische Interpretation eine genauere Definition finden. Bleiben diese Wege erfolglos, ist die selbstständige (private) Auslegung der entsprechenden Norm vonnöten, für die der Gesetzgeber in c. 17 CIC die entsprechenden Methoden umschreibt. Im Fall des c. 1389 CIC n.F. (c. 1384 CIC a.F.) bedarf es eben dieser Auslegung, um diejenigen Handlungen, deren illegitime Ausübung der Kanon sanktioniert, näher zu bestimmen. Diese Auslegung beginnt mit dem Blick auf den genannten Wortlaut der Norm („textus“; c. 17 CIC).
Dabei fällt zunächst auf, dass vor der Nennung der eigentlichen Tatbestandshandlungen zunächst alle bereits in cc. 1379–1388 CIC n.F. (cc. 1378–1383 CIC a.F.) genannten Handlungen explizit ausgeschlossen werden. Die dort aufgeführten Delikte können demnach zwar wohlmöglich als „sacerdotale munus“ oder „aliud sacrum ministerium“ verstanden werden, sind aber nicht (auch noch) durch c. 1389 CIC n.F. (c. 1384 CIC a.F.) sanktionsbedroht. Die cc. 1378–1383 CIC a.F. umfassen im (noch) geltenden Recht Handlungen im Rahmen von Sakramentenfeiern (insb. Buße und Weihe) sowie allgemein die Amtsanmaßung nach c. 1375 CIC n.F. (c. 1381 CIC a.F.).
Mit „sacerdotale munus“ will der Gesetzgeber wohl nicht an die cc. 204 § 1, 834 § 1, 1173 CIC anknüpfen, die vom „munus sacerdotale (Iesu) Christi“ handeln, auch wenn diese Wendung sonst nur in diesem Zusammenhang im CIC/1983 verwendet wird. Da c. 1389 CIC n.F. (c. 1384 CIC a.F.) nur von „sacerdotale munus“ spricht, sind hiermit aber wohl nicht alle Handlungen im Rahmen des allen Gläubigen aufgetragenen Heiligungsdienstes gemeint, sondern eben diejenigen Aufgaben (oder auch Dienste, Ämter, Pflichten – der Begriff „munus“ wird im CIC/1983 nicht einheitlich gebraucht), welche von „sacerdotes“ ausgeübt werden, also denjenigen, die gültig zum Priester geweiht sind. Die entsprechende Norm des CIC/1917, can. 2322 n. 2, verwendete die ähnliche Wendung „munia sacerdotalia“, priesterliche (Amts-)Pflichten, für explizit aus der Priesterweihe resultierende Pflichten, allerdings ebenfalls ohne diese inhaltlich näher zu benennen.
Bei der Frage nach „aliud sacrum ministerium“ gestaltet sich die Auslegung schwieriger. Die Voranstellung von „aliud“ kann darauf hindeuten, dass der heilige Dienst die vorher genannten priesterlichen Aufgaben einschließen soll, jedoch darüber hinausgeht. Unklar bleibt aber, worin dieses „Mehr“ bestehen könnte. Mit Blick auf den ganzen Kodex zeigt sich, dass das Begriffspaar „sacrum ministerium“ – außer in den straf-(prozess-)rechtlichen Kanones, c. 1389 CIC n.F. (c. 1384 CIC a.F.) und c. 1722 CIC – immer klar im Kontext von Handlungen verwendet wird, die von Klerikern vorgenommen werden. Ein Befund, der auch dadurch gestützt wird, dass die personalisierte Form, „sacri ministri“, nach c. 207 CIC Kleriker, also geweihte Personen (vgl. c. 1008 CIC) meint. Der einzige Kanon, der ein wenig mehr Aufschluss über die Inhalte dieses heiligen Dienstes gibt (der Begriff „ministerium“ wird im CIC/1983 ähnlich wie „munus“ nicht einheitlich gebraucht), ist c. 256 § 1 CIC, der zu den Normen über die Ausbildung von Klerikern gehört. Er enthält eine sehr weite, exemplarische Aufzählung derjenigen Bereiche, die für den Gesetzgeber „in besonderer Weise zum geistlichen Amt [ministerium]“ gehören: Die Ausübung des Dienstes in Katechese, Predigt, Gottesdienst – besonders bei der Feier der Sakramente –, im Umgang mit allen Menschen (auch Nicht-[katholisch-]Gläubigen), in der Pfarrverwaltung und bei übrigen Aufgaben.
Dass diese sehr umfassende Aufzählung heiliger Dienste hier auch von der Sanktionsnorm des c. 1389 CIC n.F. (c. 1384 CIC a.F.) umfasst sein soll, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Dies wird auf der Ebene der Tatbestandsumschreibung schon im Merkmal der unrechtmäßigen Ausübung deutlich. Damit eine bestimmte Handlung als „illegitime“ (= rechtswidrig, unrechtmäßig) bezeichnet werden kann, bedarf es ja zunächst einer näheren rechtlichen Regelung zur Ausübung der betreffenden Aufgabe bzw. des betreffenden Dienstes.
Als Zwischenfazit ist somit festzuhalten, dass der Gesetzgeber mit „sacerdotale munus“ all jene rechtlich geordneten Aufgaben meint, welche die Priesterweihe voraussetzen. Das „sacrum ministerium“ meint – ausgehend von einer einheitlichen Terminologie im CIC/1983 – rechtlich geordnete Dienste, die von Klerikern (also auch Diakonen) ausgeübt werden können.
Aber wer übt (ggf. unter welchen Umständen) diese Aufgaben und Dienste denn dann „illegitime“ aus und kann sich damit nach c. 1389 CIC n.F. (c. 1384 CIC a.F.) strafbar machen? Hier ist der Bogen zu der noch nicht abschließend beantworteten Frage nach dem möglichen Täter*innenkreis geschlagen. In diesem Punkt nämlich wird es in der Kommentarliteratur recht bunt. Klaus Lüdicke scheint all diejenigen als mögliche Täter*innen zu identifizieren, welche die genannten Handlungen qua Stand oder Weihe-(Stufe) nicht vornehmen können; also bei Delikt 1 Laien und Diakone, bei Delikt 2 nur Laien (vgl. MKCIC–Lüdicke, c. 1384, Rz. 5). Wilhelm Rees argumentiert (vgl. W. Rees, § 107 Einzelne Straftaten: HdbkathKR3, 1629), wie bereits Audomar Scheuermann zum CIC-Strafrechtsschema von 1973 so (A. Scheuermann, Das Schema 1973: AfkKR 143 [1974], 53), dass von dieser Norm Handlungen umfasst sind, zu denen die betreffende Person zwar befähigt ist (also Kleriker qua Weihevollmacht), die ihr aber aus irgendwelchen Gründen auszuüben verboten sind, z.B. aufgrund einer strafweisen Suspension (vgl. c. 1333 CIC) oder Irregularitäten bzw. Hindernissen für die Weiheausübung (vgl. c. 1044 CIC). Rees' Verständnis basiert wohl auf der Abgrenzung des c. 1389 CIC n.F. (c. 1384 CIC a.F.) zur Amtsanmaßung nach c. 1375 CIC n.F. (c. 1381 CIC a.F.). John Renken kombiniert beide Positionen und sieht je nach Delikt zum einen Laien (und Diakone) im möglichen Täter*innenkreis, zum anderen aber auch „sacerdotes“, sofern ihnen die Ausübung ihrer Weihe gesetzlich verboten ist (vgl. J. A. Renken, Commentary, 296).
Diese in Teilen wenig deckungsgleichen Antworten fußen, dies ist zumindest zu vermuten, auf voneinander abweichenden Verständnissen der Tatbestandsmerkmale des c. 1389 CIC n.F. (c. 1384 CIC a.F.). In der engsten – evtl. aber schon restriktiven – Auslegung sind priesterliche Aufgaben und geistliche Dienste solche, die nur Personen mit Weihevollmacht ausüben können. Wird „illegitime“ dann so verstanden, dass diese Personen aufgrund der Weihe zwar rechtwirksam, aber eben rechtswidrig handeln, dann kommen als Täter ausschließlich Kleriker in Betracht, die zwar gültig geweiht sind, denen aber die Weiheausübung verboten wurde. Zumindest mit Blick auf „sacrum ministerium“ ist aber auch zu fragen, ob der terminologische Abgleich innerhalb des CIC/1983 und das Verständnis als klerikaler Dienst denn zur Folge hat, dass hier Dienste gemeint sind, die ausschließlich Klerikern vorbehalten sind. Oder hatte der Gesetzgeber nicht möglicherweise über die Weihevollmacht hinaus Dienste im Blick, die zwar im Regelfall eine Weihe voraussetzen, zu denen unter Einhaltung bestimmter Umstände aber auch Laien beauftragt werden könnten; z.B. in besonderen Ausnahmefällen die Beauftragung von Laien als Trauassistent*innen (c. 1112 CIC)? Im Rahmen dieser Frage ist zu beachten, dass der Gesetzgeber bei der Umschreibung des möglichen Täter*innenkreises ja gerade keine Engführung auf „clerici“ oder „sacri ministri“ vorgenommen, sondern die offene Formulierung „qui“ gewählt hat. Eine Umschreibung, die im kirchlichen Sanktionsrecht in aller Regel für Delikte Verwendung findet, die grundsätzlich erst einmal von jedem und jeder Katholik*in begangen werden können. An anderer Stelle, wie z.B. in c. 1379 § 1 n. 1 CIC n.F. (c. 1378 § 2 n. 1 CIC a.F.) hebt der Gesetzgeber klar hervor, dass potentielle Täter*innen solche ohne Priesterweihe sind und die Feier der Eucharistie insofern auch nur „versucht“ werden kann. Wenn jedoch die Begriffspaare von Delikt 1 und 2, zumindest aber „sacrum ministerium“, nicht exklusiv auf Dienste, welche die Weihevollmacht voraussetzen, abstellen, sondern ggf. unter weiteren inhaltlichen Aspekten Dienste einschließen, die zumindest unter bestimmten Umständen auch Laien ausüben können, dann wäre auch der mögliche Täter*innenkreis der unrechtmäßigen Ausübung größer.
Möglicherweise kann der Blick über den Text hinaus auf den Kontext und damit die gesetzessystematische Einordnung (vgl. c. 17 CIC) ein wenig mehr Licht in die Tatbestände des c. 1389 CIC n.F. (c. 1384 CIC a.F.) bringen, der c. 1389 CIC n.F. hat nämlich eine neue Verortung erfahren (s.u.). In der alten Fassung war c. 1384 im zweiten Teil des Buches VI im CIC/1983 unter Titel III „De munerum Ecclesiasticorum usurpatione deque delictis in iis exercendis“ eingeordnet, was die dt. Übersetzung in Kurzform (vielleicht auch etwas zu verkürzter Form) mit „Amtsanmaßung und Amtspflichtverletzung“ wiedergab. Augenscheinlich ging es dem Gesetzgeber in Titel III darum, dass das in den einzelnen Kanones und Tatbeständen dieses Titels thematisierte Verhalten deswegen möglichst zu verhindern und im schlimmsten Fall zu sanktionieren ist, weil dadurch kirchliche Ämter – bzw. umfassender: die kirchlichen Aufgaben – und die mit ihnen angezielte Wirkung in Gefahr geraten oder sogar Schaden nehmen könnten. Mit der Übertragung von Vollmacht – ob durch Weihe oder eine Form der kirchlichen Beauftragung – stehen die Träger*innen in einer spezifischen Verantwortung besonders denjenigen gegenüber, für die sie eine bestimmte Aufgabe erfüllen. Diese Verantwortung entweder gar nicht, willkürlich oder missbräuchlich wahrzunehmen oder bestimmte Aufgaben auszuüben ohne das Vorliegen oder eine Prüfung der entsprechenden Voraussetzung zur Ausübung durch die kirchliche Autorität – die das Handeln ihrer Amtsträger ja mitverantworten muss – kann irritieren; oder es kann Ärgernisse hervorbringen, weil es vielleicht zu Ungleichbehandlungen kommt; es kann im schlimmsten Fall Gläubige in ihrem Vertrauen in die Kirche und möglicherweise sogar in ihrem Glauben schädigen. Das hat die Kirche zu verhindern und bringt daher für besonders schwerwiegende Fälle solchen missbräuchlichen Handelns ihre schärfsten Mittel in Stellung: kirchliche Sanktionen. Der Titel III im speziellen Teil des kirchlichen Sanktionsrechts will die ungestörte und rechtmäßige Ausführung kirchlicher Aufgaben durch die dafür Zuständigen schützen; dies gilt auch für die Sanktionskanones im Titel III n.F. Mit Blick auf c. 1384 CIC a.F. kann dieses Verständnis zumindest insoweit helfen, als es dem Gesetzgeber wohl darum ging, dort primär die Zuständigkeitsregelungen für bestimmte Aufgaben und Dienste als eben notwendige Voraussetzung von deren Wirksamkeit zu schützen. Bei den in Titel III behandelten Tatbeständen spielen die Fragen von Vollmacht und Beauftragung deswegen eine so deutliche Rolle. Eine eindeutige Schlussfolgerung bezüglich des Verständnisses von c. 1384 CIC a.F. lässt sich daraus aber wohl nicht ziehen. Eine klare Zuschreibung, was abgesehen von Vollmacht und Beauftragung konkret inhaltlich mit den priesterlichen Aufgaben und den geistlichen Diensten in c. 1384 CIC a.F. gemeint war, bleibt ebenso offen.
Die Vielfältigkeit der möglichen Einzelfälle illustrieren auch die Literaturbeispiele für c. 1389 CIC n.F. (c. 1384 CIC a.F.): Neben priesterlichen Aufgaben und geistlichen Diensten aus dem weiteren Bereich des Sakramentenrechts (über cc. 1379–1388 CIC n.F. [cc. 1378–1383 CIC a.F.] hinaus) wie der Trauassistenz ohne Traubefugnis (c. 1108 CIC) oder ohne vorherige formale Ehevorbereitung (cc. 1066f. CIC) oder der Generalabsolution ohne Einhaltung der entsprechenden Vorschriften (cc. 961f. CIC), werden nämlich auch folgende Fälle genannt:
- Beerdigung einer Person, der ein kirchliches Begräbnis verweigert werden muss (c. 1184 CIC);
- widerrechtlicher Predigtdienst (also insb. eine Homilie in der Eucharistiefeier durch Laien (c. 767 CIC);
- Ausübung spezifisch den Pfarrer aufgetragener Aufgabe durch einen Kirchenrektor (c. 558 CIC);
- allgemein die Missachtung liturgischer Vorschriften.
Und was gilt nach der Strafrechtsreform 2021? Der c. 1384 CIC a.F. wurde kaum überarbeitet. Abgesehen von seiner neuen Einordnung als c. 1389 CIC n.F. ändern sich zum einen die Kanonnummern der ausgenommenen Regelungsfälle, aufgrund der weiteren Umarbeitung innerhalb der neuen kirchlichen Sanktionsrechtsnormen. Inhaltlich wurden die cc. 1379–1388 CIC n.F. um Delikte im Rahmen von Sakramentenfeiern erweitert und die Amtsanmaßung des c. 1375 CIC n.F. (c. 1381 CIC a.F.) wurde in einen anderen Titel verschoben. Zum anderen wird die Sanktionsandrohung erweitert und verschärft: Die gerechte Strafe wird verpflichtend („iusta poena puniatur“) und die Verhängung von Beugestrafen wird möglich.
Can. 1384 [a.F.] – Qui, praeter casus, de quibus in cann. 1378–1383, sacerdotale munus vel aliud sacrum ministerium illegitime exsequitur, iusta poena puniri potest. | Can. 1389 [n.F.] – Qui, praeter casus, de quibus in cann. 1379–1388, sacerdotale munus vel aliud sacrum ministerium illegitime exsequitur, iusta poena puniatur, non exclusa censura. |
Gerade die Sanktionsverschärfung macht die Frage nach den konkreten sanktionierten Handlungen in c. 1389 CIC n.F. noch einmal besonders virulent. Zumal die Unbestimmtheit des Ausdrucks „sacrum ministerium“ bereits im Rahmen der Kodexreform zu can. 58 Schema Poen/1973 angefragt, vom Relator jedoch so eingeschätzt wurde, dass von der Unbestimmtheit weder Schaden noch Gefahr zu befürchten sei, weil der Kanon eine fakultative Strafe sowohl bezüglich der Bestimmtheit („iusta poena“) als auch bezüglich der Verhängung vorsehe (vgl. Com 49 [2017], 359). Lüdicke kritisiert diese Argumentation unter anderem dahingehend, dass damit „die Verantwortung für die Bestrafung, die dem Gesetzgeber obliegt, in die Hand des Anwenders verschoben“ wird (MKCIC–Lüdicke, c. 1384, Rz. 1). Die Konkretisierung durch Rechtsanwendungsorgane ist für die Gläubigen aber oftmals nicht direkt nachvollziehbar, zumal es gerade für das kirchlichen Sanktionsrecht an öffentlich zugänglicher Rechtsprechung mangelt. Gerade, weil Sanktionen Rechte beschränken oder entziehen, welche die Gläubigen qua Taufe entsprechend ihrer eigenen Stellung innehaben (c. 96 CIC) und welche ihre christliche Lebensgestaltung sichern und fördern sollen, ist es aber unerlässlich, dass diese Gläubigen auch nachvollziehen können, unter welchen Umständen sie bestraft werden können. Schon bei c. 1384 CIC a.F. ist demnach anzufragen, ob die Offenheit der Formulierung auf Tatbestandsebene weniger bedrohlich oder missbrauchsanfällig ist, weil auch die Rechtsfolgenseite unbestimmt bleibt. Für den c. 1389 CIC n.F. bleibt die Anfrage aus der Kodexreform wohl in jedem Fall erhalten und wiegt möglicherweise tatsächlich auch schwerer, weil die Bestrafung nun in jedem Fall erfolgen muss, ohne dass – zumindest auf den ersten Blick – klarer ist, worin der Tatbestand besteht.
Hilfreich kann hier möglicherweise der zweite Blick sein. Denn es stellt sich für c. 1389 CIC n.F. die Frage nach der inhaltlichen Füllung in etwas anderer Weise. Das „kirchliche Sanktionsrecht 2021“ gibt dem c. 1389 CIC n.F. nämlich eine neue systematische Einordnung unter dem neuen Titel III „Straftaten gegen die Sakramente“. Die Frage danach, was unter den Tatbeständen von Delikt 1 und 2 zu verstehen ist, wird dadurch – einer strengen Auslegung nach c. 18 CIC folgend – wohl eingeschränkt. Es steht nicht mehr der Schutz der kirchlichen Beauftragung, kirchlicher Dienste und Ämter an sich im Vordergrund, sondern es sollen nun spezifisch Handlungen verhindert werden, welche die Sakramente als kirchliche Grundvollzüge gefährden oder schädigen. Was Sakramente im Positiven bewirken, vermittelt der in den Abschnitt über die Sakramente in Buch IV des CIC/1983 einführende c. 840: Durch sie wird der durch die Verkündigung gehörte und angenommene Glaube ausgedrückt und zugleich bestärkt, Gott wird Verehrung zuteil, der Mensch wird geheiligt (heilsindividuelle Wirkung); zugleich wird „die kirchliche Gemeinschaft herbeigeführt, gestärkt und dargestellt“ (ekklesiologische Wirkung). Diesen „Markenkern“ kirchlicher Vollzüge in seiner ganzen Vielschichtigkeit und allem, was je bezogen auf die einzelnen Sakramente dazu beiträgt, gilt es zu schützen. Genau dies wird allem Anschein nach mit der veränderten Systematik im zukünftigen Sanktionsrecht hervorgehoben und nachdrücklich angezielt. Alle eigentlichen „Amtsverletzungsdelikte“ des bisherigen III. Titels sind unter neuer Überschrift in den Titel II „De delictis contra ecclesiasticam auctoritatem et munerum exercitium“ verlagert worden, der unter dieser Formulierung durchaus auch Anknüpfungspunkte für den c. 1389 CIC n.F. geboten hätte. Diesen Weg hat der Gesetzgeber jedoch nicht gewählt, sondern c. 1389 CIC n.F. im Titel III n.F. belassen, dessen Deliktsnormen ausschließlich Handlungen im Rahmen von Sakramentenfeiern im Blick haben.
Ausschließlich? Nun diese Frage stellt sich notwendiger Weise bei c. 1389 CIC n.F., hält man sich den wohl weiteren Umfang im noch geltenden Recht und den zugleich fast unveränderten Text im zukünftigen Sanktionsrecht vor Augen. Der Zuschnitt auf die Sakramente im neuen Titel III war schon im Entwurf zur Reform des kirchlichen Sanktionsrecht von 2011 angedacht (Synopse der Kanones [lat.]) und auch dort war bereits die nun bevorstehende Veränderung in systematischer Hinsicht vorgesehen. In seiner Einführung zum Schema/2011 hatte der Päpstliche Rat für die Gesetzestexte vermerkt, dass der Titel bewusst den Sakramenten vorbehalten sei, da diese eine besondere Bedeutung für das kirchliche Leben haben (PCLT, Schema recognitionis Libri VI Codicis Iuris Canonici [Reservatum], Typis Vaticanis 2011, Praenotanda, 13). Dies spricht doch sehr dafür, dass die veränderte Systematik und der neue Fokus auf das Schutzgut „Sakramente“ auch Auswirkungen auf die – nochmals nach c. 18 CIC: notwendig enge – Auslegung der Tatbestandsmerkmale „priesterliche Aufgabe“ und „anderer geistlicher Dienst“ haben soll. Diese können nun nur noch im Rahmen von (klerikalen) Aufgaben und Diensten bei Sakramentenfeiern näher bestimmt werden. Diese Auslegung wird zudem dadurch bestärkt, dass die von den cc. 1379–1388 CIC n.F. genannten Tatbestände sich ausschließlich auf Delikte im Rahmen sakramentaler Feiern beziehen. Das bedeutet wohl, dass aus dem Reigen der bisherigen Literaturbeispiele zumindest die Beerdigung einer Person, der ein kirchliches Begräbnis verweigert werden muss (c. 1184 CIC) herausfällt, insofern die Beerdigung kein Sakrament ist. Was den unrechtmäßigen Predigtdienst angeht, mag wohl diskutiert werden können, ob hier die Homilie durch Laien nicht weiterhin unter c. 1389 CIC n.F. fällt, da die Homilie integraler Bestandteil der Eucharistiefeier ist, obwohl die rechtliche Regelung im CIC/1983 nicht im Sakramentenrecht, sondern im Verkündigungsrecht angesiedelt ist (c. 767 CIC).
Zum Abschluss bleibt wohl vor allem die Beobachtung, dass dies alles durchaus lange Ausführungen für eine in sich doch recht kurze und vergleichsweise unscheinbare Norm sind. Und genau das mag ein gutes Beispiel für Stärken sowie Problematiken von Auffangnormen im Allgemeinen und besonders im Bereich des Sanktionsrechts sein. Denn zum einen gilt: Umso größer der Auslegungsaufwand auf Seiten des konkreten Rechtsanwendungsorgans, umso wahrscheinlicher werden Fehler, die Gefahr von Ungleichbehandlung oder schlimmstenfalls die missbräuchliche Anwendung. Zum anderen muss der Gesetzgeber dieses Risiko teils eingehen, um im Gegenzug eine bestmögliche Flexibilität der Rechtsordnung zu erreichen, die adäquate und letztlich auch gerechte Entscheidungen im Einzelfall ermöglicht. Dies ist gerade im kirchlichen Recht unverzichtbar, da es hier immer darum gehen muss, dass die Glaubenswege und das christliche Leben aller Beteiligten ermöglicht, geschützt und gefördert werden und die kirchliche Gemeinschaft nicht gefährdet wird. Kirchliches Sanktionsrecht ist hierbei einer der sensibelsten Bereiche für diese Zielsetzung, weil es dort immer um Eingriffe in die Rechte von Einzelnen in Abwägung zu Eingriffen in (und möglichen Schäden für) das kirchliche Leben geht. Der Grundsatz, dass gerade Sanktionsnormen hinreichend bestimmt sein müssen, um Rechtssicherheit innerhalb der Gemeinschaft zu verwirklichen, muss besonders auch deswegen Geltung haben. Zumindest zu einem Teil scheint hier die Reform des kirchlichen Sanktionsrechts mit Blick auf c. 1389 CIC n.F. (c. 1384 CIC a.F.) einen guten Beitrag zu leisten, indem die neue Titelüberschrift dazu verhilft, dass die unbestimmten Rechtsbegriffe klarer zu umgrenzen sind.
C. 220: „Nemini licet bonam famam, qua quis gaudet, illegitime laedere, nec ius cuiusque personae ad propriam intimitatem tuendam violare.“
C. 220: „Niemand darf den guten Ruf, den jemand hat, rechtswidrig schädigen noch das Recht einer jeden Person auf den Schutz der eigenen Intimsphäre verletzen.“
von Martina Tollkühn
Am 24. Mai 2018 und damit einen Tag vor dem Inkrafttreten der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (= DS-GVO) trat das Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (Kirchliches Datenschutzgesetz; KDG) in der Fassung des einstimmigen Beschlusses der Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands v. 20.11.2017 (Abdruck u.a. in: Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Rottenburg-Stuttgart 62 (2018), Nr. 4, 69–94) in den deutschen Diözesen in Kraft und löste damit die bisher geltende Anordnung über den kirchlichen Datenschutz (KDO) ab. Nun, am 24. Mai 2021 und damit drei Jahre später, steht die erste Überprüfung des Kirchlichen Datenschutzgesetzes an. Diese legte schon das Gesetz selbst unter § 58 Abs. 2 KDG fest.
Das Datum bietet einen guten Anhaltspunkt, den Blick auf das Thema Datenschutz zu lenken. Aber warum haben die deutschen Bistümer eigene Regelungen zum Datenschutz? Und was hat das mit dem c. 220 CIC/1983 zu tun? Die Kurzformel auf diese Fragen könnte sein: Weil sie sollen, weil sie können und weil sie wollen.
Zuerst zum Sollen
Die ersten Möglichkeiten, Informationen und Daten anders als nur handgeschrieben zu erstellen und zu archivieren, führte dazu, dass sich viel mehr Daten ansammelten. Aber wie sollte man damit umgehen, dass man nun relativ einfach viele Informationen über Gruppen oder einzelne Personen sammeln konnte? Als gesetzliche Regelung wurden in den 1970-er Jahren Regelungen gesucht, um den Schutz der Informationen besser zu regeln. Daraus entstand 1977 das erste Bundesdatenschutzgesetz (= BDSG; vgl. Gesetz zum Schutz vor Mißbrauch personenbezogener Daten bei der Datenverarbeitung vom 27. Januar 1977 [Bundesdatenschutzgesetz]: BGBl. Teil I [1977] 201–214). Gleichzeitig mit dem BDSG führten auch die deutschen Diözesen ihre erste Anordnung über den kirchlichen Datenschutz ein (vgl. Anordnung über den kirchlichen Datenschutz – KDO v. 15.12.1977: Datenschutz- und Melderecht in der katholischen Kirche in den Diözesen der Bundesrepublik Deutschland und in der Diözese Berlin für Berlin [West], hg. v. Sekretariat der DBK, Bonn 1979 [AH 15], 4–13), welche von den Bischöfen für ihre Diözesen zum 1. Januar 1978 in Kraft gesetzt wurde. Die Kirche ist also in der Regelung des Datenschutzes eine „Akteurin erster Stunde“. Wie ist es im BDSG geregelt, dass die Kirchen nicht erfasst sind? Diese Ausnahme wird nirgendwo im Text vermerkt, sondern ist vielmehr durch Ausschlussverfahren zu ermitteln. Das Bundesdatenschutzgesetz nennt als öffentliche Adressaten in § 1 BDSG a.F. öffentliche Stellen des Bundes, wozu Behörden, öffentlich-rechtliche Bundeseinrichtungen, bundesunmittelbare Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts gezählt werden.
Alle nicht öffentlichen Stellen, die über den privaten Bereich hinaus personenbezogene Daten in irgendeiner Weise nutzen, unterliegen dem BDSG a. F. auf dieselbe Weise. Nun sind die Kirchen zwar öffentlich-rechtlich Körperschaften, aber eben keine staatlichen Körperschaften. Allerdings sind sie somit auch keine Akteure des privaten Bereichs. Diese Auslassung bestand schon bei der ersten Fassung des BDSG und wurde bis zur letzten Version, die durch die europäische Datenschutz-Grundverordnung abgelöst wurde, nicht verändert. Natürlich fiel diese Lücke schon früh auf. In der Wissenschaft setzte sich dafür der Ausdruck vom „beredten Schweigen“ durch. Man sagt etwas, indem man es nicht sagt. Sind die Religionsgemeinschaften also gänzlich von den Vorgaben des BDSG ausgeklammert? Nicht ganz. Unter § 15 Abs. 4 BDSG a.F. wird unter der Überschrift „Datenübermittlung an öffentliche Stellen“ auch eine Datenübermittlung an kirchliche Stellen geregelt. Dies zeigt einerseits, welcher Seite das Gesetz die Kirche eher zuordnet. Andererseits regelt besagter Paragraf, was von kirchlichen Vorgaben zum Datenschutz erwartet wird, damit ein solcher Austausch zustande kommen kann: Die kirchlichen Regelungen zum Datenschutz müssen das gleiche Schutzniveau erreichen wie die staatlichen. Der Ausformung der KDO waren also von Anfang an gewisse Erwartungen auferlegt und so verwundert es nicht, dass beide Gesetze sich inhaltlich sehr ähnlich lesen.
Zum Können
Dass die Kirchen diese vermeintlich seltsame Stellung als nichtstaatliche Körperschaften des öffentlichen Rechts innehaben (vgl. Art. 137 Abs. 5 WRV), entwickelte sich und wurde in der Weimarer Reichsverfassung von 1919 schließlich in Gesetzesform gegossen. Bei der Verfassung des Grundgesetzes entschied man sich dazu, diese Besonderheit schlicht zu übernehmen und die Vorgaben der WRV durch Art. 140 GG ins Grundgesetz einzufügen. Neben dem Grundrecht auf Religionsfreiheit wird den Kirchen damit zugestanden, dass sie ähnlich wie staatliche Körperschaften z.B. Beamte ernennen können. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang der Art. 137 Abs. 3 WRV (der aber für alle Religionsgemeinschaften gilt): Die Religionsgemeinschaften dürfen innerhalb gewisser staatlicher Grenzen ihre eigenen Angelegenheiten selbstständig regeln. Durch die KDO wird deutlich, dass die Kirche den innerkirchlichen Datenschutz für eine ebensolche hält. Aufgabe des Datenschutzes ist es, also die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten bei der Verarbeitung dieser Daten zu schützen.
Zum Wollen
Hier verbirgt sich die Antwort auf die zweite zu Anfang gestellte Frage: Was hat der c. 220 CIC/1983 mit dem Thema Datenschutz zu tun?
Aus dem c. 220 CIC/1983 speist sich die Begründung für den innerkirchlichen Datenschutz. Zwar findet sich in den Texten des II. Vatikanischen Konzils noch keine Erwähnung zum Datenschutz, wohl aber war auch den Konzilsvätern klar, dass nicht alle Informationen, die der einzelnen Person zukommen oder die es über sie zu wissen gibt, ebenfalls Informationen sind, die die gesellschaftliche Öffentlichkeit zu wissen einen Anspruch hat. Es besteht also hinsichtlich der gesellschaftlichen Öffentlichkeit und der einzelnen Person – deren Würde und daraus folgende Rechte das Konzil mehrfach betont – eine (wenn inzwischen wohl fließende) Unterscheidung, was den Zugang zu privaten Informationen angeht.
Die Konzilstexte beinhalten mehrere Ansatzpunkte, die um den Persönlichkeitsschutz kreisen: So wird im Dekret über die sozialen Kommunikationsmittel „Inter Mirifica“ 5 (vgl. AAS 56 [1964] 145–157; dt. Übersetzung hier) auf ein nicht unbeschränktes Recht des einzelnen auf Information hingewiesen. Die Pastoralkonstitution „Gaudium et Spes“ 26 (vgl. AAS 58 [1966] 1025–1115; dt. Übersetzung hier) übernimmt aus der Enzyklika „Pacem in Terris“ (vgl. Johannes XXIII., Litterae encyclicae. De pace omnium gentium in veritate, iustitia, caritate, libertate constituenda „Pacem in terris“ v. 11.4.1963: AAS 55 [1963] 257–304, 260: „homo praeterea iure naturae postulat, ut in debito habeatur honore; ut bona existimatione afficiatur […]; dt. Übersetzung hier) das Recht auf den Schutz der „vita privata“ und betont die Wahrung des guten Rufs. Zwischen „vita privata“ und einem Schutz der Intimsphäre jeder Person wird hier nicht unterschieden. Für spätere Kommentatoren ist aber klar, dass auch dieses Recht hier mitgemeint ist. Einen weiteren Impuls für die Entwicklung des Rechts auf Persönlichkeitsschutz lieferte die Pastoralinstruktion „Communio et progressio“ (vgl. Päpstlicher Rat für die sozialen Kommunikationsmittel, Pastoralinstruktion „Communio et progressio“ v. 31.8.1971: AAS 63 [1971] 593–656, 609; dt. Übersetzung hier). Diese schon durch IM 23 vorgesehene Instruktion nennt in Nr. 42 verschiedene Rechte in Bezug auf den Persönlichkeitsschutz, wie das Recht auf Information, das Recht auf den Schutz des guten Rufs und das Recht auf den Schutz der Intimsphäre des Einzelnen sowie der Familie. Die einzelnen Rechte werden aufgezählt, bleiben aber unverbunden nebeneinander stehen.
Bis er in der heutigen Form gefasst wurde, durchlief der c. 220 CIC/1983 einige Stufen und Änderungen. Die Kodexredaktion behandelte die verschiedenen Ansätze zum Persönlichkeitsschutz zuerst in verschiedenen Untergruppen, weil man die Bedeutung eines solchen Rechts in verschiedenen Bereichen sah, so z.B. in den Orden oder den Seminaren. Außerdem beschäftigte sich auch die Gruppe, die an einem Grundgesetz der Kirche, einer „Lex ecclesiae fundamentalis“ (= LEF) arbeitete, mit diesem Recht. Nachdem das Projekt LEF auf Eis gelegt wurde (wo es heute noch liegt), wurden einige wichtige Grundrechte und -pflichten in die anderen Textentwürfe übernommen. Zu diesen übernommenen Rechten zählte auch ein Kanon zum Schutz des guten Rufs, wie er schon im Vorgängergesetzbuch, dem CIC/1917, vorhanden war. Der can. 2355 CIC/1917 verbot die Beschädigung des guten Rufs („bona fama“) durch Äußerungen, Handlungen und sonstige mögliche Akte. Die Schädigung war mit einer Strafe bis hin zum Ämterentzug bei Klerikern belastet. Das Konzept der „infamia“ aus cann. 2293-2295 CIC/1917 war in dieser Form eher ein Instrument für gutes und schlechtes Verhalten. Die „infamia iuris“ wurde als offizielle Sühnestrafe verhängt und zog nach can. 2294 CIC/1917 eine Reihe von Rechtsfolgen wie die Unfähigkeit zur Erlangung von Benefizien nach sich. Bei wem offiziell festgestellt wurde, dass der gute Ruf durch bestimmtes Tun oder schlechten Lebenswandel beschädigt war („infamia facti“), der konnte nach can. 2294 CIC/1917 z.B. von kirchlichen Ehrenämtern ausgeschlossen werden, bis sein guter Ruf wieder hergestellt und das von offizieller Seite goutiert war. Im CIC/1983 sollte der Schutz des guten Rufs dagegen als ein Persönlichkeitsrecht aufgefasst werden, dass dem Einzelnen aus der Taufe her unverlierbar zukommt. Der c. 220 CIC/1983 gehört also in den Kreis der Grundrechte.
Der zweite Teil des c. 220 CIC/1983 zum Schutz der Intimsphäre wurde erst bei der Schlussredaktion, also kurz vor der Promulgation des CIC/1938, in den Kanon eingefügt. Obwohl hier zwei unterschiedliche Aspekte zum Persönlichkeitsschutz zusammengefügt sind, lässt sich ihr innerer Zusammenhang, der ja lose schon in „Communio et progressio” 42 (vgl. AAS 63 [1971] 593–656, 609; dt. Übersetzung hier) aufscheint, gut erkennen. Leider wurde aber die Idee der Studiengruppe, dem Recht auch damit korrespondierende Pflicht („correlativa obligatio“) beizufügen, nicht weiterverfolgt (vgl. Comm 17 [1985] 220). Wenn der gute Ruf einer Person verletzt wird, geschieht damit gleichzeitig eine Verletzung des Rechts auf Intimsphäre. Wichtig ist dabei aber zu betonen, dass es nur um eine rechtswidrige („illegitime“) Verletzung geht. Beispielsweise kann es nach dem Begehen einer Straftat nicht unterlassen werden, einen rechtmäßig Verurteilten auch zu nennen. Ein guter Ruf gründet auf den Vertrauensvorschuss, dass eine Person sich moralisch gut und gesetzestreu verhält – für glaubwürdiges Handeln und die Erfüllung der Seelsorge eine existentielle Voraussetzung. Verhält sie sich erwiesener Weise nicht so, kann dieser gute Ruf nicht aus falscher Rücksichtnahme bestehen bleiben.
Der Adressat dieses Grundrechts ist mit der Festlegung auf die Getauften zu eng gefasst. Schon der Text des c. 220 CIC/1983 spricht hier nicht vom „christifidelis“, sondern von „nemini“, „qui“ und „cuiusque personae“. Der Päpstliche Rat für die Gesetzestexte wies 2016 eindeutig darauf hin, dass c. 220 CIC/1983 im Naturrecht wurzelt und so die Diffamierung jeder Person (also „ius cuiusque personae“) oder die unrechtmäßige Verletzung ihrer Privatsphäre verbietet (vgl. PCLT, Protocollo Numero 15512/2016, Pubblicazione dell’elenco dei chierici condannati per reati v. 15.09.2016; engl. Übersetzung hier). Da die Vorgaben zum Naturrecht innerhalb des CIC/1983 aber gemäß c. 1 CIC/1983 nur die Angehörigen der lateinischen Kirche binden, kann es sich für alle anderen nicht um ein direktes Verbot handeln, sondern eher eine moralische Verpflichtung.
Der Schutz der Persönlichkeit enthält als Teilaspekt den Schutz der personenbezogenen Daten einer Person, weshalb der c. 220 CIC/1983 kurz auch als Recht auf Datenschutz verstanden werden kann. Diesen Gedanken nahm die Deutsche Bischofskonferenz in ihren Aussagen zur Medienbildung auf, als sie betonte, dass die Würde des Menschen auch durch den Schutz seiner Daten bewahrt werden müsse. Das Ziel des Datenschutzes sieht sie deshalb darin, „die Personalität und die Sozialität des Menschen als Ebenbild Gottes bewusst zu erkennen, zu erhalten, zur Entfaltung zu bringen und bei Bedarf auch zu verteidigen“ (Medienbildung und Teilhabegerechtigkeit. Impulse der Publizistischen Kommission der DBK zu den Herausforderungen der Digitalisierung, hg. v. Sekretariat der DBK, Bonn 2016 [AH 288], 10). Diese theologischen und gesamtkirchlichen Grundlagen bilden eine eigene kirchliche Begründung, warum die Kirche sich für den Datenschutz engagieren soll und es in Form des KDG in den deutschen Bistümern auch tut.
In der Arbeitshilfe „Kirchliches Datenschutzrecht vom 1. Februar 2021 bekräftigt die DBK nochmals die Bedeutung dieses Kanons für den kircheneigenen Datenschutz: „Für die katholische Kirche ist der Schutz der personenbezogenen Daten ein unverzichtbarer Bestandteil des in can. 220 des Codex Iuris Canonici (CIC) anerkannten Rechts auf den ‚Schutz des guten Rufes und der Intimsphäre‘“ (Kirchliches Datenschutzrecht, hg. v. Sekretariat der DBK, Bonn 2021 [AH 320], 7 f.).
Die Überprüfung des KDG zum 24. Mai 2021 ergab übrigens, dass mit einer geänderten Fassung noch zwei Jahre, also bis 2023 gewartet werden kann. So werden die bisherigen Erfahrungen evaluiert und dann eingefügt. Die Angst für einem überbordenden Datenschutzregime ist abgeflaut und weicht einem unaufgeregteren Dialog. Vorschläge für die Fassung von 2023 können also eingereicht werden, denn auch für den Datenschutz gilt: „lex semper reformanda“.
c. 573 § 1: „Vita consecrata per consiliorum evangelicorum professionem est stabilis vivendi forma qua fideles, Christum sub actione Spiritus Sancti pressius sequentes, Deo summe dilecto totaliter dedicantur, ut, in Eius honorem atque Ecclesiae aedificationem mundique salutem novo et peculiari titulo dediti, caritatis perfectionem in servitio Regni Dei consequantur et, praeclarum in Ecclesia signum effecti, caelestem gloriam praenuntient.“
c. 573 § 1: „Das durch die Profess der evangelischen Räte geweihte Leben besteht in einer auf Dauer angelegten Lebensweise, in der Gläubige unter Leitung des Heiligen Geistes in besonders enger Nachfolge Christi sich Gott, dem höchstgeliebten, gänzlich hingeben und zu seiner Verherrlichung wie auch zur Auferbauung der Kirche und zum Heil der Welt eine neue und besondere Bindung eingehen, um im Dienste am Reich Gottes zur vollkommenen Liebe zu gelangen und, ein strahlendes Zeichen in der Kirche geworden, die himmlische Herrlichkeit ankündigen.“
von Martin Rehak
Die großen kirchenrechtlichen Rechtssammlungen des 13./14. Jh., wie sie im Corpus Iuris Canonici versammelt sind, wurden jeweils im ersten Titel des ersten Buchs programmatisch mit einem „dogmatischen“ Abschnitt eröffnet, wobei dieser Titel die Überschrift „de Summa Trinitate et fide catholica (dt.: Über die Höchste Dreifaltigkeit und den katholischen Glauben)“ trug; vgl. dazu X 1.1; VI° 1.1; Clem. 1.1 (= Friedberg, Bd. 2, 5–7; 937; 1133 f.).
Wie aber ist es im Vergleich dazu um die Präsenz des dreieinen Gottes im kodikarischen Kirchenrecht des CIC/1983 bestellt? Eine erste Durchsicht führt zu dem (wenig überraschenden) Befund, dass Gott-Vater, soweit ersichtlich, kein expliziter Gegenstand des kodikarischen Rechts ist; jedoch wird die Vaterschaft Gottes zumindest indirekt in c. 604 § 1 zum Thema, insofern dort Christus als der Sohn Gottes bezeichnet wird. Dagegen ließe sich eine umfangreiche Liste an Kanones zusammenstellen, in denen von Gott-Sohn die Rede ist, und zwar zumeist unter der Bezeichnung als „Christus“. Doch was lässt sich schließlich über die dritte Person der göttlichen Trinität sagen, Gott-Heiliger Geist?
Das Kirchenrecht sieht sich ja bisweilen dem Verdacht ausgesetzt, pneumatologisch unterbelichtet eine ziemlich Geist-freie Veranstaltung zu sein. So hat beispielsweise Winfried Aymans in Aymans–Mörsdorf, KanR III, 182, kritisch zu c. 840 CIC sowie zu den theologischen Leitkanones zu den Einzelsakramenten (cc. 849; 879, der insoweit aber extra chorum steht; 897; 898; 959; 998; 1008) bemerkt, dass sie „so gut wie keine Aussage über das Wirken des Heiligen Geistes im sakramentalen Geschehen enthalten“, obwohl „alles sakramentale Handeln […] Frucht des Heiligen Geistes [ist], der der Geist Christi ist“. Und Michael Böhnke, Kirche in der Glaubenskrise, 63, hat im Anschluss an Louis Bouyer die These aufgestellt, dass „[d]as Fehlen einer für die Strukturen der Kirche relevanten Pneumatologie bedingt, dass das Wirken des Geistes keine kanonistischen Konsequenzen zeitigen konnte und kann“. Bekannt ist schließlich auch – um etwas konkreter zu werden –, dass etwa c. 205 CIC zwar das theologische Textmaterial aus Nr. 14 der Kirchenkonstitution Lumen Gentium des Zweiten Vatikanischen Konzils verwertet, dabei aber insbesondere die Klausel „Spiritum Christi habentes“ zur näheren Charakterisierung der Getauften auslässt (vgl. AAS 57 [1965] 5–75, hier 18 f.; dt. Übersetzung hier).
Kommt also in den Kanones des kodikarischen Rechts das Geistliche zu kurz? Ist das Kirchenrecht gleichsam von allen guten Geistern verlassen?
In einem Streifzug durch das kodikarische Recht lässt sich zunächst feststellen, dass die Vokabel „geistlich“ durchaus mit einer gewissen Regelmäßigkeit begegnet. So ist wiederholt vom geistlichen Amt und geistlichen Amtsträgern, dem geistlichen Stand, geistlichen Hirten, geistlichen Diensten die Rede. Die gewandelten eucharistischen Gaben werden gemäß einem geprägten Bild als geistliche Speise bezeichnet. Das Kirchenrecht thematisiert außerdem das geistliche Leben, geistliche Exerzitien und Einkehr(tage), geistliche Bildung, das geistliche Wohl, geistliche Güter ebenso wie geistliche Werke, ferner geistliche Handlungen und Angelegenheiten. Es möchte geistliche Hilfen gewährleisten und fragt nach dem geistlichen Nutzen.
Es wäre eine eigene Betrachtung wert, ob so viel Geistlichkeit ohne den Hauch des Pneuma sinnvoll gedacht werden kann. (Jedenfalls hinsichtlich der Eucharistie sicher nicht, wie die Bedeutung der Epi-klese für ein funktionierendes eucharistisches Hochgebet beweist.)
Desweiteren wird in etlichen Kanones ein bestimmter „Spirit“ (spiritus, Geist) angesprochen und eingefordert, sei es ganz allgemein ein christlicher Geist, sei es spezifischer etwa der Geist des Evangeliums, der Geist des Gebets, der Geist eines Ordensinstituts bzw. seiner Stifterin oder seines Stifters, ein apostolischer bzw. missionarischer Geist, sowie last but not least der Geist des Dienens.
Doch auch der Heilige Geist selbst begegnet bei aufmerksamer Lektüre in nicht weniger als sieben Kanones. So merkt c. 206 § 1 beiläufig an, dass die Katechumenen vom Heiligen Geist geleitet sind. Über die Diözese hält c. 369 fest, dass sie vom Bischof durch das Evangelium und die Eucharistie im Heiligen Geist zusammengeführt wird. Über die Bischöfe lehrt c. 375 § 1, dass sie kraft göttlicher Einsetzung durch den Heiligen Geist, der ihnen geschenkt ist, an die Stelle der Apostel treten. Das geweihte Leben wird in c. 573 § 1 dahingehend charakterisiert, dass sich Gläubige unter der Leitung des Heiligen Geistes in eine besondere Christus-Nachfolge begeben, um sich so total Gott zu widmen und ihn zu verherrlichen. Damit ist c. 573 § 1 zugleich jene Norm, in der das trinitarische Gottesverständnis der christlichen Glaubenslehre noch am deutlichsten zur Sprache kommt. Indem c. 605 die Möglichkeit neuer, in der spirituellen und aszetischen Tradition der Kirche bislang unbekannter Formen des geweihten Lebens für grundsätzlich vorhanden erklärt, wird den Diözesanbischöfen die Aufgabe der geistlichen Unterscheidung zugewiesen, um neue, der Kirche vom Heiligen Geist anvertraute Gaben des geweihten Lebens zu erkennen. In c. 747 § 1 referiert der Gesetzgeber die aus der Dogmatischen Konstitution Pastor Aeternus des Ersten Vatikanischen Konzils bekannte Lehre von der negativen Assistenz des Heiligen Geistes in Bezug auf die Weitergabe der Offenbarung (vgl. ASS 6 [1870/71] 40–48; auch DH 3070; dt. Übersetzung hier). Und schließlich verkündet c. 879, dass das Firmsakrament die Getauften mit der Gabe des Heiligen Geistes beschenkt.
Analysiert man die Funktionen, die dem Heiligen Geist in den genannten Kanones zugeschrieben werden, ist folgendes auffällig:
In c. 369 wird dem Heiligen Geist irgendwie eine kirchenbildende Rolle zugeschrieben. In der theologischen Reflexion des Textes erscheint beachtenswert, dass erstens seine genaue Rolle (als „Erstursache“?) hinter den „Zweitursachen“ – Gottesvolk, Hirtentätigkeit des Bischofs, Verkündung des Evangeliums, Feier der Eucharistie – zurücktritt; und zweitens die ausdrückliche Nennung der Eucharistie erahnen lässt, dass man „Gründonnerstag“ und „Pfingsten“ als Geburtsstunde der Kirche schwerlich gegeneinander ausspielen kann.
In zwei Kanones wird betont, dass der Heilige Geist eine geschenkte Gabe sei (cc. 375, 879). Demgegenüber begegnet er in c. 605 selbst als Schenkender. In der theologischen Reflexion wird man wohl sagen können, dass damit diese kirchenrechtlichen Textstücke die paradoxe Unverfügbarkeit Gottes sehr angemessen zum Ausdruck bringen.
In den cc. 206, 573 wird dem Heiligen Geist die Funktion der (An-)Leitung zugeschrieben. In etwa dieselbe Funktion, wenn auch kontextbedingt mit speziellerem Zuschnitt, begegnet aber auch in c. 747 § 1. In der theologischen Reflexion ist interessant, dass die Adressat*innen der göttlichen (An-)Leitung in allen drei Kanones gerade nicht nur die kirchlichen Amtsträger sind – sondern in c. 206 die Katechumenen, in c. 573 § 1 die Ordensleute, und in c. 747 § 1 ganz allgemein „die Kirche“. Dies ist zum einen deshalb bemerkenswert, weil im bereits genannten dogmatischen Quellentext zu c. 747 § 1 keineswegs der Kirche, sondern einzig und allein dem Papst als Nachfolger Petri der Beistand des Heiligen Geistes zugesagt wird (vgl. nochmals ASS 6 [1870/71] 40–48; DH 3070; dt. Übersetzung hier). Dies ist zum anderen auch deshalb interessant, weil im Zuge der vatikanischen Liturgiereform die Spendeformel für die Bischofsweihe bekanntlich in Anlehnung an jenes Weihegebet für den Bischof verändert wurde, welches in der Traditio Apostolica aus dem 3. Jh. niedergeschrieben ist. Darin wird Gott angefleht, auf den Weihekandidaten jenen „Spiritum principalem“, jenen „Geist der Leitung“ herabzusenden, den er zuvor schon über Jesus Christus und nach ihm über den Aposteln ausgegossen hatte (vgl. dazu Paul VI., Apostolische Konstitution Pontificalis Romani vom 18.06.1968, in: AAS 60 (1968) 369–373, hier 373; dt. Übersetzung hier).
Wie aber kommt es und hat es einen tieferen Sinn, dass ausgerechnet (auch) in c. 573 § 1 der Heilige Geist eigens angesprochen ist? Hat doch Rudolf Henseler CSsR in seiner Kommentierung der hier als Aufhänger unserer theologischen Betrachtungen gewählten Norm geurteilt, dass dieser „theologisch überfrachtete Kanon […] erst von seinem sprachlichen Ballast befreit werden [muss], bis er jene Aussagen frei gibt, die einer rechtlichen Betrachtungsweise zugänglich sind“, vgl. MKCIC–Henseler, c. 573, Rz. 1. (Des einen Uhl, des andern Nachtigall.) In der Tat besteht hier ein krasser Unterschied zwischen can. 487 CIC/1917 als Einstiegsnorm in das Ordensrecht des alten Kodex und c. 573 § 1, wobei freilich schon can. 487 CIC/1917 zwei der drei Punkte benannte, die von Henseler als der rechtliche Gehalt aus beiden Paragraphen des c. 573 herausgestellt werden: Ordensleben als stabile Lebensform („Status religiosus seu stabilis in communi vivendi modus …“ bzw. „Vita consecrata […] est stabilis vivendi forma …“). Bindung an die evangelischen Räte des Gehorsams, der Keuschheit und der Armut durch Gelübde („evangelica quoque consilia servanda per vota oboedientiae, castitatis et paupertatis“), im CIC/1983 erst im § 2 des c. 573 angesprochen („qui per vota aut alia sacra ligamina […] consilia evangelica castitatis, paupertatis et oboedientiae profitentur“). Das Material für die von Henseler kritisierte theologische Anreicherung findet sich dann übrigens vor allem in Nrn. 5–6 des Konzilsdekrets Perfectae caritatis über die Erneuerung des Ordenslebens vom 28.10.1965, in: AAS 58 (1966) 702–712, hier 704 f. (dt. Übersetzung hier). Dabei wiederum fällt bei genauem Hinsehen auf, dass vom Heiligen Geist zwar an verschiedenen Stellen dieses Konzilsdekrets die Rede ist, nicht jedoch in den besagten Nrn. 5–6. Vielleicht lässt sich dieser Befund zu der allgemeinen Erkenntnis entfalten, dass die „theologischen“ Themen des c. 573 § 1 – näherhin eine besondere Christusnachfolge nebst totaler Hingabe an Gott einerseits, die Auferbauung der Kirche und das Heil der Welt andererseits – Aufgaben sind, bei deren Bearbeitung der Christ in besonderer Weise des Heiligen Geistes bedürftig ist.
Allerdings benennt die von der Päpstlichen Kommission für die authentische Interpretation des CIC (jetzt: Päpstlicher Rat für die Gesetzestexte) herausgegebene Ausgabe des Codex Iuris Canonic fontium annotatione als weitere konziliare Quellen für den Text des c. 573 § 1 noch die Nrn. 42–44 von Lumen Gentium (vgl. AAS 57 [1965] 5–75, hier 47–51; dt. Übersetzung hier), wobei in jeder Nummer der Heilige Geist ausdrücklich erwähnt wird (vgl. näherhin LG 42,1; 43,1; 44,3); die Nr. 33 des Dekrets Christus Dominus über die Hirtenaufgabe der Bischöfe (vgl. AAS 58 [1966] 673–696, hier 690; dt. Übersetzung hier), wo der Heilige Geist nicht erwähnt wird; sowie Nr. 1 des bereits angesprochenen Dekrets Perfectae caritatis (vgl. AAS 58 [1966] 702–712, hier 702; dt. Übersetzung hier), wo der Heilige Geist erneut erwähnt wird (vgl. näherhin PC 1,2).
Welchen Sinn und welche Bedeutung hat nach alledem die Nennung des Heiligen Geistes im kodikarischen Kirchenrecht? Für eine erste Antwort auf diese Frage ist es sinnvoll, zunächst noch den Blick zu weiten und auch die Rechts(erkenntnis)quellen der übrigen „Hl.-Geist-Kanones“ zu untersuchen.
Zu c. 206 § 1 ist insoweit festzustellen, dass diese Norm bis in den genauen Wortlaut („Catechumeni qui, Spiritu Sancto movente, explicita voluntate ut [Ecclesiae] incorporetur expetunt, […] hoc ipso voto […] [cum ea coniunguntur]“) hinein auf LG 14,3 zurückgreift (vgl. AAS 57 [1965] 5–75, hier 19; dt. Übersetzung hier). Hinsichtlich c. 369 gilt, dass dieser Kanon wortwörtlich den ersten Absatz von Christus Dominus, Nr. 11 (vgl. AAS 58 [1966] 673–696, hier 677; dt. Übersetzung hier), abschreibt. Ebenso leicht wird man betreffs c. 375 fündig: In Christus Dominus, Nr. 2,2 (vgl. ebd., 674), heißt es: „Episcopi […], positi a Spiritu Sancto, in Apostolorum locum succedunt“. Dagegen findet sich die spezifische Wendung „nova […] dona a Spiritu Sancto Ecclesiae concredita“ aus c. 605 weder in den konziliaren noch in den nachkonziliaren Quellen dieser Norm (LG 45; PC 1, 19; AG 18; Instruktion Renovationis causam vom 06.01.1969 [vgl. AAS 61 {1969} 103–120; dt. Übersetzung hier]; Instruktion Mutuae relationes vom 14.051978 [vgl. AAS 70 {1978} 473–506; dt. Übersetzung hier]).
Dies berechtigt wohl zu folgenden Schlussfolgerungen: Während in c. 879 der Heilige Geist aus Sachgründen ein unverzichtbares Thema ist, lässt sich die Erwähnung der dritten Person der göttlichen Trinität in den cc. 206 § 1, 369, 376, 573 § 1 und 747 § 1 am einfachsten damit erklären, dass der Heilige Geist bereits zuvor in den bei der Formulierung der Norm ausgewerteten lehramtlichen Quellentexten genannt worden war. Insofern erscheint die Erwähnung des Heiligen Geistes im Kodex also als zufällig und wenig originell. Gleichwohl ist umgekehrt zur Kenntnis zu nehmen, dass der Gesetzgeber die Erwähnung des Heiligen Geistes jeweils für derart bedeutsam erachtet hat, dass dieser „spirituelle Überbau“ doch als integrierender Bestandteil einer theologisch stimmigen Aussage angesehen wurde. Betrachtet man die Situationen, in denen ausweislich der genannten Lehramts- und Rechtstexte der Geist wirkt, so ist zum einen von Situationen die Rede, die eine persönliche Entscheidung und religiöse Bindung herausfordern (Katechumenat, geweihtes Leben); zum anderen von Situationen, in denen die Kontinuität zwischen Altem und Neuen auf dem Spiel steht (Paradosis des depositum fidei; Verhältnis der Bischöfe zu den Aposteln). Voraussetzungslos Neues hinwiederum entsteht in der Kirche bevorzugt da, wo – wie von c. 605 thematisiert – Gläubige sich auf eine intensive Gottesbeziehung einlassen und diese für die ganze Kirche fruchtbar werden lassen.
Als Gesamtfazit aus dieser Fahndung nach dem Geist im Kodex wird man nach alledem ohne weiteres sagen können: Der Heilige Geist ist und bleibt eine Größe, mit der man als Christ*in immer rechnen muss und rechnen darf – auch im Kirchenrecht.
Das Team des Lehrstuhls für Kirchenrecht wünscht allen Leserinnen und Lesern dieses Beitrags ein frohes, gesundes und gesegnetes Pfingsten 2021 sowie einen schönen Dreifaltigkeitssonntag!
Concilium Arelatense (a. 314), can. 1: „Primo in loco de observatione Paschae dominicae: Ut uno die et uno tempore per omnem orbem a nobis observaretur, ut iuxta consuetudinem litteras ad omnes tu dirigas.“
Synode von Arles (anno 314), can. 1: „An erster Stelle über die Beobachtung des Ostersonntags: Dass Du (sc.: Bischof Silvester von Rom) gemäß der Gewohnheit Briefe an alle richtest, damit er an einem einzigen Tag und zur selben Zeit auf dem ganzen Erdkreis von uns gehalten wird.“
von Martin Rehak
Es scheint ein armseliges Bild innerer Zerstrittenheit gewesen zu sein, das die Christenheit des frühen 4. Jh. für die Öffentlichkeit, soweit interessiert, abgegeben hat. Schon Euseb, hist. eccl. VIII,1, hat den inneren Zustand der Catholica vor Ausbruch der Diokletianischen Christenverfolgung (303–305/311) mit einem Bürgerkrieg verglichen. Neben der heraufziehenden theologischen Auseinandersetzung um die arianische Christologie hatte die Kirche mit den elitären Sektierern des Novatianismus und Donatismus zu kämpfen. Aber auch in der Frage des Ostertermins hatten sich mehrere Parteiungen herausgebildet. Die Quartodezimaner feierten Ostern stets (zusammen mit dem jüdischen Pessach) am 14. Tag des Frühlingsmonats Nisan, also an wechselnden Wochentagen und – der Monat begann bei Neumond – regelmäßig bei Vollmond. Die Protopaschiten dagegen feierten zwar Ostern stets an einem Sonntag, orientierten sich dabei jedoch ohne Rücksicht auf das Frühjahrs-Äquinoktium (Tag-und Nacht-Gleiche) ebenfalls strikt am jüdischen Monatskalender mit der Folge, dass Ostern bisweilen vor dem Äquinoktium gefeiert wurde.
Der römische Kaiser berief daher im Jahre 314 eine Synode ein, die in Arelate, einer Veteranenkolonie in der Provinz Gallia Narbonensis (heute: Arles, Südfrankreich) tagte und die sich hauptsächlich mit dem theologischen und disziplinären Problem des Donatismus in Nordafrika beschäftigte. Die Synodalen verabschiedeten auch eine Reihe von Kanones. Hierunter findet sich als erster Kanon der Synode die älteste kirchenrechtliche Regelung zur Osterfrage (vgl. Charles Munier, Concilia Galliae a. 314 – a. 596 [CCSL 148], Turnhout 1963, 9–13, hier 9; auch abgedruckt in: Johannes Dominicus Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Bd. 2, Florenz 1759, Sp. 471). Ein einheitliches Datum für die Feier des Osterfestes sollte nach alter Gewohnheit dadurch gewährleistet werden, dass der römische Bischof den jährlichen Termin des Osterfestes durch Rundschreiben an alle christlichen Gemeinden auf der ganzen Welt – die damals für die Synodenväter im Wesentlichen mit dem Römischen Reich rund um das Mittelmeer identisch war – ansagt.
Der Rekurs auf die alte Gewohnheit mag Erinnerungen an den so genannten ersten Osterfeststreit Ende des 2. Jh. wecken, als der römische Bischof Viktor – wie Euseb, hist. eccl. V,23 berichtet – den kleinasiatischen Gemeinden verbieten wollte, gemäß dortigem quartodezimanischem Brauch Ostern zu feiern. Er stieß damit auf heftigen Widerstand der Kleinasiaten, die geltend machten, dass die quartodezimanische Praxis ihre apostolische Überlieferung sei und auf die dortigen „Megastars“ (μεγάλα στοιχεῖα, vgl. Euseb, hist. eccl. V,24,2) Philippus und Johannes zurückgeführt werden könne. An dieser Auseinandersetzung, bei der sich Rom nicht durchsetzen konnte, ist nicht zuletzt das vermittelnde Eingreifen des Irenäus von Lyon bemerkenswert. Irenäus gab zu bedenken, dass die unterschiedliche liturgische (Fasten-)Disziplin noch eine Generation zuvor überhaupt kein Problem dargestellt habe, als nämlich Bischof Polykarp von Smyrna nach Rom gekommen war und Bischof Aniket ihm ohne weiteres gestattet hatte, auch in Rom gemäß der kleinasiatischen Disziplin zu fasten und Eucharistie zu feiern (vgl. Euseb, hist. eccl. V,24).
Mit Blick auf die Problemlage ist an can. 1 des Arelatense I bemerkenswert, dass der Kanon auf die inhaltliche Frage, an welchem Tag Ostern zu feiern ist, nur beiläufig eingeht: an einem Sonntag. Es fehlt eine abstrakte Festlegung, welcher Sonntag konkret gemeint ist. Stattdessen wird das Verfahren in den Mittelpunkt gestellt, durch das der konkrete Ostersonntag der Christenheit angezeigt werden soll – nämlich durch eine diesbezügliche Enzyklika (Rundschreiben) des römischen Bischofs.
Ähnliches lässt sich über eine weitere, sehr alte kirchenrechtliche Norm zum Ostertermin, nämlich can. 7 der so genannten Apostolischen Kanones, sagen. Unter der (sekundären) Überschrift „Περὶ τών Ἑβραϊκώς τελούντων τὸ Πάσχα (dt.: Über diejenigen, die das Pascha nach dem jüdischen Kalender feiern)“ heißt es dort: „Eἴ τις ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος ἢ διάκονος τὴν ἁγίαν τοῦ Πάσχα ἡμέραν πρὸ τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας μετὰ Ἰουδαίων ἐπιτελέσοι, καθαιρείσθω (dt.: Wenn ein Bischof oder Presbyter oder Diakon den heiligen Paschatag vor der Tag-und-Nacht-Gleiche des Frühjahrs zusammen mit den Juden feiert, soll er abgesetzt werden)“, vgl. Mansi, Bd. 1, Sp. 29/30. Die Apostolischen Kanones werden zwar in der rechtsgeschichtlichen Systembildung traditionell den pseudoapostolischen Rechtssammlungen zugerechnet, sind aber insofern atypisch, als sie zumeist authentischen Rechtsstoff der kleinasiatischen Konzile und Synoden des 4. Jh. tradieren. Insofern lässt sich can. 7 der Apostolischen Kanones als ein Exzerpt aus can. 1 jener antiochenischen Synode interpretieren, die man früher mit der Enkaeniensynode (Kirchweihsynode) von 341 identifiziert hat, neuerdings aber eher um das Jahr 330 ansetzt. Die fragliche Norm lautet in lateinischer Übersetzung (aus: Périclès-Pierre Joannou, Discipline générale antique (IVe-IXe s.) [CICO-Fontes 9,1,2], Rom 1962, 104 f.; vgl. auch Mansi, Bd. 2, Sp. 1307–1310):
„Omnes qui ausi fuerint dissolvere definitionem sancti et magni concilii, quod apud Nichaeam congregatum est sub praesentia piissimi et venerandissimi principis Constantini de salutifera festivitate sacratissimae pascha, excommunicandos et de ecclesia abiciendos esse censemus, si tamen contentiosius adversus ea, quae bene sunt statuta, perstiterint. Et haec quidem de laicis dicta sint. Si quis autem eorum qui praeesse noscuntur ecclesiae, aut episcopus aut presbiter aut diaconus, post hanc definitionem temptaverit ad subversionem populorum et ecclesiarum perturbationem seorsum colligere et cum Iudaeis pascha caelebrare: sancta synodus hunc iam hinc alienum ab ecclesia iudicavit, qui non solum sibi, sed plurimis causa corruptionis et perturbationis extiterit. Nec solum huiusmodi de ministerio removet, sed illos qui post damnationem talibus communicare temptaverint: damnatos autem etiam omni extrinsecus honore privari, quem sancta regula et sacerdotium dei promeruit.“
Auch in diesen beiden Kanones findet sich keine positive Regelung für das genaue Osterdatum, sondern es wird lediglich eine falsche Praxis, nämlich die protopaschitische und/oder quartodezimanische, mit scharfen Strafdrohungen belegt, die sich vor allem gegen die geweihten kirchlichen Amtsträger richten.
Was aber hat es nun mit dem Verweis auf das Konzil auf sich? Es ist allgemein bekannt, dass Kaiser Konstantin mit dem Konzil von Nikaia im Jahre 325 einen (nach dem Arelatense I) neuerlichen Anlauf nahm, um für einen einheitlichen Osterfesttermin im Reich zu sorgen. Der seinerzeitige Beschluss wurde jedoch nicht unter die 20 authentischen Kanones dieses Konzils aufgenommen. Er wurde lediglich in einem Rundschreiben des Kaisers sowie einem Schreiben der Synode an die Bischöfe Ägyptens und Libyens thematisiert.
Das kaiserliche Rundschreiben (dt. Übersetzung in: Hanns Christof Brennecke u.a. [Hg.], Athanasius Werke, Bd. 3/1/3: Dokumente zur Geschichte des arianischen Streites, Berlin u.a. 2007, 116–118) zeichnet sich durch eine gewisse Weitschweifigkeit und antijüdische Polemik aus. Zur Sachfrage wird ausgeführt: Es sei nicht länger hinnehmbar, dass der eine Teil der Christenheit bereits Ostern feiert, während der andere noch fastet. Die richtige Lösung ergebe sich aus dem Mehrheitsprinzip, nämlich aus dem, was „alle Kirchen aus den westlichen, südlichen und nördlichen Teilen der bewohnten Welt sowie einige der östlichen Orte einhalten“. Ohne sich substantiell zur Terminsberechnung zu äußern, fasst der Kaiser das Wichtigste so zusammen:
„Es hat dem gemeinsamen Urteil aller gefallen, das heiligste Osterfest an ein und demselben Tag zu begehen. Denn es ziemt sich nicht, in einer so heiligen Angelegenheit irgendwelche Differenzen zu haben, und besser ist es, sich genau der Meinung anzuschließen, der keinerlei fremder Irrtum und Verfehlung untergemischt ist.“
Das hier vorgetragene prinzipielle Argument gegen die Quartodezimaner fügt sich nahtlos in den antijüdischen Duktus des gesamten Schreibens. Zutreffend urteilen daher Charles Pietri, Christoph Marschies, Theologische Diskussionen zur Zeit Konstantins […], in: Jean-Marie Mayeur u.a. (Hg.), Geschichte des Christentums, Bd. 2, Freiburg i.Br. u.a. 1996, 271–344, hier 317: Das Konzil meinte „ein beispielhaftes Zeichen für die Eintracht der Kirche zu setzen; sie tat es freilich auf Kosten ihrer jüdischen Wurzel“.
Ausschließlich in der griechischen Fassung des Synodalschreibens nach Ägypten und Libyen wird am Ende das Evangelium („Eὐαγγελιζόμεθα…“) von einer Übereinkunft über das heilige Osterfest berichtet (vgl. Josef Wohlmuth (Hg.), Conciliorum oecumenicorum decreta, Bd. 1, Paderborn u.a. 31998, 19):
„Dank eurer Gebete kam es auch in diesem Punkt zu einer glücklichen Lösung. Alle Brüder und Schwestern im Osten, die bisher mit den Juden gefeiert haben, werden von jetzt an das Paschafest in Übereinstimmung mit den Römern, mich euch und mit uns allen, die seit Urzeit mit euch [daran] festhalten, feiern.“
Aus dieser Überlieferung sowie den Berichten der Kirchengeschichtsschreiber entstanden in späterer Zeit ps.-nizänische Kanones, wie etwa jener Kanon, den der gelehrte Kardinal Jean-Baptiste Pitra in der Kanonessammlung des Johannes von Konstantinopel entdeckt hat (vgl. Abdruck bei Carl Joseph Hefele, Conciliengeschichte, Bd. 1, Freiburg i.Br. 21873, 332); oder jenes Kapitel 21 der den Konzilsvätern zugeschriebenen Kirchlichen Konstitutionen mit dem Rubrum „De Paschate eodem tempore ab omnibus Christi fidelibus ubique celebrando“, das der gelehrte Theologe und Philologe Abraham Ecchellensis, ein libanesischer Maronit, im 17. Jh. aus dem Arabischen ins Lateinische übersetzt hat (vgl. Mansi, Bd. 2, Sp. 1048).
Ungeachtet der Grundsatzentscheidung des Nicaenum I, dass also Ostern erstens an einem Sonntag und zweitens zeitlich nach dem Frühjahrs-Äquinoktium zu feiern ist, dauerte es indes noch mehr als zwei Jahrhunderte, bis sich tatsächlich ein weltweit einheitlicher Ostertermin durchgesetzt hat. Denn die Schwierigkeiten im Detail begannen schon damit, dass man in Alexandria und Rom das Frühjahrs-Äquinoktium für unterschiedliche Tage bestimmte (Alexandria: 21. März; Rom: 18. März) und verschiedene Systeme für den Abgleich von Sonnen- und Mondjahren benutzte (Alexandria: 19-jähriger Zyklus = Metonischer Zyklus; Rom: 84-jähriger Zyklus). Zudem bestanden unterschiedliche Auffassungen, wie zu verfahren sei, wenn der Vollmond auf einen Samstag bzw. (wie im Jahr 2021) auf einen Sonntag fällt. Dies hatte zunächst zur Folge, dass man Ostern in Rom zwischen dem 25. März und dem 21. April feierte, in Alexandria hingegen zwischen dem 23. März und dem 25. April. Erst in der ersten Hälfte des 6. Jh. setzte der gelehrte Mönch Dionysius Exiguus auch in Rom das alexandrinische Berechnungssystem durch. Er errechnete gemäß einem Zyklus von 19 x 28 = 532 Jahren eine Ostertafel mit den künftigen Osterterminen, die rund 200 Jahre später von Beda Venerabilis weiter verbessert wurde. Die tabula paschalis des Dionysius Exiguus fand noch im 6. Jh. auch Anerkennung in Spanien, während man in Britannien und Gallien teilweise noch länger am 84-jährigen Zyklus festhielt, bis spätestens mit der karolingischen Renaissance auch dort die moderne Methode etabliert wurde.
Wie bereits in einem früheren Beitrag erläutert, sind erstens die gängigen Sonnenkalender mit exakt 365 Tagen um insgesamt 5 Stunden und 49 Minuten kürzer als die Zeitspanne, welche die Erde für einen vollständigen Umlauf um die Sonne benötigt und wurde zweitens dieses Problem im Julianischen Kalender nur grob durch das System der Schaltjahre mit einem zusätzlichen Tag, d.h. zusätzlichen 4 x 6 = 24 Stunden alle vier Jahre ausgeglichen. Dies hatte zur Folge, dass sich der Julianische Kalender ungefähr alle 130 Jahre um einen Tag „verspätet“ bzw. bis zum 16. Jh. der für den Julianischen Kalender errechnete kalendarische Frühjahrsbeginn abweichend vom astronomischen Frühjahrs-Äquinoktium um 10 Tage auf den 11. März vorgewandert war. Dies wurde mit dem Gregorianischen Kalender korrigiert, der jedoch bis heute in Teilen der Christenheit nicht akzeptiert ist – weswegen seither Ostern nur gelegentlich nach beiden Kalendern auf den selben Sonntag fällt (wie zuletzt 2017 und erst wieder 2025).
Das kanonische Recht hat übrigens, soweit ersichtlich, die eingangs genannten Kanones von Arles und Antiochia nicht in die maßgeblichen Rechtssammlungen des Mittelalters wie insbesondere das decretum Gratiani aufgenommen. Lediglich die Apostolischen Kanones wurden gemäß can. 2 des Concilium Quinisextum von 691/92 in ihrer Geltung bestätigt und prägen von daher bis heute das orientalisch-orthodoxe Kirchenrecht mit.
So kommt es, dass der Termin des Osterfestes im abendländischen Kirchenrecht bis heute gleichsam unter- und außerhalb des kanonischen Gesetzesrechts geregelt ist. Noch nicht einmal das liturgische Recht, wie etwa die Grundordnung des Kirchenjahres und des Kalenders (vgl. Messbuch [1975], Teil 1, 71*–82*), äußert sich in Sinne der bekannten Formel: „Am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach dem Frühjahrs-Äquinoktium“. Stattdessen ergibt sich die datumsmäßige Festlegung aus der kalendarischen Zeittafel (siehe Messbuch [1975], Teil 1, 96*), die letztlich in der Tradition der antiken tabulae paschales steht.
Wie aber soll man nach 17 Jahrhunderten über das Anliegen der Synode von Arles denken, als äußeres Zeichen der Einheit Ostern an ein und demselben Tag auf dem ganzen Erdkreis zu feiern? Wie gesehen, ist diese Einheit im Ansatz dadurch erkauft, dass Ostern im Kalender ein bewegliches Fest ist – oder in der Diktion Martin Luthers: ein „Schaukelfest“ –, welches jedes Jahr an einem anderen Tag gefeiert wird; und überdies seit 1583 teils anhand des Julianischen und teils anhand des Gregorianischen Kalenders bestimmt wird.
Vor diesem Hintergrund hat sich auch das Zweite Vatikanische Konzil dieser Problematik angenommen und in einem Anhang zur Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium (vgl. AAS 56 (1964) 97–138, hier 133 f.) sich für folgende beiden Fortentwicklungen der bisherigen Disziplin betreffend den Termin des Osterfestes offen gezeigt: Zum einen die Festlegung eines bestimmten Sonntags im Gregorianischen Kalender, sofern dies die Zustimmung aller christlichen Denominationen findet. Zum anderen die Einführung eines so genannten immerwährenden Kalenders, sofern dieser weiterhin eine kontinuierliche Abfolge von Wochen zu je sieben Tagen, ohne Unterbrechung durch wochenfreie Tage, aufweist. Darüber hinaus hat das Konzil im Dekret Orientalium Ecclesiarum über die katholischen Ostkirchen, dort Nr. 20 (vgl. AAS 57 (1965) 76–89) den Patriarchen sowie den höchsten kirchlichen Autoritäten einer bestimmten Region oder Nation freigestellt, sich abweichend vom gesamtkirchlichen Kalendarium auf einen einheitlichen regionalen bzw. nationalen Termin zu einigen.
Die Geschichte des Ostertermins erweist sich damit gleichsam als eine Parabel über Ungleichzeitigkeiten in der Kirche und wie man geduldig und tolerant damit umgeht. Ohne Frage bietet diese Geschichte zudem ein Lehrstück über Größe, Grund und Grenze des Kirchenrechts im Leben der Kirche. Zugleich erweckt die Aufmerksamkeit des Beobachters, welche Rolle dem Mehrheitsprinzip angesichts (unterschiedlicher[?]) apostolischer Traditionen zukommen kann. Vor allem aber beinhaltet die „grundsätzliche und symbolische Orientierung“ (Philipp Harnoncourt) an astronomischen Gegebenheiten, die ihrerseits unmittelbar mit Sonne und Mond als für die Erde wichtigste Himmelskörper verknüpft sind, reichen Stoff zu Betrachtungen darüber, wie die Heilsgeheimnisse bzw. deren Gedächtnis eingebunden sind in den Kosmos der Schöpfung.
Das Team des Lehrstuhls für Kirchenrecht wünscht allen Leserinnen und Lesern dieses Beitrags ein frohes, gesundes und gesegnetes Osterfest 2021!
c. 1374 CIC n.F.
„Qui nomen dat consociationi, quae contra Ecclesiam machinatur, iusta poena puniatur; qui autem eiusmodi consociationem promovet vel moderatur, interdicto puniatur.“
„Wer einer Vereinigung beitritt, die gegen die Kirche Machenschaften betreibt, soll mit einer gerechten Strafe belegt werden; wer aber eine solche Vereinigung fördert oder leitet, soll mit dem Interdikt bestraft werden.“
von Anna Krähe
Der vorliegende Beitrag gehört zur sechsteiligen Reihe „Wann Kirche straft und warum“, in der ausgewählte Kanones aus dem besonderen Teil des kirchlichen Sanktionsrechts, cc. 1364–1398 CIC n.F., vorgestellt werden. Bisherige Teile: Teil 1 (c. 1368 CIC n.F. [c. 1369 CIC a.F.]).
Hinweis: Mit der Apostolischen Konstitution „Pascite gregem Dei“ vom 23. Mai 2021 hat Papst Franziskus Kanones im Buch VI des CIC/1983 „Die Strafbestimmungen in der Kirche“ promulgiert (Kanones lat.; Kanones dt.). Sie sind am 8. Dezember 2021 in Kraft getreten. Der folgende Text wurde daher überarbeitet. Dabei wurden den Kanones des kirchlichen Strafrechts zur Unterscheidung der besprochenen Norm die Kürzel „a.F.“ (= alte Fassung) sowie „n.F.“ (= neue Fassung) hinzugefügt und teils auch Anpassungen des Textes vorgenommen.
Das sechste Buch des CIC/1983 „Über die Sanktionen in der Kirche“, das kirchliche Strafrecht, ordnet sich in seinem zweiten Teil „Über die Strafen für einzelne Straftaten“ in je mehrere thematische Zusammenstellungen der einzelnen Deliktsnormen. Jeder Titel gibt dabei bereits durch seine Überschrift Auskunft über diejenigen Rechtsgüter, Personen und Ansprüche, welche durch die genannten Delikte verletzt werden könnten bzw. durch die Strafandrohung geschützt werden sollen. Wurden im ersten Titel die klassischen Glaubensdelikte wie insbesondere Häresie, Apostasie und Schisma (vgl. dazu c. 1364 CIC n.F. iVm c. 755 CIC) zusammen mit einer Reihe von Tatbeständen behandelt, welche die kirchliche Einheit potentiell gefährden, nahm der zweite Titel „Über Delikte gegen kirchliche Autoritäten und die Freiheit der Kirche“, cc. 1370–1377 CIC a.F., die Kirche spezifischer in den Blick. Zum einen sollten durch einen Teil der aufgezählten Straftatbestände Träger bestimmter kirchlicher Ämter oder Statusgruppen in ihrer Tätigkeit sowie die Verbindlichkeit ihrer Aussagen, Handlungen und der ihnen geschuldete Gehorsam geschützt werden. Zum anderen wollte der Gesetzgeber mit diesen Normen Eingriffe in die freie Ausübung kirchlicher Rechte und kirchlicher Güter verhindern. Diese Anliegen besitzen auch für die Normen der neuen Rechtslage Geltung, die nun unter Titel II CIC n.F. „Straftaten gegen die kirchliche Autorität und die Ausübung des kirchlichen Amtes“ gefasst werden und auch Straftaten im Zusammenhang mit kirchlicher Amtsausübung mit Sanktionen bedrohen. Beiden Konzeptionen des Titel II in alter und neuer Fassung liegt das grundsätzliche Bestreben zugrunde, die öffentliche Ordnung der Kirche in personeller, materieller und teils auch institutioneller Hinsicht abzusichern. Diesem Bestreben entspricht auch c. 1374 CIC n.F. (gleichlautend zu c. 1374 CIC a.F.), der all denjenigen eine kirchliche Sanktion androht, die in irgendeiner Weise mit Vereinigungen kooperieren, deren Tätigkeit sich gegen die Kirche richtet. Richtet sich die Tätigkeit von Vereinigungen nämlich im Ganzen oder auch nur in Teilen gegen kirchliche Rechte, Personen oder Güter – ist also im Kern kirchenfeindlich – so gefährdet das auch die gemeinschaftliche Ordnung und das Gemeinwohl. Die Sanktionsnorm des c. 1374 CIC soll dieser Gefahr vorbeugen und möglichst Schaden von der Kirche abwenden.
Der Gesetzgeber adressiert c. 1374 CIC n.F. an einen unbestimmten Personenkreis. „Wer“ sich der genannten Delikte strafbar machen kann, lässt sich daher nur über c. 11 CIC näher definieren. Demnach werden durch rein kirchliche Gesetze nur und all jene verpflichtet, die in der katholischen Kirche des lateinischen Rechts getauft oder in sie aufgenommene wurden. Die Normen des kirchlichen Sanktionsrechts verdanken sich nach ganz herrschender Meinung rein kirchlicher Setzung, sodass sie alle Katholik*innen nach Vollendung des siebten Lebensjahres verpflichten.
Es werden dann in c. 1374 CIC n.F. zwei oder eher drei Tatbestände mit je unterschiedlichen Rechtsfolgen benannt, die sich alle um Vereinigungen drehen, deren Machenschaften sich gegen die Kirche richten. Der Gesetzgeber spezifiziert an dieser Stelle nicht näher, welche Vereinigungen dies sein könnten. Ein Blick in andere kodikarische Regelungen zu consociationes, insbesondere c. 215 und c. 298 CIC, hilft wenig weiter, denn der Gesetzgeber liefert an diesen Stellen keine Legaldefinition von „Vereinigungen“. Grundlegend sowohl für consociationes in c. 215 CIC als auch in c. 1374 CIC n.F. dürften aber die allgemeinen Elemente des Vereinigungsbegriffs sein: So handelt es sich um eine bestimmbare Gesamtheit von Personen, die sich zur Verfolgung eines bestimmten gemeinsamen Zwecks zusammengeschlossen haben. Der Zweck kirchlicher Vereinigungen auf der Basis von c. 215 CIC besteht, wie dort beschrieben, in der Förderung des kirchlichen Lebens – Caritas, Frömmigkeit, christliche Berufung –, weswegen solche Vereinigungen zumindest aller Wahrscheinlichkeit nach nicht kirchenfeindlich tätig werden. Über den kirchlichen Kontext hinaus können die Gläubigen ebenfalls nach weltlichem Recht Vereinigungen beitreten (vgl. z.B. Art. 9 GG; §§ 21ff. BGB). Mit c. 1374 CIC n.F. setzt der kirchliche Gesetzgeber diesen grundlegenden Garantien der Vereinigungsfreiheit aber dort eine Grenze, wo es sich um Vereinigungen handelt, „quae contra Ecclesiam machinatur“. Die Vereinigung muss also in irgendeiner Form – mündlich, schriftlich, analog oder digital – tätig werden und dabei das Ziel haben, der Kirche zu schaden, indem sie sich z.B. gegen kirchliche Autoritäten oder bestimmte kirchliche Rechte oder Privilegien richtet. Die Vereinigung muss nachweisbar antikirchlich aktiv sein, was aber wohl nicht heißen muss, dass diese Tätigkeit auch den eigentlichen Vereinigungszweck darstellt. Die Beurteilung, welche Vereinigungen unter die Vorgaben des c. 1374 CIC n.F. fallen, kann entweder vom Gesetzgeber in Form von Gesetzen oder Allgemeindekreten getroffen werden oder ist im Einzelfall innerhalb eines kirchlichen Strafverfahrens zu prüfen.
In Satz 1 des c. 1374 CIC n.F. wird der Beitritt zu einer solchen Vereinigung bestraft. Gemeint ist damit jede Form einer nachweisbaren Mitgliedschaft. Zur Erfüllung dieses Tatbestands ist darüber hinaus aber wohl keine aktive Mitarbeit in der Vereinigung erforderlich. Das geltende Recht der katholischen Ostkirchen stellt in can. 1448 § 2 CCEO in fast wortwörtlicher Übereinstimmung mit c. 1374 Satz 1 CIC n.F. ausschließlich diesen Tatbestand unter Strafe. Im Recht der lateinischen Kirche wird in c. 1374 Satz 2 CIC n.F. darüber hinaus ein zweiter Tatbestand umschrieben, nämlich die Förderung oder auch Leitung einer kirchenfeindlichen Vereinigung. Diese Aktivitäten werden im Vergleich zur bloßen, also unter Umständen auch rein passiven, Mitgliedschaft härter sanktioniert, was darauf schließen lässt, dass der Gesetzgeber sie als schwerwiegender ansieht. Die Leitung einer kirchenfeindlichen Vereinigung schließt die Mitgliedschaft wohl grundsätzlich ein, sodass hier eine Strafbarkeit des bzw. der Betreffenden nach c. 1374 Satz 1 und 2 CIC n.F. in Frage kommt. Die Förderung einer solchen Vereinigung hingegen ist wohl nicht notwendig mit einer Mitgliedschaft verbunden. So sind auch Fälle der finanziellen oder organisatorischen Unterstützung durch Nicht-Mitglieder denkbar, welche der Arbeit der Vereinigung förderlich sind. (Ob die Förderung auch den antikirchlichen Aktivitäten der Vereinigung dient, ist dabei aber wohl nicht entscheidend. Nach dem Wortlaut des c. 1374 Satz 2 CIC n.F. kommt es einzig darauf an, dass die Förderung einer solchen Vereinigung an sich zugutekommt.)
Wie fast alle kirchlichen Straftatbestände erfordert auch c. 1374 CIC n.F. die Vorsätzlichkeit des Handelns (vgl. c. 1321 § 2 CIC n.F.). Das bedeutet im Fall des c. 1374 CIC n.F., dass der bzw. die Betreffende nicht nur faktisch einer kirchenfeindlichen Vereinigung beitreten, diese fördern oder leiten muss, sondern dass er bzw. sie auch um die Kirchenfeindlichkeit der Vereinigung wissen und sein bzw. ihr Handeln sodann willentlich erfolgen muss. Wer also (schuldlos) nicht um die antikirchlichen Aktivitäten der Vereinigung weiß oder nicht um die Strafbarkeit im Sinne des c. 1374 CIC n.F., der kann unter Umständen straffrei bleiben oder er hat eine mildere Strafe zu erwarten.
Wenn nun bis hierhin eines oder mehrere der in c. 1374 CIC n.F. genannten Delikte verwirklicht wurden und der bzw. die Betreffende diese auch vorsätzlich begangen hat, dann ist in der Regel eine der genannten Sanktionen zu verhängen. Im Fall der Mitgliedschaft in einer kirchenfeindlichen Vereinigung nach Satz 1 fordert der Gesetzgeber verpflichtend die Verhängung einer „iusta poena“ („congrua poena“ in can. 1448 § 2 CCEO). Die „gerechte Strafe“ gehört in die Kategorie der sogenannten unbestimmten Sanktionen (c. 1315 § 2 n. 3 CIC n.F.), sodass hier – angepasst an die Umstände des Einzelfalls – (fast) die ganze Bandbreite der zur Verfügung stehenden kirchlichen Sanktionsmittel in Frage kommt. Wie die cc. 1317–1319 CIC n.F. nahelegen, sind besonders schwere und insbesondere Strafen für immer hier aber wohl ausgeschlossen. Darüber hinaus ist das schwerwiegendere Delikt des c. 1374 Satz 2 CIC n.F., die Förderung oder Leitung einer antikirchlichen Vereinigung, mit der verpflichtenden Beugestrafe des Interdikts bedroht (c. 1332 CIC n.F.), was die Vermutung nahelegt, dass die Straftat des Satz 1 in jedem Fall wohl nicht härter zu bestrafen ist. Die Rechtsfolgen des Interdikts können nach neuer Rechtslage sehr individuell angepasst werden, sodass die betreffende Person mit Eintritt bzw. Verhängung – anders als nach c. 1332 CIC a.F. – nicht mehr grundsätzlich von allen gottesdienstlichen Feiern und Handlungen ausgeschlossen ist. Die Rechtsfolgen des Interdikts können die Feier der Eucharistie und der Sakramente, sowie den Empfang oder die Spendung von Sakramenten und Sakramentalien und den aktiven Anteil an der Zelebration dieser Feiern verbieten. Im Rahmen des c. 1374 Satz 2 CIC n.F. erscheint die Verhängung einer Beugestrafe sinnvoll, denn bei ihr kommt zu den konkreten Tatbestandsmerkmalen noch hinzu, dass der oder die Betreffende „widersetzlich“ handelt, also hartnäckig in einem abzulehnenden Verhalten verharrt; im Fall des c. 1374 Satz 2 CIC n.F. also an Förderung oder Leitung der kirchenfeindlichen Vereinigung festhält. In dem Moment, in dem diese contumacia wegfällt (Indizien dafür sind nach c. 1347 § 2 CIC n.F. wahre Reue, Wiedergutmachung von Schäden und Behebung von Ärgernissen), hat der oder die Bestrafte einen Anspruch auf Aufhebung der Sanktion (c. 1358 § 1 CIC n.F.). Insofern ist die Beugestrafe hier ein sinnvolles Mittel zur Erreichung des Normzwecks, nicht nur die Förderung oder Leitung kirchenfeindlicher Vereinigungen durch Gläubige zu verhindern, sondern – sofern dennoch geschehen – diese schnellst möglich wieder zu beenden. Über den Bereich des kirchlichen Sanktionsrechts im CIC/1983 hinaus können die Folgen in Deutschland aber auch arbeitsrechtlicher Natur sein. Nach Art. 5 Abs. 2 Nr. 1. c) der Grundordnung des kirchlichen Dienstes stellt die Straftat des c. 1374 CIC – in jedem Fall a.F., vermutlich aber auch n.F. – für Angehörige des kirchlichen Dienstes einen schwerwiegenden Loyalitätsverstoß dar und wird damit grundsätzlich als Kündigungsgrund angesehen.
Mit c. 1374 CIC n.F. hat der Gesetzgeber des CIC/1983 eine recht kompakte und sowohl in Tatbestand und Rechtsfolge als auch bezüglich des Regelungszwecks gut einsichtige Norm in das kirchliche Sanktionsrecht übernommen, deren Anwendungsbereich heute aber möglicherweise dem einen oder der anderen Leser*in eher gering erscheinen mag. So mag es im ersten Moment auch überraschen, dass nach Einschätzung von Wilhelm Rees nur „[w]enige Einzelbestimmungen des Codex Iuris Canonici 1983 […] mit solcher Spannung erwartet [wurden] wie die Neufassung des c. 2335 CIC/1917“ (W. Rees, Die Strafgewalt der Kirche, 446), der Vorgängernorm des heutigen c. 1374 CIC n.F. Diese gespannte Erwartungshaltung lag darin begründet, dass can. 2335 CIC/1917, anders als die heutige Regelung, erst in Satz 2 die Mitgliedschaft in einer antikirchlichen oder antistaatlichen (!) Vereinigung allgemein unter Strafe stellte. Im Satz 1 des can. 2335 CIC/1917 hatte der damalige Gesetzeger zuvor schon eine ganz konkrete Vereinigung als Maßstab für diese kirchenfeindlichen Vereinigungen benannt: secta massonica – Die Freimaurer.
Die Ablehnung der Freimaurerei seitens der Kirche reicht fast bis in die Anfangszeit dieser Vereinigung zurück. Zu Beginn des 18. Jh. hatten sich vier der an die mittelalterliche Steinmetz-Zunft anknüpfenden Logen in England zur „Großloge von London und Westminster“ zusammengeschlossen. Von England aus verbreiteten sich die Maurer dann recht zügig auch auf dem europäischen Kontinent. Die Kirche reagierte schnell und nachdrücklich auf diese Entwicklung, indem die Freimaurer bereits 1738 (ein Jahr nach Gründung der ersten Freimaurerloge in Deutschland [Hamburg]) von Clemens XII. im Ap. Schreiben „In eminenti apostolus specula“ (vgl. DH 2511–2513) erstmals mit der Exkommunikation belegt wurden. Ausschlaggebende Gründe für diese Verurteilung schienen zum einen der Charakter der Freimaurer als Gemeinbund, denn „wenn sie nämlich nicht böse handeln würden, würden sie das Licht (der Öffentlichkeit) nicht so sehr meiden“ (ebd., 2511); zum anderen wurden die Freimaurer „als der Häresie verdächtig“ (ebd., 2513) eingeschätzt. In Folge dieser kirchlichen Positionierung gegen die Freimaurerei, die von den Päpsten des 18. und 19. Jh. beständig wiederholt wurde, fanden diese dann auch gleich an mehreren Stellen Eingang in das kirchliche Gesetzbuch von 1917. Neben der Verhinderung des Zugangs zu Ordensgemeinschaften für Freimaurer (vgl. cann. 542 n. 1, 572 § 1 n. 3 CIC/1917) und can. 1240 § 1 n. 1 CIC/1917, demnach Freimaurer vom kirchlichen Begräbnis ausgeschlossen waren, wiederholte zunächst can. 2335 CIC/1917, dass Mitglieder in der „Maurer-Sekte“ sich die von selbst eintretende Exkommunikation zuziehen. Für Kleriker und Religiosen, die sich den Freimaurer anschlossen, kamen nach c. 2336 § 1 CIC/1917 noch weitere Strafen hinzu und sie waren nach § 2 auch beim Hl. Offizium anzuzeigen.
Trotz diesbezüglicher Anregungen äußerten sich die Konzilsväter in den Texten des II. Vatikanischen Konzils nicht zu den Freimaurern und ebenso wenig nahm die mit der Überarbeitung des kirchlichen Strafrechts beauftragte Kommission eine spezifische Sanktionierung der Mitgliedschaft bei den Freimaurern in den ersten Entwurf des (neuen) kirchlichen Sanktionsrecht aus dem Jahr 1973 auf. Dies lag wohl auch am Bestreben der Reformkommission, die einzelnen Deliktstatbestände möglichst für eine Vielzahl von Fällen offen zu halten und zudem – gerade auch in diesem Bereich – die Regelung eher den teilkirchlichen Gesetzgebern zu überlassen. Erst nach deutlicheren Forderungen zur Einführung eines solchen Kanons wurde der dem heutigen c. 1374 CIC n.F. wörtliche entspreche can. 1326 Schema CIC/1980 in den ersten Gesamtentwurf des neue Kodex aufgenommen.
Parallel zum Reformprozess des kirchlichen Gesetzbuchs hatte die Kongregation für die Glaubenslehre die Bischofskonferenzen bereits 1974 auf Nachfrage darauf hingewiesen, dass can. 2335 CIC/1917 wie alle kirchlichen Strafgesetze eng auszulegen sei und insofern eine Mitgliedschaft nur sanktioniert werde, wenn die betreffende Vereinigung „wirklich gegen die Kirche arbeit[e]“ (Kongregation für die Glaubenslehre, Schreiben des Präfekten der Glaubenskongregation Kardinal Seper vom 18. Juli 1974 über die Mitgliedschaft in Freimaurervereinigungen [Prot. Nr. 272/44]: AfkKR 143 [1974], 460). Darüber hinaus wurde die Gültigkeit der bestehenden Rechtslage bis zur Änderung des Gesetzbuchs bestätigt und auf die offensichtlich sehr unterschiedlichen regionalen Verhältnisse hingewiesen. In Deutschland wurde Mitte der 1970er Jahre ein offizieller Gesprächsprozess zwischen der Deutschen Bischofskonferenz und den Vereinigten Großlogen von Deutschland angestrengt, der zentral die Frage klären sollte, ob eine Mitgliedschaft bei den Freimaurern unter den veränderten Umständen in der zweiten Hälfte des 20. Jh. möglich und doch mit dem katholischen Glauben vereinbar sei. Nach sechsjährigen Gesprächen, in denen einer Arbeitsgruppe der DBK vertieft Einblick in Rituale und Überzeugungen der Freimaurer gewährt wurde, gelangten die deutschen Bischöfe zu der Erkenntnis, dass „[d]ie gleichzeitige Zugehörigkeit zur Katholischen Kirche und zur Freimaurerei […] unvereinbar“ ist (DBK, Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz vom 12. Mai 1980 zur Frage der Mitgliedschaft von Katholiken in der Freimaurerei: AfkKR 149 [1980], 164–174). Nachdem andere Bischofskonferenzen offensichtlich zu anderen Einschätzungen gelangt waren, stellte die Glaubenskongregation im Jahr 1981 nochmals klar, dass die Strafandrohung des can. 2335 CIC/1917 bestand habe und einzelne Bischofskonferenzen nicht eigenständig zur Einschätzung gelangen könnten, diese für ihren Bereich außer Kraft zu setzen (vgl. Kongregation für die Glaubenslehre, Erklärung vom 17. Februar 1981: AAS 73 [1981], 240f.). Ihren nächsten Schritt zur Klärung der Frage des Umgangs mit der Freimaurerei unternahm die Kongregation für die Glaubenslehre sodann mit ihrer Erklärung vom 26. November 1983; einem in gewisser Weise durchaus sehr markanten Datum, handelte es sich hierbei doch um den Vortag des Inkrafttretens des CIC/1983. Während eben dieser neue Kodex in c. 1374 a.F. (ebenso nun c. 1374 n.F.) – und auch darüber hinaus – die Freimaurerei in keiner Weise erwähnt, stellte die Glaubenskongregation heraus, dass dennoch das „negative Urteil der Kirche über die freimaurerischen Vereinigungen […] unverändert [bleibt], weil ihre Prinzipien immer als unvereinbar mit der Lehre der Kirche betrachtet wurden und deshalb der Beitritt zu ihnen verboten bleibt. Die Gläubigen, die freimaurerischen Vereinigungen angehören, befinden sich also im Stand der schweren Sünde und können nicht die heilige Kommunion empfangen“ (Kongregation für die Glaubenslehre, Urteil unverändert v. 26.11.1983: auch AAS 76 [1984], 300). Auch für ihre Teilkirchen könnten die örtlichen Autoritäten nicht zu einem gegenteiligen Urteil gelangen. Ein Jahr später erläuterte die Glaubenskongregation diese Erklärung nochmals und lieferte nun auch eine umfassendere inhaltliche Begründung zur Ablehnung der Freimaurerei. Dabei wird neben der Gefahr, welche das „Klima der Geheimhaltung“ mit sich bringe, vor allem auf die relativistischen und naturalistischen Prinzipien der Freimaurerei verwiesen, die letztlich nicht mit dem christlichen Glauben zu vereinbaren seien (vgl. Kongregation für die Glaubenslehre, Unvereinbarkeit von christlichem Glauben und Freimaurerei - Überlegungen ein Jahr nach der Erklärung der Kongregation für die Glaubenslehre v. 11.03.1985).
Seit Inkrafttreten des CIC/1983 stehen damit das Verbot der Mitgliedschaft von Katholik*innen bei den Freimaurern als moralische Norm (auf der „Ebene des Glaubens und seiner sittlichen Forderungen“; ebd.), deren Verletzung als schwere Sünde zu verstehen ist, und die Sanktionierung der Mitgliedschaft sowie Leitung oder Förderung kirchenfeindlicher Vereinigungen im Sinne des c. 1374 CIC n.F. nebeneinander. Inwieweit katholische Anhänger*innen des Freimaurertums neben dem Verhaften im Stand der schweren Sünde und dessen (Rechts-)Folgen auch kirchliche Sanktionen treffen, bleibt in gewisser Weise offen. Sehr wahrscheinlich ist zunächst, dass ein katholisches Freimaurermitglied, welches die Prinzipien der Vereinigung vollumfassend teilt, höchstwahrscheinlich eine Straftat gegen den Glauben in Form einer Häresie, Apostasie oder eines Schismas begeht, womit die Tatstrafe der Exkommunikation einhergeht (vgl. c. 1364 CIC n.F.). Dies ist und bleibt aber eine Tatsachenfrage des Einzelfalls, auch wenn die Mitgliedschaft bei einer Freimaurerloge wohl ein durchaus starkes Indiz darstellt. Ob die Freimaurerlogen einzeln oder generell als kirchenfeindliche Vereinigungen im Sinne des c. 1374 CIC n.F. anzusehen sind und eine Mitgliedschaft bzw. möglicherweise sogar Förderung oder Leitung darin auch als Handlung gegen die Kirche zu verstehen und aufgrund dessen nach c. 1374 CIC n.F. zu sanktionieren sind, kann abstrakt wohl nicht beantwortet werden; auch hier müssten im Einzelfall die tatsächlichen kirchenfeindlichen Aktivitäten nachgewiesen werden.
Mit Blick auf das kirchliche Sanktionsrecht lehrt diese Auseinandersetzung mit c. 1374 CIC n.F. wohl zum einen, wie diffizil die Anwendung straf- und sanktionsrechtlicher Normen im Einzelfall sein kann und dass selbst im Rahmen der gesetzgeberischen Mahnung des c. 18 CIC zur engen Auslegung von Sanktionsnormen teils ein recht großer Interpretationsspielraum bleibt. Zum anderen kann c. 1374 CIC n.F. gerade in seiner Nähe zur Auseinandersetzung mit der Freimaurerei als gutes Beispiel gelten, wie der kirchliche Gesetzgeber das Sanktionsrecht des CIC/1983 soweit möglich auf den Bereich des forum externum beschränkt. Ziel von kirchlicher Strafandrohung und Sanktionierung ist es die kirchliche Ordnung vor Angriffen und Schäden zu bewahren, durch welche die kirchliche Gemeinschaft gefährdet werden könnte. Auch hierbei ist die salus animarum das oberste Gesetz (vgl. c. 1752 CIC), sodass auch die Straftäter*innen nicht aus dem Blick geraten dürfen und Sanktionen auch als Möglichkeit zur Besserung genutzt werden können. Aber für das kirchliche Sanktionsrecht ist, wie der Fall des c. 1374 CIC n.F. zeigt, eben nicht das mögliche sündige Verhalten des oder der Betreffenden entscheidend – dies ist eine Frage im forum internum. Ausschlaggebend ist vielmehr, ob für die ganze kirchliche Gemeinschaft vom Tun des oder der Einzelnen die Gefahr ausgeht, dass Grundpfeiler des kirchlichen Gemeinschaftslebens, dass Personen, Rechte, Güter in der Kirche angegriffen oder beschädigt werden. Ist dies der Fall – wie beispielsweise bei der Kooperation mit kirchenfeindlichen Vereinigungen –, dann kann die Kirche als letztes Mittel Sanktionen verhängen, um ihre Ordnung und die Gemeinschaft aller Gläubigen zu schützen.
c. 230 § 1 n.F.: „Laici, qui aetate dotibusque pollent Episcoporum conferentiae decreto statutis, per ritum liturgicum praescriptum ad ministeria lectoris et acolythi stabiliter assumi possunt; quae tamen ministeriorum collatio eisdem ius non confert ad sustentationem remunerationemve ab Ecclesia praestandam.“
c. 230 § 1 n.F.: „Laien, die das Alter und die Eigenschaften besitzen, die durch Dekret der Bischofskonferenz festgesetzt worden sind, können durch den dafür vorgeschriebenen liturgischen Ritus dauerhaft zu den Diensten des Lektors und des Akolythen bestellt werden; die Übertragung dieser Dienste gewährt ihnen jedoch nicht das Recht auf Unterhalt oder Vergütung vonseiten der Kirche.“
von Martin Rehak
In Nr. 97 der Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“, welche die Kongregation für den Klerus Ende Juni vorigen Jahres veröffentlichte, ist davon die Rede, dass „gemäß can. 230 § 1 [...] Laien als Lektoren und Akolythen in beständiger Weise beauftragt werden“ können. Nachdem allerdings c. 230 § 1 in seiner ursprünglichen Fassung aus dem Jahr 1983 ausdrücklich von „männlichen Laien“ sprach, war der Verfasser dieses Beitrags nicht umhingekommen, sich in seinem seinerzeitigen Beitrag zu fragen, ob man bei der Kongregation „womöglich der Auffassung ist, die von Papst Paul VI. vorgenommene Beschränkung [sc.: der Dienstämter des Lektors und des Akolythen auf männliche Laien] sei heute nicht mehr zeitgemäß und ein Traditionsbruch an dieser Stelle einer wahrhaft missionarischen Kirche förderlich“. Und in der Tat: Wie einige Zeit später im Gespräch mit einem bestens unterrichteten hochrangigen Mitarbeiter der Römischen Kurie zu hören war, hatte die Kleruskongregation eine zu diesem Zeitpunkt schon fest geplante Änderung des c. 230 § 1 bereits in ihre Darstellung „eingepreist“ und antizipiert.
Mit dem (im Original in italienischer Sprache verfassten) Motu Proprio Spiritus Domini [eigentlich also: Lo Spirito del Signore Gesù] hat Papst Franziskus am 10.01.2021, dem Fest der Taufe des Herrn, c. 230 § 1 abgeändert und den Vorbehalt jener Dienstämter eines Lektoren und eines Akolythen zugunsten männlicher Laien aus dem kodikarischen Recht gestrichen. Die Promulgation erfolgte durch Veröffentlichung des Motu Proprio im L’Osservatore Romano 161 (2021), Nr. 7 vom 11.01.2021, dort S. 10. Gemäß den im Motu Proprio getroffenen Verfügungen trat die Gesetzänderung am selben Tag in Kraft. Eine Gesetzesschwebe, also ein Zeitraum zwischen Promulgation und Inkrafttreten von gemäß c. 8 § 1 regelmäßig drei Monaten, schien im vorliegenden Fall entbehrlich. Manche Rechtsänderung duldet keinen Aufschub. Der spätere Abdruck des Motu Proprio im offiziellen Publikationsorgan des Apostolischen Stuhls, den Acta Apostolicae Sedis, wird nur dokumentarische Funktion haben.
Der Dienst bzw. das Amt der Lektoren und Akolythen (griechisch: Begleiter) kann auf eine lange kirchliche Tradition zurückblicken. Als vielleicht ältestes Zeugnis kann das bei Eusebios von Caesarea, h.e. VI,43,11, überlieferte Fragment eines in das Jahr 251 zu datierenden Briefes des römischen Bischofs Cornelius an seinen antiochenischen Amtsbruder Fabius gelten. Cornelius führt darin aus, dass es in der stadtrömischen Kirche „46 Priester, 7 Diakone, 7 Subdiakone, 42 Akolythen, 52 Exorzisten, Lektoren und Ostiarier sowie über 1500 Witwen und Hilfsbedürftige“ (DH 109) gebe. (Ob die wiederkehrende Siebenzahl Zufall oder Indiz einer damaligen verwaltungsmäßigen Gliederung Roms in sieben kirchliche Bezirke ist, mag hier dahinstehen.) Im weiteren Verlauf der Kirchengeschichte formte sich aus den hier genannten Diensten bzw. Ämtern ein kirchlicher cursus honorum, d.h. eine kirchliche Ämterlaufbahn, bei der die Kleriker – entsprechende Bewährung im kirchlichen Dienst vorausgesetzt – von Stufe zu Stufe aufsteigen konnten. Insgesamt umfasste diese Ämterlaufbahn mithin sieben Stufen, nämlich Ostiariat, Lektorat, Exorzistat und Akolythat, welche den Kandidaten durch die so genannten niederen Weihen übertragen wurden, sowie Subdiakonat, Diakonat und Presbyterat, welche den Kandidaten durch die so genannten höheren Weihen übertragen wurden. Eine Handauflegung als äußeres Zeichen der Weihe war dabei freilich nur für die Diakonen- und Priesterweihe (sowie die Bischofs-weihe) vorgesehen, wie etwa die als Statuta ecclesiae antiqua bekannte gallo-romanische Kanonessammlung aus der zweiten Hälfte des 5. Jh. bezeugt (vgl. DH 326-329). Die klassischen Aufgaben der jeweiligen Amtsträger erläutert Isidor von Sevilla in seiner Ethymologie, lib. 7 cap. 12, 22 ff. (= D. 21 c. 1, §§ 13-15.17-19). Begünstigt durch die mittelalterliche Fokussierung der Weihetheologie auf das Priestertum verkam dieser cursus honorum und die Spendung der niederen Weihen sowie der Weihe zum Subdiakon im Laufe der Zeit zu einem Ritual, welches nur noch der geistlichen Vorbereitung der Priesteramtskandidaten auf ihre künftige Existenz im priesterlichen Dienst diente. Obwohl schon seit langem etwa an die Stelle der realen antiken Ostiarier oder Akolythen neue laikale kirchliche Ämter (oder Aufgaben?) wie jene eines Küsters, Glöckners oder Ministranten in das Leben der Kirche getreten waren, verteidigte das Konzil von Trient das traditionelle System aus (sieben) Weihestufen in seiner Lehre und seinen Kanones zum Weihesakrament (vgl. DH 1765, 1772). Dabei spielte gewiss auch eine Rolle, dass etwa Thomas v. Aquin, contra gentiles lib. 4, cap. 74-75, die Hinordnung aller niedrigeren Weihestufen auf das Priestertum gelehrt hatte und der Dominikaner Hugo Ripelin von Straßburg (um 1205–1270), der Verfasser des – irrig auch u.a. Alexander von Hales (um 1185–1245), Hugo von Saint-Cher (um 1200–1263), Albertus Magnus (um 1200–1280), Thomas v. Aquin und Bonaventura zugeschriebenen – Compendium theologicae veritatis, dort lib. 6, cap. 36 (= Auguste Borgnet (Hg.), B. Alberti Magni […] opera omnia, Bd. 34, Paris 1895, hier 233 f., der Ansicht war, dass der Herr selbst in seinem irdischen Leben alle besagten Ämter ausgeübt habe: Den Ostiariat bei der Tempelreinigung (vgl. Mt 21,12-17; Mk 11,15-19; Lk 19,45-48; Joh 2,13-17); das Lektorat bei der Schriftlesung in der Synagoge von Nazareth (vgl. Mt 13,54-58; Mk 6,1-6; Lk 4,16-20); den Exorzistat bei der Austreibung von Dämonen (vgl. u.a. Mt 17,14-21; Mk 9,14-29; Lk 9,37-43); den Akolythat, dessen Inhabern traditionell auch das Entzünden von Kerzen und das Tragen von Leuchtern oder Fackeln zukam, als er sagte: „Ich bin das Licht der Welt“ (vgl. Joh 8,12); das Subdiakonat bei der Fußwaschung (vgl. Joh 13,3-15); und den Diakonat, als er beim letzten Abendmahl den Jüngern seinen Leib und sein Blut darreichte (vgl. Mt 26,26-28; Mk 14,22-24; Lk 22,19-20).
Das Zweite Vatikanische Konzil hingegen hat nicht nur die (ursprünglich calvinistische) Tria-Munera-Lehre von Christus als Priester, König und Prophet (vgl. AA 10; ähnlich LG 13: Lehrer, König, Priester; OT 4: Lehrer, Priester, Hirte; PO 1: Lehrer, Priester, König) lehramtlich rezipiert, sondern auch in Nr. 62 der Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium eingeräumt, dass sich „im Laufe der Zeiten einiges in die Riten der Sakramente und Sakramentalien eingeschlichen hat, wodurch ihre Natur und ihr Ziel uns heute weniger einsichtig erscheinen“ und hieraus die Notwendigkeit von Anpassungen an die Erfordernisse der Gegenwart abgeleitet. Ergänzend wurde in SC 76 ganz allgemein eine Überarbeitung der Weiheliturgie gefordert. Auf dieser Grundlage hat Papst Paul VI. mit dem Motu Proprio Ministeria quaedam vom 15.08.1972, in: AAS 64 (1972) 529–534, zum einen die Tonsur, die niederen Weihestufen Ostiariat und Exorzistat sowie den Subdiakonat in der lateinischen Kirche abgeschafft (vgl. a.a.O., 531 f. [Ziff. I, II u. IV]), zum anderen die niederen Weihestufen Lektorat und Akolythat in Dienstämter („ministeria“) umgewandelt (vgl. a.a.O., 531 f. [Ziff. II u. IV]). Dabei erfolgte insbesondere hinsichtlich des Akolythen eine neue Aufgabenumschreibung als Altardiener und außerordentlichem Kommunionspender (vgl. a.a.O., 532 f. [Ziff. VI]). Dass gerade diese beiden bisherigen Weihestufen bzw. neuen laikalen Dienstämter als besonders zeitgemäß erschienen, dürfte auch mit der im Umfeld des Zweiten Vatikanischen Konzils populären Redeweise vom „Tisch des Wortes“ (vgl. SC 51) und vom „Tisch des Brotes“, welche in der Eucharistiefeier aufeinander bezogen sind, zusammenhängen. Mit Rücksicht auf die ehrwürdige Tradition (venerabilis traditio) der Kirche blieben indes Lektorat und Akolythat ausschließlich Männern vorbehalten (vgl. a.a.O., 533 [Ziff. VII], rezipiert in c. 230 § 1 a.F.).
Diese Regelung hat von Anfang an zu Irritationen und Anfragen geführt. Denn bereits im Jahr 1969 hatte die Sakramentenkongregation der Deutschen Bischofskonferenz per Reskript gestattet, auch Frauen als außerordentliche Kommunionspender zu beauftragen, eine Regelung, die mit der Instruktion Immensae Caritatis vom 29.01.1973, in: AAS 65 (1973) 264-271, allgemeines Recht werden sollte. Ebenso gestattete schon die Institutio generalis des römischen Messbuchs von 1969 in Nrn. 66 u. 70, dass Frauen (bis 1975 freilich zunächst nur außerhalb des Altarraums) den Lektoren- und Ministrantendienst ausüben. Vor diesem Hintergrund erachtete es Hubert Socha, Die „Dienstämter“ des Lektors und Akolythen, in: MThZ 25 (1974) 138–151, hier 149, als „nicht ganz begründet, daß die Frau nicht das Amt, indessen wohl seine Funktion ausüben darf“. Bereits 1975 hatte daher auch die Würzburger Synode in Ziff. 7.1.1.a) ihres Beschlusses „Dienste und Ämter“ (vgl. Gemeinsame Synode. Gesamtausgabe I, 597–636, hier 633, dafür votiert, „den Papst [zu bitten], die Einsetzung zu Lektoren und Akolythen nicht nur Männern vorzubehalten“. Als der CIC/1983 insoweit an der von Paul VI. geschaffenen Rechtslage festhielt, merkte Peter Krämer, Kirchenrecht II. Ortskirche – Gesamtkirche, Stuttgart 1993, 33 f., zu c. 230 § 1 a.F. kritisch an, es werde „hier ein Unterschied gemacht zwischen männlichen und weiblichen Laien, der wohl kaum mit der Aussage über die wahre Gleichheit in c. 208 vereinbar ist.“ Denn die neuen Dienstämter sollten ja mit der Neuordnung durch Ministeria quaedam ihres Charakters als bloße Durchgangsstufen zu den sakramentalen Weihen entkleidet werden, unter gleichzeitiger Herstellung eines Gleichlaufs von sakramentaler Weihe und Klerikerstand (vgl. a.a.O., 531 [Ziff. I], ferner c. 266 § 1).
Es ist nicht zuletzt dieser Gemengelage aus Sorge um Diskriminierung und alternativen Rechtsgrundlagen für den Lektoren- und Kommunionhelferdienst von Frauen geschuldet, dass sich die Dienstämter des Lektoren und Akolythen im Sinne von Ministeria quaedam bzw. c. 230 § 1 jedenfalls im deutschen Sprachraum keiner nennenswerten Rezeption erfreut haben, soweit es (männliche) Laien anbelangt, die keinerlei klerikale Ambitionen als (ggf. Ständige) Diakone oder Priester hatten. Stattdessen blieben beide Dienst de facto ein Durchgangsamt für Kandidaten zur Diakon- und Priesterweihe, vgl. dazu auch Ministeria quaedam, Ziff. XI. sowie c. 1035.
Dessen ungeachtet hatte sich die Deutsche Bischofskonferenz bereits im Jahr 1985 erstmals der ihr in c. 230 § 1 gestellten „Hausaufgabe“ angenommen hat, sich per Dekret zu Alter und Eigenschaften der Bewerber um die Dienstämter eines Lektors bzw. eines Akolythen zu äußern. Die nach der deutschen Wiedervereinigung nur formal aktualisierte Partikularnorm Nr. 1 zu c. 230 § 1 aus dem Jahr 1992 wurde vom Apostolischen Stuhl im Jahr 1995 gemäß c. 455 § 2 rekognosziert. Die Regelungen sehen vor, dass Kandidaten, sofern sie keine Weihekandidaten sind, mindestens 25 Jahre alt sein; über eine gediegene Kenntnis der Heiligen Schrift und der Liturgie verfügen; allgemein zur Ausübung des betreffenden Dienstes befähigt sein; und durch gefestigten Glauben und bewährten Lebenswandel ausgezeichnet sein müssen. Desweiteren sieht die Ordnung vor, dass die Bestellung aus triftigem Grund vom Diözesanbischof widerrufen werden kann. Im Fall von Weihekandidaten, die nach ihrer Beauftragung zu Lektorat und Akolythat aus dem Priesterseminar austreten bzw. die Ausbildung zum Ständigen Diakon abbrechen, kann der Dienst nur noch dann ausgeübt werden, wenn der bestellende Diözesanbischof die Bestellung nicht widerruft und darüber hinaus der örtlich zuständige Ortsordinarius die Ausübung ausdrücklich gestattet.
Bei ihrer nun anstehenden Revision der Partikularnorm Nr. 1 zu c. 230 § 1 wird sich die Deutsche Bischofskonferenz wohl darauf beschränken können, in Ziff. I.1 das Wort „Männliche“ zu streichen.
In jüngerer Zeit war die Kritik am Vorbehalt der beiden Dienstämter für männliche Laien auch in Rom zunehmend lauter geworden. So hatte die Bischofssynode am Ende ihrer 12. Ordentlichen Generalversammlung, welche sich vom 05.–26.10.2008 mit dem Wort Gottes im Leben und in der Sendung der Kirche beschäftigte, unter Nr. 17 ihres Elenco finale delle Proposizioni empfohlen, „che il ministero del lettorato sia aperto anche alle donne“. Papst Benedikt XVI. hatte daraufhin in Nr. 58 seines Nachsynodalen Apostolischen Schreibens Verbum Domini vom 30.09.2010, in: AAS 102 (2010) 681–787, hier 737, klargestellt, dass gemäß der lateinischen Tradition die erste und zweite Lesung von einem Lektor vorgetragen wird, wobei es sich hierbei um einen laikalen Dienst handelt, der von einem Mann oder einer Frau übernommen werden kann. Zuletzt hatte sich die Spezialversammlung der Bischofskonferenz für die Region Pan-Amazonien, welche vom 06.–27.10.2019 tagte, in Nr. 102 ihres Schlussdokuments Neue Wege für die Kirche und für eine ganzheitliche Ökologie u.a. dafür ausgesprochen, die Dienstämter des Lektorats und Akolythats für Frauen zu öffnen und weiterzuentwickeln.
Papst Franziskus hat sein Motu Proprio mit einem offenen Brief an den Kardinalpräfekten der Kongregation für die Glaubenslehre vom 10.01.2021 flankiert. Dies ist auch deshalb etwas eigenartig, weil ein konkreter Grund, dieses Schreiben explizit an Kardinal Ladaria SJ zu richten, nicht erkennbar ist. Der Brief wiederholt nämlich ausgiebig theologische Gegebenheiten, Argumente und Topoi, die dem Kardinal zweifelsohne geläufig sind. Darüber hinaus wird die im vorstehenden Absatz referierte Vorgeschichte der jetzigen Rechtsänderung in Erinnerung gerufen und wird erklärt, dass Paul VI. in Ministeria quaedam mit Bedacht nicht von einer zu verehrenden Tradition („tradizione veneranda“), sondern von einer ehrwürdigen Tradition („tradizione venerabilis“) gesprochen habe. Am Ende des Schreibens formuliert der Papst zwei Arbeitsaufträge, die sich allerdings nicht an die Glaubenskongregation, sondern an die Bischofskonferenzen und an die Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung richten. Die Bischofskonferenzen mögen nun die Vorbereitung der Kandidat*innen auf ihren Dienst als Lektor*innen bzw. Akolyth*innen neu ordnen, unter besonderer Berücksichtigung der regionalen Erfordernisse der Evangelisierung. Die Kongregation wolle die Editio typica des Pontifikale romanum in Bezug auf die dort geregelten liturgischen Feiern der Lektorenbeauftragung bzw. der Akolythenbeauftragung anpassen.
So bleiben am Ende für den Verfasser dieses Beitrags zunächst nur zwei Fragen offen, eine kanonistische und eine theologische:
Ist es rechtstheoretisch möglich, durch Mitteilung eines redigierten Normtextes in italienischer Sprache den authentischen lateinischen Text der fraglichen Norm zu ändern – oder anders: Ist jetzt also Italienisch die neue lingua franca des kanonischen Rechts?
Was wäre, wenn – wohlgemerkt: gegen die konziliare Tria-munera-Lehre, wonach Christus in etwa die Ämter eines Priesters, Königs und Propheten innehat – Hugo Ripelin von Straßburg ein sensationelles theologisches Comeback erleben würde: Könnte man dann theologisch korrekt sagen, dass eine Akolythin „in persona Christi akolythi [seu luciferi]“ handelt? (Meiner vorläufigen und unmaßgeblichen Meinung nach wird man diese Frage mit besseren Gründen zu verneinen haben, aber das ist nachrangig; denn viel spannender ist doch zunächst einmal zu sehen, welche Gründe und Argumente in die Erörterung dieses Problems eingebracht werden…)
C. 905: 㤠1. Exceptis casibus in quibus ad normam iuris licitum est pluries eadem die Eucharistiam celebrare aut concelebrare, non licet sacerdoti plus semel in die celebrare.
§ 2. Si sacerdotum penuria habeatur, concedere potest loci Ordinarius ut sacerdotes, iusta de causa, bis in die, immo, necessitate pastorali id postulante, etiam ter in diebus dominicis et festis de praecepto celebrant.“
C. 905: „§ 1. Mit Ausnahme der Fälle, in denen es nach Maßgabe des Rechts erlaubt ist, mehrmals am selben Tag die Eucharistie zu zelebrieren oder zu konzelebrieren, ist es dem Priester nicht erlaubt, mehr als einmal am Tag zu zelebrieren.
§ 2. Wenn Priestermangel besteht, kann der Ortsordinarius zugestehen, dass Priester aus gerechtem Grund zweimal am Tag, ja sogar, wenn eine seelsorgliche Notlage dies erfordert, an Sonntagen und gebotenen Feiertagen auch dreimal zelebrieren.“
von Martin Rehak
Die SARS-CoV-2-Pandemie beherrscht auch zum Jahreswechsel 2020/21 die Schlagzeilen und bestimmt weite Teile des öffentlichen, des privaten, und auch des kirchlichen Lebens. Anlässlich des Eintritts in den „harten Lockdown“ zum 16.12.2020 entspann sich eine Diskussion darüber, ob die Kirchen unter den gegebenen Umständen richtig handeln, wenn sie öffentliche Gottesdienste zu Weihnachten feiern (vgl. u.a. hier, hier, hier, hier, hier und hier). Dagegen hatte der bekannte Pfarrer von München-St. Maximilian, Rainer M. Schießler, in seiner ursprünglichen – lange vor Verhängung einer nächtlichen, auch für Gottesdienstbesucher geltenden Ausgangssperre in Bayern ab 21 Uhr getätigten – Planung eine aufsehenerregende Erweiterung des gottesdienstlichen Angebots in seiner Pfarrei angestrebt: Mit zwölf Gottesdiensten (unterschiedlicher Formate, darunter – incl. Christmette – allerdings vier Eucharistiefeiern,) wollte er, unterstützt von seinem Pfarrvikar, an Heilig Abend von 12 Uhr mittags bis Mitternacht durchfeiern, damit auf diese Weise möglichst viele Gottesdienstbesucher in Präsenz mitfeiern können (vgl. u.a. hier, hier und hier; für eine konstruktive Kritik derartiger Vorhaben ferner hier).
Ebenfalls am 16.12.2020 hat die Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung ein Dekret, Prot.N. 597/20, betreffend die Festtage der Weihnachtszeit 2020/21 veröffentlicht, das ebenfalls die Absicht verfolgt, angesichts direkter oder indirekter Beschränkungen der maximalen Zahl an Gottesdienstbesuchern in einzelnen Ländern möglichst vielen Gläubigen an den Hochfesten des Weihnachtsfestkreises im Kirchenjahr 2020/21 die präsentische Teilnahme an einer Eucharistiefeier zu ermöglichen.
Das besagte Allgemein Dekret (vgl. dazu c. 29) der Kongregation richtet sich primär an die Ortsordinarien (vgl. dazu c. 134 § 2). Ihnen wird gestattet, ihrerseits allen Priestern, die sich in ihrem jeweiligen Bistum aufhalten, die Erlaubnis zu gewähren, am Fest der Geburt des Herrn (25.12.2020), am Fest der Gottesmutter Maria (01.01.2021) und am Fest der Erscheinung des Herrn („Dreikönig“, 06.01.2021) nicht weniger als vier Mal die Messe zu zelebrieren – vorausgesetzt, dass dies zum Wohl der Gläubigen für notwendig erachtet wird.
Das Dekret setzt damit für die genannten drei Tage die Norm des c. 905 außer Kraft, gemäß welcher grundsätzlich jeder Priester nur einmal täglich die Eucharistie feiern darf. Ein Tag im Sinne des c. 905 ist dabei nicht im liturgischen Sinn, sondern im kalendarischen Sinn zu bestimmen und bezeichnet also gemäß c. 202 § 1 einen Zeitraum von 24 Stunden, beginnend und endend um Mitternacht. Die Norm will das Bewusstsein dafür schärfen, dass die Feier der Eucharistie für den Zelebranten ein geistliches Ereignis sein soll, die daher gleichsam als die spirituelle Mitte des Tages sehr bewusst zu feiern ist; im Falle mehrmaliger Zelebrationen an einem Tag ist der Gesetzgeber in Sorge, dass die Messe ihres geistlichen Sinns für den Zelebranten entleert und ohne innere Anteilnahme „abgespult“ wird. Dabei formuliert die Norm des c. 905 allerdings nur ein Verbot mehrmaliger Zelebration, ohne dass eine Missachtung die Ungültigkeit der weiteren Zelebrationen zur Folge hätte. Darüber hinaus folgt c. 905 in beredter Weise dem Schema „Keine Regel ohne Ausnahme“. Denn Ausnahmen vom Grundsatz „nur eine Zelebration pro Tag“ sind bereits in der Norm selbst ausführlich angesprochen.
So nimmt c. 905 § 1 summarisch auf jene Fälle Bezug, in denen eine mehrmalige tägliche Zelebration von Rechts wegen, d.h. insbesondere kraft liturgischen Rechts, gestattet ist. Zu denken ist hierbei insbesondere an den ersten Weihnachtsfesttag (Christmette [sofern um Mitternacht gefeiert]; Hirtenmesse; Hochamt); an den Gründonnerstag (ggf. Chrisammesse; Messe vom Heiligen Abendmahl); sowie an den ersten Osterfesttag (Feier der Osternacht [sofern nicht auf Karsamstag vorverlegt]; Hochamt); sowie schließlich an den auf Privilegien des 18. Jh. zurückreichenden, von Papst Benedikt XV. mit der Apostolischen Konstitution Incruentum altaris vom 10.08.1915, in: AAS 7 (1915) 401–404, für alle Priester bestätigten Brauch, an Allerseelen (bis zu) drei Messen zu feiern.
Gemäß c. 905 § 2 sind – sofern dies aufgrund einer seelsorglichen Notlage erforderlich ist und von den Ortsordinarien generell erlaubt wird – außerdem eine zweimalige Zelebration („Bination“) an Werktagen und eine dreimalige Zelebration („Trination“) an Sonn- und gebotenen Feiertagen (vgl. dazu c. 1246 § 1) statthaft.
Rechtstechnisch schließt sich das Allgemeine Dekret der Kongregation damit an die Norm des c. 905 § 2 an und erweitert dessen Reichweite dahingehend, dass also die Ortsordinarien angesichts der durch die Pandemie ausgelösten seelsorglichen Notlage an den ausdrücklich genannten drei Festtagen sogar eine „Quaternation“, d.h. eine viermalige Feier der Eucharistie gestatten können.
Dabei sei zumindest darauf aufmerksam gemacht, dass die Kongregation in ihrer Formulierung des Dekrets das „bonum fidelium“ (und nicht die „salus animarum“, vgl. dazu c. 1752) benennt und zum Bezugspunkt einer etwaigen Entscheidung der Ortsordinarien über die Notwendigkeit einer Gestattung von Quaternationen macht. Vielleicht kann das so gedeutet werden, dass die Kongregation die Gläubigen hier ganzheitlich, mit Leib und Seele, in den Blick nimmt; und zugleich zum Ausdruck bringt, dass gegenüber Online-Ersatzformen ein physisches Gemeinschaftserlebnis in der Eucharistiefeier einen emotionalen und ekklesiologischen Mehrwert hat, den man nicht geringschätzen soll.
Mit geprägter Formelsprache ruft das Allgemeine Dekret in Erinnerung, dass bei alledem die kirchliche Disziplin im Übrigen weiterhin zu beachten ist, wobei ausdrücklich die Bestimmung des c. 951 genannt wird. Bei c. 951 handelt es sich um eine Norm aus dem Recht der Messstipendien, die der Konkretisierung und Durchsetzung des in c. 947 thematisierten Anliegens dient, vom Messstipendienwesen jeglichen Anschein von Geschäftemacherei fernzuhalten. Dieses Anliegen unterstützt c. 951 in der Weise, dass ein Priester, der erlaubter Weise an einem Tag mehrere Messen feiert, zwar für jede einzelne dieser Messen ein Stipendium annehmen darf; aber – außer an Weihnachten (!) – nur eines behalten und das weitere Binationsstipendium sowie ggf. auch das Trinationsstipendium bei seinem Ordinarius abzuliefern hat. Sofern in einzelnen Bistümern also nunmehr von den Ortsordinarien Quaternationen erlaubt worden sind; Priester gemäß dieser Erlaubnis bis zu vier Messen an den genannten Tagen feiern oder gefeiert haben; und Gläubige für jede dieser Messen ein Stipendium gegeben haben, so durfte – Oh du fröhliche Weihnachtszeit – der Priester im günstigsten Fall bis zu vier Stipendien zu eigen erwerben (falls er als Pfarrer der Applikationspflicht für das Volk gemäß c. 534 § 1 unterlag, an sich nur bis zu drei Stipendien).
Es versteht sich, dass ein Priester, der von einer eventuell tatsächlich vom Ortsordinarius gestatteten Quaternation an den genannten drei Festtagen des Weihnachtsfestkreises Gebrauch macht, aus Gründen des Ritus der Eucharistiefeier dann auch viermal kommunizieren wird. Impliziert das Allgemeine Dekret der Kongregation aber auch, dass dies beispielsweise jenem hypothetischen Super-Ministranten (m/w/_/d) ebenfalls erlaubt ist, der (auch im Sinne pandemiebedingter Kontaktbeschränkungen) den Altardienst in allen vier Messen übernimmt? Die insoweit einschlägige Norm des c. 917 richtet sich ähnlich wie c. 905 gegen eine verfehlte Eucharistiefrömmigkeit, bei der Qualität durch Quantität, innere Andacht durch Häufigkeit ersetzt wird. Dazu beschränkt c. 917 den Empfang der Kommunion auf im Normalfall höchstens zwei Mal pro Tag, wobei der erstmalige Kommunionempfang innerhalb oder außerhalb einer Eucharistiefeier erfolgen kann, der zweite Kommunionempfang dagegen im Rahmen einer Eucharistiefeier erfolgen muss. Im speziellen Fall, dass danach dem Gläubigen die Sterbesakramente zu spenden wären, gestattet das Kirchenrecht ausnahmsweise noch eine dritte Kommunion an ein- und demselben Tag, wie sich aus dem Verweis in c. 917 auf c. 921 § 2 ergibt. Die Norm des c. 917 bietet keinerlei Hinweis darauf, dass sie dann flexibel zu handhaben wäre, wenn eine Trination (bzw. gar eine Quaternation) gestattet ist und praktiziert wird. Auch der Sinn und Zweck der Norm bietet keinen Grund, zugunsten eines drei- oder gar viermaligen Kommunionempfangs unseres hypothetischen Super-Ministranten zu plädieren. Dabei ist bemerkenswert, dass kirchenrechtlich erstmals zu Beginn der vatikanischen Liturgiereform im Jahre 1964 ein zweimaliger Empfang der Kommunion an Ostern und Weihnachten gestattet wurde, und zwar mit der Begründungslogik, dass an diesen Tagen um Mitternacht und am Tag mit Blick auf das jeweilige Mess-Offizium zwei komplett unterschiedliche Gottesdienste gefeiert werden. Eine Tri- oder Quaternation, die einen bereits einmal gefeierten Gottesdienst lediglich wiederholt, kann gemäß dieser Logik nicht zur unproblematischen Gestattung eines dritten oder vierten Kommunionempfangs führen.
Wie kann nach alledem eine kritische Gesamtwürdigung des hier diskutierten Allgemeinen Dekrets der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung vom 16.12.2020 ausfallen? Wird es sich einer begeisterten Rezeption erfreuen? Oder geht es am aktuellen Bedarf vorbei?
Zunächst einmal muss es doch verwundern, warum ein solches Dekret, das zu seiner praktischen Verwirklichung weiterer administrativer, auf amtliche Weise publik zu machender Entscheidungen der Ortsordinarien bedarf, erst weniger als zehn Tage vor seinem potenziellen ersten Anwendungsfall publiziert wird – nachdem in den Pfarreien und Gemeinden vor Ort die gottesdienstliche Begehung eines Weihnachtsfestes unter den Vorzeichen der Corona-Pandemie schon seit Wochen und Monaten geplant und vorbereitet wurde. Jedenfalls für Deutschland ist angesichts der eingangs erwähnten, in die Gegenrichtung zielenden Debatte, wohl kaum damit zu rechnen, dass einzelne Ortsordinarien von den Möglichkeiten des Dekrets Gebrauch machen. Der Wert dieser anlassbezogenen Modifikation des Kirchenrechts könnte daher weniger in kurzfristigen Umsetzungserfolgen liegen, als vielmehr darin, einmal mehr die Flexibilität des kanonischen Rechts bei gleichzeitiger konsequenter Orientierung am Seelenheil bzw. am Wohlergehen der Gläubigen zu demonstrieren. Im Übrigen wäre es wohl nicht nur aus liturgiewissenschaftlicher, sondern auch rein pragmatischer Sicht gut, wenn für eine Neuauflage eines derartigen Dekrets anlässlich des diesjährigen Weihnachtsfestes überhaupt keine Notwendigkeit mehr besteht – denn das wäre wohl ein Zeichen dafür, dass die Krise der Pandemie überstanden ist.
Das Team des Lehrstuhls für Kirchenrecht wünscht allen Leser*innen dieses Beitrags ein glückseliges neues Jahr 2021, Wohlergehen an Leib und Seele, und Gottes Segen!
C. 579: „Episcopi dioecesani, in suo quisque territorio, instituta vitae consecratae formali decreto valide erigere possunt, praevia licentia Sedis Apostolicae scripto data.“
C. 579: „Die Diözesanbischöfe können in ihrem Gebiet nach vorheriger schriftlicher Genehmigung des Apostolischen Stuhls durch förmliches Dekret Institute des geweihten Lebens gültig errichten.“
von Martin Rehak
In memoriam P. Stephan Haering OSB (1959–2020)
„Will this matter a year from now?“ – Nicht nur in unserer schnelllebigen Zeit ist diese Frage oftmals berechtigt. Die Frage könnte sich auch ein kritischer Beobachter des kirchlichen Zeitgeschehens gestellt haben, nachdem Papst Innozenz III. in der 13. Konstitution des Vierten Laterankonzils von 1215, welche 1234 in die Dekretalensammlung Papst Gregors IX. aufgenommen wurde (vgl. X 3.36.9), mit deutlichen Worten die Gründung neuer Orden verboten hatte:
„Ne nimia religionum diversitas gravem in Ecclesia Dei confusionem inducat firmiter prohibemus ne quis de caetero novam religionem inveniat sed quicumque voluerit ad religionem converti unam de approbatis assumat. Similiter qui voluerit religiosam domum fundare de novo regulam et institutionem accipiat de religionibus approbatis. […] (dt.: Damit nicht eine zu große Vielfalt der Orden zu schwerer Verwirrung in der Kirche Gottes führt, verbieten wir nachdrücklich, dass jemand in Zukunft einen neuen Orden erfindet, sondern wer sich zum Ordensleben hinwenden möchte, hat eine der bereits approbierten Gemeinschaften zu nehmen. Ebenso hat, wer ein Klostergebäude wiedererrichten will, die Regel und Satzung von den approbierten religiösen Gemeinschaften zu empfangen. […]).“
Das Verbot fällt in eine Zeit der stürmischen Entwicklung zahlreicher neuer Ordensgemeinschaften mit eigenen Ordensregeln. So hatte beispielsweise Papst Calixt II. im Jahre 1119 die Carta caritatis (dt. Text hier) bestätigt, welche gleichsam die Gründungsurkunde der im Kern von benediktinischer Spiritualität geprägten Zisterzienser darstellt. Im darauffolgenden Jahr gründete Norbert von Xanten den Orden der Prämonstratenser, die als regulierte Chorherren der Ordensregel des Augustinus folgten. Papst Innozenz II. approbierte 1133 die Consuetudines Cartusiae als Regel der Kartäuser. In die Regierungszeit Innozenz III. fallen sodann die Anfänge von drei der vier klassischen Bettelorden (Mendikantenorden). Für seine Gemeinschaft der Minderen Brüder (heute: Ordo Fratrum Minorum, Ordo fratrum minorum conventualium, Ordo Fratrum Minorum Capucinorum, [„braune“ Franziskaner, „schwarze“ Franziskaner (Minoriten), Kapuziner]) hatte Franz von Assisi bereits 1210 eine päpstliche Bestätigung erhalten, so dass der Erste franziskanische Orden vom Verbot von 1215 nicht betroffen war. Die dritte Fassung der Ordensregel (regula bullata) erhielt ihren päpstlichen Segen 1223 von Papst Honorius III. mit der Bulle Solet annuere. Dagegen musste Klara von Assisi, die Gründerin des Zweiten franziskanischen Ordens (Ordo Sanctae Clarae aka Poor Clares [Klarissen]), lange Zeit um eine eigenständige Ordensregel, in der auch ihr striktes Armutsideal ausdrücklich verankert war, kämpfen; die dazu von ihr selbst verfasste dritte Regel ihrer Gemeinschaft wurde erst 1253 von Papst Innozenz IV. mit der Bulle Solet annuere bestätigt. Honorius III. approbierte 1216 mit der Bulle Religiosam vitam die erste Ordensregel des Ordo Praedicatorum (Dominikaner). Der besondere Trick dabei war, dass die dominikanische Regel auf der Augustinusregel aufbaute, so dass den Bestimmungen des Konzils genüge getan war. Bereits vor 1215 hatte Alberto Avogadro, der damalige lateinische Patriarch von Jerusalem, den auf dem Berg Karmel lebenden Eremiten die Albertsregel gegeben, die 1226 von Honorius III. für den sich formierenden Ordo Fratrum Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo (Karmeliten) bestätigt wurde. 1247 erhielt der Orden von Innozenz IV. mit der Bulle Quem honorem Conditoris (engl. Text hier) eine neue Regel. Päpstlicher Initiative verdankt sich schließlich der Ordo [Eremitarum] Sancti Augustini (Augustiner[eremiten]), nachdem Innozenz IV. zunächst 1244 den Zusammenschluss mehrerer Gemeinschaften von Eremiten in die Wege geleitet und Papst Alexander IV. daraufhin 1256 mit der Bulle Licet ecclesiae catholicae (lat./it. Text hier) den Orden geformt hatte.
Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass Innozenz III. mit der 13. Konstitution des IV. Laterankonzils keineswegs die spirituellen Aufbrüche seiner Zeit unterbinden wollte, sondern vielmehr beabsichtigte, einerseits das besondere Charisma der neuen Gründungen zu fördern, andererseits sie an die Tradition der Kirche rückzubinden und so potenziell häretischen Wildwüchsen zu wehren. In diesem Sinne hat etwa auch Thomas von Aquin in seiner theologischen Summe die Frage diskutiert, ob die Vielzahl der Orden erstrebenswert ist (vgl. S.Th. 2/2, q. 188 art. 1). Mit dem ihm eigenen Realitätssinn kam er zu dem Ergebnis, dass im Bereich der Orden die Einheit im Wesentlichen durch die Bindung an die drei evangelischen Räte gewahrt ist; und es durchaus nützlich sei, wenn unterschiedliche Orden sich unterschiedlichen Zwecken und Gründungscharismen widmen. Um die von manchen befürchtete Verwirrung in der Kirche zu vermeiden, sei ausreichend, dass neue Orden vom Papst approbiert werden müssten. Danach hat zwar erneut das Zweite Konzil von Lyon in seiner 23. Konstitution die Wirkungslosigkeit des Verbots neuer Orden durch das Vierte Laterankonzil beklagt und einen nochmaligen Versuch unternommen, neue Ordensgründungen – mit Ausnahme der Dominikaner, Franziskaner, Karmeliter und Augustiner – zu verbieten (vgl. VI° 3.17.1). Allerdings hat sich dieses Verbot keiner dauerhaften Rezeption erfreut.
Die unmittelbare Rechtsgeschichte des heutigen c. 579 beginnt daher erst mit den „gesetzgeberischen Experimenten“ (eigene Diktion), die Papst Pius X. im Vorfeld der Kodifikation des Kirchenrechts anfangs des 20. Jh. veranstaltet hat; näherhin mit seinem Motu Proprio Dei providentis vom 16.07.1905 (vgl. ASS 39 [1906] 344–346). Darin traf der Papst folgende Anordnung:
„Nullus Episcopus aut cuiusvis loci Ordinarius, nisi habita Apostolicae Sedis per litteras licentia, novam alterutrius sexus sodalitatem condat aut in sua dioecesi condi permittat (dt.: Kein Bischof oder Ortsordinarius wolle eine neue Gemeinschaft, gleich welchen Geschlechts, gründen oder ihre Gründung in seinem Bistum zulassen, außer mit schriftlicher Erlaubnis des Apostolischen Stuhls).“
Auf dieser Basis hat der pio-benediktinische Kodex von 1917 in can. 492 § 1 erklärt:
„Episcopi […] condere possunt Congregationes religiosas; sed eas ne condant neve condi sinant, inconsulta Sede Apostolica; […] (dt.: Bischöfe […] können Kongregationen gründen; sie dürfen sie aber weder gründen noch ihre Gründung durch Dritte zulassen, ohne sich mit dem Apostolischen Stuhl beraten zu haben; [...]).“
In der nachkonziliaren Kodexreform erhielt diese Norm mit c. 579 CIC/1983 folgende Fassung:
„Episcopi dioecesani, in suo quisque territorio, instituta vitae consecratae formali decreto erigere possunt, dummodo Sedes Apostolica consulta fuerit (dt.: Die Diözesanbischöfe können in ihrem Gebiet durch förmliches Dekret Institute des geweihten Lebens errichten, jedoch nur nach Beratung mit dem Apostolischen Stuhl).“
Das Thema der Beratung ist in etlichen Normen des CIC/1983 präsent, wobei bald das Substantiv „consultatio“ (vgl. cc. 353 § 2, 501 § 3, 625 § 3, 633 § 1, 633 § 2, 844 § 5), bald das Verb „consulere“ (vgl. cc. 407 §§ 1-2, 567 § 1, 595 § 1, 616 § 1, 733 § 1, 830 § 1, 1041 Nr. 1, 1044 § 2 Nr. 2, 1127 § 2, 1184 § 2, 1189, 1355 § 1 Nr. 2, c. 1356 § 2, 1424, 1566), und bald – im Fachausdruck „beratendes Stimmrecht (suffragium consultativum, votum consultativum) das Adjektiv „consultivus“ (vgl. cc. 443 §§ 3-5, 444 § 2, 450 § 1, 454 § 2, 466, 500 § 2, 514 § 1, 536 § 2, 833 Nrn. 1 u. 4) verwendet wird. Eine Beratung erwartet das kodikarische Recht zudem immer dann, wenn ein Rat („consilium“) im Sinne eines Beratungsorgans in Erscheinung tritt. Eine Konsultation des Apostolischen Stuhls sieht der Kodex außer in c. 579 a.F. allerdings nur noch in den beiden prozessrechtlichen Normen des c. 1699 § 2 und des c. 1707 § 3 vor. In beiden Fällen empfiehlt der Gesetzgeber dem für ein Nichtvollzugsverfahren bzw. ein Verfahren zur Todeserklärung zuständigen Diözesanbischof, sich in Fällen, die „besondere Schwierigkeiten in rechtlicher oder moralischer Hinsicht [aufweisen]“ bzw. in „unsicheren und verwickelten Fällen“ mit dem Apostolischen Stuhl zu beraten. Damit ist klar, dass es insoweit um echte Beratung geht, so dass die an sich zuständige Autorität, die sich möglicherweise zum ersten und einzigen Mal in ihrer Amtszeit mit einem derartigen Problemfall konfrontiert sieht, von dem einschlägigen Erfahrungsvorsprung und dem „kulturellen Gedächtnis“ der Römischen Kurie profitiert. In keiner Weise aber hat die in diesen Normen geregelte Beratung des Apostolischen Stuhls den Charakter eines Beispruchsrechts im Sinne des c. 127 § 2 Nr. 2, so dass die weiteren Handlungen des Diözesanbischofs ohne besagte Beratung rechtsunwirksam wären.
Die hiermit einhergehende Unverbindlichkeit der in c. 579 a.F. vorgesehenen Beratung ist offenbar in Rom insbesondere bei der zuständigen Kongregation für die Institute des geweihten Lebens und die Gesellschaften des apostolischen Lebens als misslich empfunden wurden. Sie hat geltend gemacht, dass man vor der Gründung neuer Institute auf diözesaner Ebene zunächst die Originalität des Charismas ebenso wie die Entwicklungsprognose etwaiger Neugründungen prüfen müsse; auf diözesaner Ebene sei hierfür nicht immer das gebotene Unterscheidungsvermögen vorhanden.
Bereits im Mai 2016 hatte daher Papst Franziskus gemäß einem Rescriptum ex Audientia Ss.mi des Kardinalstaatssekretärs vom 11.05.2016 (vgl. AAS 108 [2016] 696) verfügt, dass mit Wirkung vom 01.06.2016 die in c. 579 vorgeschriebene Konsultation des Apostolischen Stuhls bei der diözesanen Neugründung von Ordensinstituten zur Gültigkeit (ad validitatem) verlangt werde.
Am Hochfest Allerheiligen im Jahr des Herrn 2020 hat Papst Franziskus nun mit dem Motu Proprio Authenticum charismatis, welches der Vatikanische Pressesaal am 04.11.2020 veröffentlich hat, diese zunächst außerkodikarische Rechtsänderung des gesamtkirchlichen Rechts in den Kodex überführt und c. 579 mit Wirkung vom 10.11.2020 den eingangs zitierten Wortlaut gegeben. Die Änderungen sind auf den ersten Blick unscheinbar. Zum einen wird „dummodo Sedes Apostolica consulta fuerit“ zu „praevia licentia Sedis Apostolicae scripto data“ abgeändert. Es wird also anstelle der Inanspruchnahme einer römischen Beratung eine vorherige schriftliche Genehmigung („licentia“) verlangt. Durch die weitere Einfügung der Vokabel „valide“ wird unmissverständlich verdeutlicht, dass diese Genehmigung nicht nur zur Erlaubtheit einer diözesanen Ordensgründung verlangt wird, sondern zu deren Gültigkeit.
Allein die Vokabel „valide“ – um auf Wendungen mit dem Synonym „ad validitatem“ bzw. die Gegenbegriffe „invalidus“, „invalide“ nicht weiter einzugehen – ist im Kodex mit über 70 Belegstellen breit vertreten. Die Belegstellen sind dabei interessanter Weise über alle sieben Bücher des Kodex mit Ausnahme des Buches III zum Verkündigungsdienst verstreut. Ebenso ist die Vokabel „licentia“ mit rund 80 Belegstellen ein häufig vom Gesetzgeber gebrauchter Ausdruck. Eine Erlaubnis des Apostolischen Stuhls verlangt das kodikarische Recht dabei für folgenden Anlässe: Wechsel der Rituskirche (c. 112 § 1 Nr. 1); Änderungen in Instituten des geweihten Lebens, soweit der status quo vom Apostolischen Stuhl approbiert ist (c. 583); Errichtung eines Nonnenklosters (c. 609 § 2); Veräußerungsgeschäfte juristischer Personen des Ordensrechts jenseits der „Romgrenze“ und Vermögenserwerb in besonderen Fällen (c. 638 § 3); Übertritt von einer Lebensgemeinschaft der evangelischen Räte in eine andere, sofern die beide Lebensgemeinschaften verschiedenen Rechtsformen (Religioseninstitut, Säkularinstitut, Gesellschaft des Apostolischen Lebens) zugeordnet sind (cc. 684 § 5, 730, 744 § 2); Erlaubnis für einen Diözesanbischof, Laien zur Trauungsassistenz zu delegieren (c. 1112 § 1); Veräußerung oder Translation von bedeutenden Reliquien (c. 1190 § 2); Veräußerung von Sachen, deren Wert die „Romgrenze“ übersteigt bzw. die künstlerisch oder historisch besonders wertvoll sind (c. 1292 § 2). Damit ist auffällig, dass Erlaubnisvorbehalte zugunsten des Apostolischen Stuhls gehäuft im Ordensrecht begegnen und dort augenscheinlich den Zweck verfolgen, das Charisma der Gemeinschaft sowie die (anfängliche) Berufung des Einzelnen zu einem bestimmten Typus der Lebensgemeinschaft der evangelischen Räte (Religioseninstitut, Säkularinstitut, Gesellschaft des Apostolischen Lebens) zu schützen. Eine explizite Betonung, dass die Erlaubnis des Apostolischen Stuhls zur Gültigkeit der nachfolgenden Handlung erforderlich ist, begegnete dabei bislang nur in cc. 638 § 3, 1190 § 2 und 1292 § 2.
Kann sich die Neufassung des c. 579 nach alledem in das von Papst Franziskus propagierte Rezept einer „heilsamen Dezentralisierung“ (vgl. Papst Franzikus, Evangelii Gaudium, Nr. 16) der Kirche einfügen? Denn anscheinend besteht doch eine erhebliche Spannung zwischen der eingangs der Arenga des Motu Proprio getroffenen Feststellung, den Hirten der Teilkirchen komme das „Urteil über die Kirchlichkeit und die Vertrauenswürdigkeit der Charismen“ zu, und der wenig später folgenden Erklärung, es sei der Apostolische Stuhl, „dem allein das letzte Urteil zusteht“. Dabei ist freilich zu sehen, dass die Initiative für Neugründungen von Ordensgemeinschaften durchaus nach wie vor dezentral bei den einzelnen Diözesanbischöfen verbleibt. Der Apostolische Stuhl sichert sich – je nach Perspektive: jedoch oder nur – ein Vetorecht gegen seines Erachtens verfehlte Neugründungen.
Dazu hat der am 18.11.2020 verstorbene Kanonist und Ordensmann Stephan Haering in seinem letzten Beitrag zum Wissenstransfer aus der akademischen Theologie in Kirche und Gesellschaft, nämlich einem Interview für das Portal katholisch.de, erläutert, dass und inwiefern der Apostolische Stuhl wohl aufgrund schlechter Erfahrungen in der Vergangenheit einen entsprechenden Handlungsbedarf gesehen hat.
In der Tat ist diese Motivlage des Apostolischen Stuhls bereits aus der Begründung zum Reskript von 2016 bekannt und wird erneut in der Arenga des aktuellen Motu Proprio deutlich. Dort wird mit zwei Zitaten aus dem Ordensdekret Perfectae Caritatis des II. Vaticanums, dort Nr. 19, sowie aus dem nachsynodalen Apostolischen Schreiben Vita consecrata von Papst Johannes Paul II., dort Nr. 12, auf das Problem hingewiesen, dass „nicht voreilig unzweckmäßige oder kaum lebensfähige Institute entstehen“ sollen und ihrer Errichtung eine kritische Prüfung vorausgesehen muss, „um die Echtheit der inspirierenden Zielsetzung zu prüfen wie auch die übermäßige Vermehrung nahezu gleicher Institutionen zu vermeiden, die die Gefahr einer schädlichen Aufsplitterung in zu kleine Gruppen nach sich ziehen könnte“. Hierzu ließe sich freilich kritisch einwenden, dass aus dieser Problemanzeige an und für sich noch nicht folgt, dass dem Apostolischen Stuhl insoweit Mitsprache und Vetorechte zustehen müssten. Dabei muss auch gar nicht verhehlt werden, dass schon Johannes Paul II. in seinem Schreiben Vita consecrata in unmittelbarem Anschluss an das obige Zitat erklärte, dass für die offizielle Anerkennung neuer Formen des geweihten Lebens allein der Apostolische Stuhl zuständig sei; und dazu auch zutreffend auf die Norm des c. 605 verwies. Zu beachten ist an dieser Stelle nämlich der systematische Kontext: Denn sowohl in c. 605 als auch in Nr. 12 von Vita consecrata geht es – anders als in c. 579 – nicht um neue Ordensinstitute, sondern um neue Typen des Ordenslebens, jenseits der derzeit bekannten Typologie Religioseninstitute – Säkularinstitute – Gesellschaften des Apostolischen Lebens.
Zu Recht heißt es daher im Motu Proprio auch, dass die verfügte Rechtsänderung das Ergebnis einer Abwägung ist. Und zwar – wie der Blick in die Rechtsgeschichte zeigt – einer Abwägung, die durchaus auf interessante Parallelen in früheren Epochen der Kirchengeschichte verweisen kann. Nach meinem Dafürhalten ist die getroffene Abwägung im Widerstreit der verschiedensten Interessen der verschiedensten Player und Stakeholder rund um etwaige Ordensneugründungen auch sachgerecht und dürfte insbesondere auch kirchliche Gemeinwohlinteressen angemessen zur Geltung bringen. Zugleich ist das geltende Recht an dieser Stelle eindeutig von Zweckmäßigkeitserwägungen und nicht von (scheinbaren) theologischen Notwendigkeiten geprägt.
An diesem Befund vermag auch die in der Arenga als Argument für die Zuständigkeit des Apostolischen Stuhls nachgeschobene Begründung, dass diözesane Ordensgründungen quasi automatisch von gesamtkirchlicher Bedeutung seien, nichts zu ändern. Denn dieses Argument ist wenig überzeugend. Das für diese These als Autoritätsbeweis angeführte Zitat aus dem Apostolischen Schreiben zum Jahr des geweihten Lebens von Papst Franziskus, dort III.5, ist dahingehend zu hinterfragen, ob die dortige Redeweise von der „gesamten Kirche“, die durch das geweihte Leben beschenkt ist, tatsächlich die Gesamtkirche als Gegenüber zu den Teilkirchen meint – oder ob Papst Franziskus unter der „gesamten Kirche“ hier in erster Linie das Volk Gottes im Ganzen verstanden hat, wie es folgendes Zitat aus Abschnitt III.2 desselben Schreibens nahelegt:
„Das Jahr des geweihten Lebens betrifft nicht nur die geweihten Personen, sondern die gesamte Kirche. So wende ich mich an das ganze Volk Gottes, dass es sich des Geschenkes immer bewusster werde, das in der Gegenwart vieler Ordensfrauen und -männer besteht; sie sind die Erben großer Heiliger, welche die Geschichte des Christentums bestimmt haben.“
c. 1368 CIC n.F. (c. 1369 CIC a.F.)
„Qui in publico spectaculo vel concione, vel in scripto publice evulgato, vel aliter instrumentis communicationis socialis utens, blasphemiam profert, aut bonos mores graviter laedit, aut in religionem vel Ecclesiam iniurias exprimit vel odium contemptumve excitat, iusta poena puniatur.“
„Wer in einer öffentlichen Aufführung oder Versammlung oder durch öffentliche schriftliche Verbreitung oder sonst unter Benutzung von sozialen Kommunikationsmitteln eine Gotteslästerung zum Ausdruck bringt, die guten Sitten schwer verletzt, gegen die Religion oder die Kirche Beleidigungen ausspricht oder Hass und Verachtung hervorruft, soll mit einer gerechten Strafe belegt werden.“
von Anna Krähe
Der vorliegende Beitrag eröffnet eine sechsteilige Reihe zum Thema: „Wann Kirche straft und warum“, in der ausgewählte Kanones aus dem besonderen Teil des kirchlichen Sanktionsrechts, cc. 1364–1398 CIC n.F., vorgestellt werden.
Hinweis: Mit der Apostolischen Konstitution „Pascite gregem Dei“ vom 23. Mai 2021 hat Papst Franziskus Kanones im Buch VI des CIC/1983 „Die Strafbestimmungen in der Kirche“ promulgiert (Kanones lat.; Kanones dt.). Sie sind am 8. Dezember 2021 in Kraft getreten. Der folgende Text wurde daher überarbeitet. Dabei wurden den Kanones des kirchlichen Strafrechts zur Unterscheidung der besprochenen Norm die Kürzel „a.F.“ (= alte Fassung) sowie „n.F.“ (= neue Fassung) hinzugefügt und teils auch Anpassungen des Textes vorgenommen.
Gott sprach: „Es werde Licht!“ Chuck Norris antwortete: „Sag bitte!“
Ein Witz, ein Spruch. Vielleicht bringt er einige zum Schmunzeln, andere verdrehen möglicherweise die Augen, wieder andere überhören ihn ganz und gar. Fernab von ambivalenten Gefühlen gegenüber Chuck-Norris-Witzen ist diese Art humoriger, spitzer Bemerkung über Religionen, deren Institutionen und Bekenntnisinhalte eben ein Teil unseres Zusammenlebens in einer freien und pluralen Gesellschaft, in der eine Vielfalt von Meinungen und Interessen Platz haben soll und muss. Dennoch scheint teils die gesellschaftliche Qualität der gegenseitigen Toleranz, durch welche Spannungen innerhalb der Gesellschaft zumindest erträglich und im besten Fall konstruktiv werden können, zu schwinden. Dies betrifft wohl gerade auch Auseinandersetzungen um Äußerungen im Rahmen der Meinungsfreiheit als (vermeintliches) Gegenüber zur Ausübung der Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Dass das Grundvertrauen in ein friedliches, von Verständnis und Verständigung geprägtes Zusammenleben gerade bei diesem Thema ins Wanken zu geraten scheint, zeigen inzwischen leider auch teils gewaltsame Ausschreitungen. Deutlich wird das Ringen um die Frage, was über Glauben, Religion und Weltanschauung denn nun gesagt werden darf und was nicht, aber gerade auch in den Diskussionen um satirische Beiträge und Darstellungen (vgl. exemplarisch bzgl. der kath. Kirche: SZ.de zum Thema Papst-Karikatur in „Titanic“; postillion.de zu „Waria, die fiese Widersacherin von Maria“; katholisch.de zu „Maria 2.0 – Die Carolin Kebekus Show“). Bis heute wird in § 166 StGB die Beschimpfung der Inhalte religiöser oder weltanschaulicher Bekenntnisse in der Öffentlichkeit oder durch die Verbreitung von Schriften (Abs. 1) sowie in gleicher Weise von inländischen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, ihren Einrichtungen oder Gebräuchen unter Strafe gestellt (Abs. 2), sofern dieses Verhalten geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Der staatliche Schutz durch § 166 StGB ist mit eine Konsequenz aus der Garantie der Religions- und Weltanschauungsfreiheit in Art. 4 GG, welche Religionen und Weltanschauungen als Teil der Gesellschaft anerkennt und ihnen einen Ort innerhalb des öffentlichen Zusammenlebens im Staat garantiert. Insofern dient § 166 StGB durchaus auch dem Schutz religiöser und weltanschaulicher Bekenntnisse. Die eigentliche, von derartigen Beschimpfungen ausgehende Gefahr, benennt der staatliche Gesetzgeber aber in der Norm selbst: Ihm geht es darum, seiner ureigenen Aufgabe nachzukommen, den Frieden, damit das Wohl der Gemeinschaft und die möglichst freie Entfaltung des Einzelnen in der Gesellschaft zu sichern.
Der staatlichen Norm durchaus vergleichbar, jedoch mit anderen Bezügen, hat der kirchliche Gesetzgeber seine Regelung zur Sanktionierung der Beleidigung und Verächtlichmachung von Glauben, Sitten und Religion getroffen. Der c. 1368 CIC n.F. (c. 1369 CIC a.F.; der Wortlaut wurde nicht verändert) – ebenso wie sein fast gleichlautender Bruder can. 1448 § 1 CCEO – normiert eine ganze Reihe verschiedener Straftatbestände, die sich grundsätzlich gegen die Herabsetzung und Herabwürdigung Gottes, der guten Sitten, der Religion bzw. der Kirche richten. Der Kanon gehört in das sechste Buch des CIC/1983 „Über die Sanktionen in der Kirche“ und dort in den zweiten Teil „Über die Strafen für einzelne Straftaten“. Titel I handelt in den cc. 1364–1369 CIC n.F. „Über Delikte gegen den Glauben und die Einheit der Kirche“. Die Normen des speziellen oder besonderen Sanktionsrechts benennen grundsätzlich sowohl den Tatbestand eines Vergehens als auch die Rechtsfolge bei Verletzung Norm bzw. Erfüllung des Straftatbestands. Zunächst werden dazu alle objektiven Kriterien für das Vorliegen der deliktischen Handlung oder auch des Unterlassens genannt – wer kann Straftäter*in sein, worin bestehen Taterfolg und Tathandlung. Hinzu kommen möglicherweise auch spezielle subjektive Merkmale, die über das notwendige Vorliegen von Vorsatz bei der Begehung der Tat hinausgehen. Auf Seiten der Rechtsfolge steht die Strafandrohung, also die Vorgabe des Gesetzgebers, wie und ggf. mit welchem Strafrahmen ein*e mögliche*r Straftäter*in bestraft werden kann, wenn denn alle Tatbestandsmerkmale erfüllt sind.
Mit c. 1368 CIC n.F. (c. 1369 CIC a.F.) hat der kirchliche Gesetzgeber sich für einen recht dichten Tatbestandsteil entschieden, der in sich mehrere, ähnlich gelagerte Delikte vereint. Im Gesetzbuch von 1917 waren die heute zusammengefassten Straftatbestände teils in den cann. 2323, 2344 enthalten. Strittig war seinerzeit, ob eine Gotteslästerung ausschließlich mittels Worten oder auch auf andere Art (beispielsweise durch Gesten oder Zeichnungen) begangen werden konnte. Einigkeit bestand darin, dass die geringschätzige Äußerung sich nicht nur gegen Gott selbst, sondern auch gegen Heilige oder heilige Sachen richten konnten. Für den Gesetzgeber des CIC/1917 genügte auf subjektiver Seite wohl das Wissen um die Bedeutung und den Inhalt der blasphemischen Äußerung. Die Absicht zur Beleidigung Gottes war nicht gefordert. Zumeist stand die Gotteslästerung nach Überzeugung der Kommentatoren in Verbindung mit einer Häresie. Beschimpfungen des Apostolischen Stuhls wurden nicht im Rahmen der Blasphemie nach can. 2323 CIC/1917 sanktionsbedroht, sondern fielen nach herrschender Meinung unter can. 2344 CIC/1917 als gegen die Kirche gerichtete Straftat. Dort wurden unter anderem Papst, Legaten oder eigene Ordinarien explizit aufgezählt, deren guter Ruf durch die Strafandrohung geschützt werden sollte. Daher fiel auch sachliche Kritik, die auf nachweislichen Tatsachen beruhte, nicht unter diese Norm. Die CIC-Reformkommission hatte keine derartigen Regelungen in das Strafrechtsschema von 1973 aufgenommen. Erst aufgrund zahlreicher Eingaben der Konsultoren fand die Norm in ihrer heutigen, umfangreichen Form Eingang in die Reihe der Straftatbestände (vgl. Com 9 [1977], 320f.).
Was wird nun aber unter Geltung des kirchlichen Gesetzbuches von 1983 in c. 1368 n.F. (c. 1369 a.F.) definiert, mit einer Sanktion bedroht und geschützt?
Geklärt werden soll zunächst das „Wer“: Wie in einem großen Teil der kirchlichen Straftatbestände werden die Adressaten in c. 1368 CIC n.F. (c. 1369 CIC a.F.) nicht näher qualifiziert. Das „qui“ zeigt an, dass hier generell diejenigen in den Blick zu nehmen sind, für die kirchliche Sanktionsgesetze gelten. Abgesehen von den allgemeinen Normen über diejenigen, die sich strafbar gemacht haben, cc. 1321–1330 CIC n.F., sowie Hinweisen in cc. 1311 CIC n.F. findet sich im CIC/1983 keine direkte Regelung des personalen Geltungsbereichs kirchlicher Sanktionsnormen. Daher muss zur näheren Bestimmung der Umweg über c. 11 CIC gegangen werden, wonach durch rein kirchliche Gesetze nur und all jene verpflichtet werden, die in der katholischen Kirche des lateinischen Rechts getauft oder in sie aufgenommene wurden. Die Normen des kirchlichen Sanktionsrechts verdanken sich nach ganz herrschender Meinung rein kirchlicher Setzung, sodass sie lediglich Katholik*innen verpflichten.
Die nächste Frage ist, was besagte Katholik*innen denn nun eigentlich tun müssten oder, um einer Sanktion zu entgehen, besser unterlassen sollten – Worin bestehen in c. 1368 CIC n.F. (c. 1369 CIC a.F.) also Tathandlung und Taterfolg: In der etwas summarischen Aufzählung innerhalb des Gesetzes können verschiedene Straftatbestände ausgemacht werde. 1) Eine Gotteslästerung aussprechen; 2) die guten Sitten schwer verletzen (hierunter kann z.B. auch die Unterstützung von Prostitution, Abtreibung oder Missbrauch von Kindern verstanden werden); 3) gegen die Religion Beleidigungen aussprechen; 4) gegen die Kirche Beleidigungen aussprechen; 5) Hass und Verachtung gegen die Religion erregen; 6) Hass und Verachtung gegen die Kirche erregen (wobei dies von c. 1373 CIC n.F. abzugrenzen ist). Jede dieser einzelnen Tatbestandsumschreibungen bedarf zumeist noch einer näheren Erläuterung, da gerade Begriffe wie „gute Sitten“ oder „Religion“ ebenso wie „Beleidigung“ und „Hass“ vom Gesetzgeber zumindest im Kodex selbst nicht näher definiert wurden und daher sowohl von der Kanonistik als auch im konkreten Einzelfall durch die zuständigen Richter*innen zunächst ausgelegt und näher bestimmt werden müssen. Für die Blasphemie findet sich eine Definition außerkodikarisch in Nr. 2148 KKK, welcher auch auf c. 1368 CIC n.F. (c. 1369 CIC a.F.) verweist. Eingebettet ist diese Definition in die Ausführungen zum zweiten Gebot des Dekalogs, wobei die Gotteslästerung als direkter Verstoß gegen dieses Gebot zu verstehen ist. Dieser biblische Ursprung ändert nichts daran, dass die Sanktionsnorm im Grundsatz und in ihrer Ausformung rein kirchliches Recht bleibt. In knapper Form kann gesagt werden, dass unter Gotteslästerung „jede, das religiöse Empfinden der Gläubigen verletzende Beleidigung Gottes“ zu verstehen ist (Rees, Die Strafgewalt der Kirche, 437), wobei Gott hier im Sinne von Vater, Sohn und Heiligem Geist zu verstehen ist. Das Beleidigende wiederum kann in der Herabwürdigung einer göttlichen Person liegen – beispielsweise darin, dass Gott Vater seine Allmacht abgesprochen wird (z.B. indem Chuck Norris zum obersten Schöpfer erklärt wird) –, in einer missbräuchlichen Verwendung des Gottesnamens, in gegenüber Gott geäußerten Herausforderungen oder Hass. Nr. 2148 KKK stellt auch klar, dass es ebenso „[g]otteslästerlich ist […], den Namen Gottes zu mißbrauchen, um verbrecherische Handlungen zu decken, Völker zu versklaven, Menschen zu foltern oder zu töten. Der Mißbrauch des Namens Gottes zum Begehen eines Verbrechens führt zur Verabscheuung der Religion.“ Die in den verschiedenen Straftatbeständen des c. 1368 CIC n.F. (c. 1369 CIC a.F.) genannten Äußerungen müssen im äußeren Bereich wirksam werden (vgl. c. 1330 CIC n.F.), also äußerlich wahrnehmbar sein. Ausgeschlossen sind damit reine Gedanken und Empfindungen. Sanktioniert wird aber auch eine Äußerung im forum externum nur dann, wenn diese nicht im rein privaten Bereich verbleibt, sondern ein öffentlicher Rahmen dafür gewählt wird: Die öffentliche Aufführung oder Versammlung, die Verbreitung öffentlicher Schrift(en) oder der Einsatz anderer sozialer Kommunikationsmittel. Auch wenn der kirchliche Gesetzgeber seinerzeit gerade mit den „sozialen Kommunikationsmitteln“ wohl eher Bücher und andere Druckwerke im Blick hatte, lässt sich unter diesen weiten Begriff heute auch jede Form digitaler Äußerung subsumieren, die darauf zielt, eine breite und im Einzelnen unbestimmte Öffentlichkeit zu erreichen.
Wurden einer oder mehrere dieser objektiven Tatbestandsmerkmale erfüllt und hat der bzw. die Betreffende diese Tat auch vorsätzlich begangen, dann ist er oder sie zu bestrafen. Die Sanktionsandrohung des Kanons, die „iusta poena“ („congrua poena“ in can. 1448 § 1 CCEO), die „gerechte Strafe“ gehört in die Kategorie der sogenannten unbestimmten Sanktionen (c. 1315 § 2 n. 3 CIC n.F.). Mit dieser Sanktionsform eröffnet der kirchliche Gesetzgeber denjenigen, die eine kirchliche Sanktion verhängen, die (fast) ganze Bandbreite der zur Verfügung stehenden kirchlichen Strafmittel; Rückschlüsse aus den cc. 1317–1319 CIC n.F. legen jedoch nahe, dass besonders schwere Strafen und Strafen, die für immer verhängt werden, hier ausgeschlossen sind. Über den Bereich des kirchlichen Sanktionsrechts im CIC/1983 hinaus können die Folgen in Deutschland aber auch arbeitsrechtlicher Natur sein. Nach Art. 5 Abs. 2 1. c) der Grundordnung des kirchlichen Dienstes stellt die Straftat des c. 1369 CIC a.F. sowie wohl auch des c. 1368 CIC n.F. für Angehörige des kirchlichen Dienstes einen schwerwiegenden Loyalitätsverstoß dar und wird damit grundsätzlich als Kündigungsgrund angesehen.
Warum stellt aber nun der kirchliche Gesetzgeber Gotteslästerung, die Beleidigung von Kirche und Religion und all die in c. 1368 CIC n.F. (c. 1369 CIC a.F.) genannten Handlungen unter Strafe? Um dieser Frage näher zu kommen, ist zunächst zu bedenken, dass Sanktionsnormen im Allgemeinen den Schutz bestimmter, in einer Rechtsordnung bedeutender Güter und Rechte zum Ziel haben. Diese werden vom jeweiligen Gesetzgeber als so konstitutiv für das Bestehen der (Rechts-)Gemeinschaft, für das Wohl ihrer Glieder und für das friedliche Zusammenleben in der Gemeinschaft angesehen, dass ihre Gefährdung und Verletzung verhindert werden muss – zur Not auch mittels Sanktionen gegen Einzelne. Demnach ist die Frage nach der Begründung der Sanktionsandrohung letztlich die Frage nach dem Schutzgut des c. 1368 CIC n.F. (c. 1369 CIC a.F.). Naheliegend erscheint der Schutz der genannten und für die kirchliche Gemeinschaft fundamentalen „Institutionen“ – Gott, die guten Sitten, die Religion, die Kirche selbst. Es geht aber auch darum, die religiösen Gefühle der Gläubigen, welche durch derartige Äußerung zutiefst verletzt werden können, zu schützen. Es soll verhindert werden, dass „Glaube und Sitten der Gläubigen Schaden nehmen“. Dies unterstreicht c. 823 § 1 CIC, gemäß dem die zuständigen Hirten verpflichtet werden, zur Wahrung der Unversehrtheit der Glaubenswahrheiten und der Sittenlehre über den Gebrauch sozialer Kommunikationsmittel zu wachen. Bedeutet dies im Umkehrschluss, dass jede, auch kritische Auseinandersetzung mit Glaubensinhalten und Sittenlehre verboten ist? Keinesfalls. Der kirchliche Gesetzgeber räumt den Gläubigen in c. 212 § 3 CIC das Recht ein, fordert sogar teils die Meinungsäußerung zu Fragen des kirchlichen Wohls; in c. 218 CIC schützt er die Freiheit der theologischen Wissenschaften in Forschung und Meinungsäußerung. Dies kann in eine Spannung geraten zur Sanktionsandrohung des c. 1368 CIC n.F. (c. 1369 CIC a.F.), sodass es im Einzelfall immer einer Abwägung dieser Rechte und Schutzbedürfnisse bedarf; mit Blick auf die ganze kirchliche Gemeinschaft braucht es wohl gerade bei diesen innerkirchlichen Auseinandersetzungen die Fähigkeit zur gegenseitigen Toleranz auf Basis des gemeinsamen Glaubens. Als letztes Mittel bei derartigen innerkirchlichen Kontroversen, wenn notwendige Diskussionen und Mahnungen, umfassende Ärgernisse und Schäden für die Gläubigen nicht verhindern können, dann muss die Kirche mit Sanktionen reagieren. Denn insofern die Kirche als Ganze zum Ziel hat, Heilswege zu eröffnen und zu ermöglichen; auch mit und für die Gläubigen Raum der Gottesbegegnung zu sein, darf sie Schädigungen nicht zulassen, wenn ihre Botschaft – gerade aus den eigenen Reihen heraus – gefährdet wird. Dem ganzen ersten Titel im besonderen Teil des kirchlichen Sanktionsrechts von 1983 geht es insofern darum, den Schutz der eigenen fundamentalen Bestandsmerkmale – der zugeordneten Glaubenswahrheiten, die Aussagen des kirchlichen Lehramts, deren Vermittlung in der christlichen Erziehung zu schützen und auch dadurch die Einheit der Kirche zu sichern, dass dieser verbindende Glaube nicht von Gläubigen, also aus der Kirche selbst heraus, geschädigt wird. Etwas moderner könnte man vielleicht sagen, es geht um den Schutz des Markenkerns von Kirche und doch greift das zu kurz, denn Glauben, Sitten und Institution haben keinen von den Gläubigen unabhängigen Bestand; so gilt es Glauben, Sitten und Kirche gerade für jeden einzelnen Gläubigen und jede einzelne Gläubige sowie für die ganze kirchliche Gemeinschaft zu schützen.
C. 478 § 1: „Vicarius generalis et episcopalis sint sacerdotes annos nati non minus triginta,
in iure canonico aut theologia doctores vel licentiati vel saltem in iisdem disciplinis vere periti,
sana doctrina, probitate, prudentia, ac rerum gerendarum experientia commendati.“
C. 478 § 1: „Generalvikar und Bischofsvikar müssen Priester sein, nicht jünger als dreißig Jahre,
Doktoren oder Lizentiaten im kanonischen Recht oder in der Theologie oder wenigstens in diesen Disziplinen wirklich erfahren, ausgewiesen durch Rechtgläubigkeit, Rechtschaffenheit, Klugheit und praktische Verwaltungserfahrung.“
von Martin Rehak
Im Bistum Würzburg hat Diözesanbischof Dr. Franz Jung am 21.09.2020 das Kirchenamt (vgl. c. 145) des Generalvikars (vgl. c. 475) an Herrn Domdekan Dr. Jürgen Vorndran übertragen, siehe die Berichterstattung hier und hier. Am 27.09.2020 wurde der neue Generalvikar bei einem Pontifikalgottesdienst im Würzburger Kiliansdom öffentlich vorgestellt. Aus diesem Anlass soll im vorliegenden Beitrag das Amt des Generalvikars, insbesondere seine geläufige Charakterisierung als „alter Ego (anderes Ich)“ des Diözesanbischofs in den Blick genommen und das Aufgaben- und Qualifikationsprofil eines Generalvikars (und der Wandel desselben) in rechtsgeschichtlicher Perspektive betrachtet werden.
Das Amt des Generalvikars ist gemäß dem kodikarischen Recht ein verpflichtend in jedem Bistum eingerichtetes Amt (vgl. c. 475 § 1). Gemäß der kanonistischen Unterscheidung von Grund- und Hilfsämtern hat der Generalvikar ein Hilfsamt inne, das auf das Hauptamt des Diözesanbischofs hingeordnet ist. Dies bringt bereits der lateinische Begriff „vicarius (Stellvertreter)“ zum Ausdruck. Der Zuständigkeitsbereich des Generalvikars ist dabei gemäß c. 479 § 1 die Verwaltung (und nicht auch die Gesetzgebung, welche gemäß c. 391 § 2 vom Diözesanbischofs persönlich ausgeübt wird, sowie ebenfalls nicht die Rechtsprechung – hierfür besteht das Hilfsamt des Gerichtsvikars oder Offizials). Damit gehört der Generalvikar als Inhaber ordentlicher, d.h. ihm kraft Amtes zukommender, ausführender Gewalt (ebenso wie der Diözesanbischofs selbst) zu den Ortsordinarien im Sinne des c. 134 §§ 1-2.
Als Stellvertreter des Bischofs in der Verwaltung des Bistums gilt der Generalvikar – so ein geflügeltes Wort – als dessen alter Ego. Dabei sind vor allem die Rechtswirkungen des Handelns eines Generalvikars im Blick. Im Zuständigkeitsbereich des Generalvikars besteht eine „amtliche Identität“ (Mörsdorf, Lehrbuch, Bd. 3, 9. Aufl. 1959 [§ 75 III]) zwischen Generalvikar und Bischof. Daher werden auch beide im Verfahren des hierarchischen Rekurses gemäß c. 1737 als Einheit betrachtet; der für Beschwerden gegen Entscheide des Generalvikars zuständige hierarchische Obere ist also nicht der Diözesanbischof, sondern der Apostolische Stuhl. Zu beachten ist jedoch, dass die Zuständigkeiten eines Generalvikars und eines Diözesanbischofs im Bereich der Verwaltung nicht deckungsgleich sind. Denn grundsätzlich sind überall da, wo das kodikarische Recht vom Ortsordinarius spricht, sowohl der Generalvikar als auch der Diözesanbischof gemeint; überall da jedoch, wo im Gesetz ausdrücklich vom Diözesanbischof die Rede ist, ist in der Tat nur der Diözesanbischof gemeint. Der Generalvikar wäre unzuständig, es sei denn, er hätte vom Diözesanbischof ein so genanntes Spezialmandat erhalten (vgl. c. 479 §§ 1-2).
Lässt sich nun aber das Bild vom Generalvikar als alter Ego des Diözesanbischofs auch von seinem Qualifikationsprofil her deuten? Ein tabellarischer Vergleich der kanonischen Eignungskriterien ergibt folgenden Befund:
| Eignungsvoraussetzungen | ||
zum Bischof gemäß c. 378 § 1 | zum Generalvikar gemäß c. 478 § 1 | ||
Sakramentale Weihe | Priester seit mindestens 5 Jahren | Priester | |
Mindestalter | 35 Jahre | 30 Jahre | |
Akademische Ausbildung | Doktorat od. Lizentiat in Theologie Doktorat od. Lizentiat im Kirchenrecht, hilfsweise wirkliche Bildung in diesen Disziplinen | Doktorat od. Lizentiat im Kirchenrecht Doktorat od. Lizentiat in Theologie, hilfsweise wirkliche Bildung in diesen Disziplinen | |
„Soft-Skills“ | fester Glaube | Rechtgläubigkeit | |
Frömmigkeit, Seeleneifer |
| ||
gute Sitten, menschliche Tugenden | Rechtschaffenheit | ||
guter Leumund | |||
Lebensweisheit, Klugheit | Klugheit | ||
sonstige Eigenschaften, die ihn für das Amt geeignet machen | praktische Verwaltungserfahrung | ||
Dieser Vergleich zeigt, dass das kanonische Recht hinsichtlich der sakramentalen Weihe zum Priester sowie hinsichtlich der akademischen Ausbildung für einen Bischof und einen Generalvikar dieselben Eignungsvoraussetzungen aufstellt. Dass das Aufgabenspektrum eines Bischofs im Vergleich zu dem eines Generalvikars deutlich weiter gespannt ist, spiegelt sich (ein bisschen in der Reihung, in der Theologie und Kirchenrecht jeweils bei den akademischen Qualifikationen genannt werden, vor allem aber) im Vergleich der „Soft-Skills“: Von einem Generalvikar wird verständlicherweise vor allem erwartet, dass er ein guter Verwaltungsmann ist. Bei einem guten Bischof müssen pastorales Geschick und Engagement ebenso wie Lebensweisheit hinzutreten. Dementsprechend fordert das kanonische Recht für den Bischofskandidaten auch ein höheres Mindestalter sowie eine mindestens fünfjährige Praxis im priesterlichen Dienst.
Zusammenfassend lässt sich jedoch sagen, dass im geltenden kanonischen Recht deutliche Parallelen zwischen dem Qualifikationsprofil eines Bischofs und eines Generalvikars bestehen, welche auch unter diesem Aspekt die Redeweise vom Generalvikar als alter Ego nachvollziehbar erscheinen lassen. Dies war jedoch nicht immer so, wie der Blick in die kirchliche Rechtsgeschichte zeigt. Eine Zäsur liegt insoweit allerdings weniger zwischen dem Kodex von 1983 und dem Kodex von 1917. Denn die Norm des c. 478 § 1 schreibt nahezu wortwörtlich die entsprechende Regelung des can. 367 § 1 CIC/1917 fort. Gestrichen wurde lediglich die Klausel, wonach der Generalvikar im Regelfall Weltpriester, nicht Ordenspriester sein soll. Umso markanter sind indes die Unterschiede zwischen den Eignungsvoraussetzungen für einen Generalvikar gemäß can. 367 § 1 CIC/1917 und dem bis dahin geltenden Kirchenrecht. Werfen wir dazu einen Blick auf die Kompilation der älteren Rechtsstoffe, wie sie der an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom lehrende schwäbische Kanonist Franz Xaver Wernz in seinem (aufgrund der nachfolgenden Kodifikation nur kurzlebigen) Standardwerk Ius decretalium (hier Bd. 2/2, Rom 1906, S. 623-626) im Abschnitt De qualitatibus Vicarii generalis zusammengestellt hat:
- Demnach genügte es unter dem Gesichtspunkt der Weihe, dass der Generalvikar durch die Sakramentalie der Ersten Tonsur unter die Kleriker aufgenommen war. Die Priesterweihe war also kirchenrechtlich nicht allgemein vorgeschrieben, wohl aber – so Wernz – bereits in einem Schema des Ersten Vatikanischen Konzils als sehr angemessen empfohlen und zum Teil bereits durch päpstliche Partikulargesetzgebung eingeführt worden.
- Im Zeitpunkt der Amtsübertragung war laut Wernz ein zölibatäres Leben als Unverheirateter verlangt; es kam jedoch in Betracht, auch einem verwitweten Mann das Amt des Generalvikars anzuvertrauen – vorausgesetzt, er war nur einmal und mit einer Jungfrau verheiratet gewesen. Letzteres war eine disziplinäre Regelung, die unter Vermittlung durch eine Dekretale Papst Coelestins I. aus dem Jahr 428 (vgl. PL 50, 435: „nullus digamus, nullus qui sit viduae maritus aut fuerit, ordinetur“) letztlich auf das Sakralrecht des alttestamentlichen Heiligkeitsgesetzes zurückzuführen ist, vgl. Lev 21,13 f.: „Virginem ducet uxorem; viduam et repudiatam et oppressam atque meretricem non accipiet“; ähnlich Ez 44,22.
- Als verpflichtendes Mindestalter war nach dem Dekretalenrecht das 25. Lebensjahr vorgeschrieben, wobei Wernz allerdings ein höheres Mindestalter von 30 Jahren, wie es im Schema des Ersten Vaticanums als Mindestalter für Bischöfe vorgesehen gewesen sei, als zweckmäßig erachtete.
- Schließlich war verlangt, dass der Kandidat für das Amt aus einer legitimen ehelichen Verbindung hervorgegangen ist; von dieser Voraussetzung konnte laut Wernz allein der Apostolische Stuhl dispensieren.
Soweit zu den Unterschieden zwischen der vorkodikarischen und der heutigen Rechtslage. Zugleich sind aber auch folgende Kontinuitäten zu beobachten: Bereits vor 1917 wurde gefordert, dass der Kandidat „probitate vitae, prudentia, rerum gerendarum peritia et competente scientia praesertim iuris canonici sit instructus“. Dabei wurde zum Stichwort „scientia“ allerdings noch kein Doktorat oder Lizentiat wenigstens im kanonischen Recht gefordert, auch wenn – laut Wernz – die zuständigen römischen Kurienkongregationen des Öfteren auf eine entsprechende Graduierung drängten. Ferner waren jene Ausschlussgründe bekannt, die nunmehr in c. 478 § 2 thematisiert werden: Unvereinbarkeit der Ämter des Generalvikars und des Bußkanonikers, um hier eine strukturelle Trennung von äußerer Leitung und geistlicher Seelenführung zu gewährleisten; sowie Ausschluss naher Blutsverwandter, um das Übel des Nepotismus zu unterbinden.
Der bedeutendste Unterschied zwischen den kodikarischen und den vorkodikarischen kanonischen Eignungskriterien eines Generalvikars dürfte nach alledem in der Priesterweihe des Amtsinhabers liegen. Die Entwicklung, die das Kirchenrecht hier genommen hat, wird vor allem im Blick auf die Ursprünge des Amtes der Generalvikare verständlich. Denn dieses Amt hat sich in der lateinischen Kirche erst seit dem hohen Mittelalter herausgebildet und in einem längeren, wohl nicht in allen Teilen der Kirche zeitgleich verlaufenden Prozess, der sich bis zum Konzil von Trient und vereinzelt bis ins 19. Jh. hinzog, das Amt des Archidiakons substituiert. Hinsichtlich der einstigen Bedeutung des Archidiakonats sei daran erinnert, dass wohl in der Struktur der kirchlichen Ämter und Dienste in der alten Kirche sowohl der Priester als auch der Diakon dem Bischof zugeordnet waren; wobei die Priester den Bischof vor allem im Bereich der Liturgie und der Pastoral unterstützt haben, die Diakone hauptsächlich im Bereich der Verwaltung und Diakonie. Daher stand einst der Archidiakon als ranghöchster Diakon an der Spitze des bischöflichen Verwaltungsapparats. Seine Machtstellung – so das geläufige Narrativ der rechtsgeschichtlichen Forschung zum Verhältnis von Archidiakon, Generalvikar und Bischof – war schließlich so überragend, dass die Unabhängigkeit und Letztverantwortung der Diözesanbischöfe in der Verwaltung ihrer Bistümer nicht mehr gegeben war. Die Bischöfe haben daher mit dem Amt des Generalvikars eine neue Struktur etabliert, mit deren Hilfe sie den Archidiakonen langsam aber sicher „das Wasser abgraben“ konnten und sie mit nachhaltiger Wirkung bis auf den heutigen Tag aus dem Gefüge der kirchlichen Ämter und der kirchlichen Verwaltung verdrängt haben. Der besondere Clou des neuen Amtes bestand darin, dass es unbepfründet war, d.h. nicht mit einer bestimmten kirchlichen Vermögensmasse (beneficium, Pfründe) verbunden war, aus der der jeweilige Amtsinhaber seinen Lebensunterhalt bestreiten konnte und musste. Damit war ein Generalvikar als solcher materiell vom jeweiligen Bischof abhängig, so dass wiederum letzterer sich der gesteigerten Loyalität des ersteren sicher sein konnte.
Seitdem haben sich hinsichtlich der Finanzierung von Kirchenämtern im Allgemeinen und der Generalvikare im Besonderen die Verhältnisse grundlegend gewandelt. Denn namentlich in Bayern hatte sich im Bayerischen Konkordat von 1817 der König verpflichtet, neben sonstigen Entschädigungen für die Enteignungen der Kirche in der Säkularisation von 1803 an die Generalvikare jährlich 500 Gulden zu überweisen (vgl. Art. 3 Abs. 5 BayK 1817); diese Regelung wurde im Bayerischen Konkordat von 1924 fortgeschrieben (vgl. jetzt Art. 10 § 1 lit. c BayK). Zugleich hat übrigens der bayerische Staat – Echo eines aufgeklärten Staatskirchentums, welches in der bloßen Hingabe an Gebet und Gottesdienst noch keinen gesamtgesellschaftlichen Mehrwert erblicken konnte – im Konkordat von 1817 von den Mitgliedern der Domkapitel erwartet, dass sie, „nebst dem Chordienste, den Erzbischöfen und Bischöfen in Verwaltung ihrer Diöcesen als Räthe dienen“ (Art. 3 Abs. 3 BayK 1817). Diese Forderung wurde 1924 zwar nicht mehr erhoben. Allerdings erwartet der Staat, dass die Kirche im „Hinblick auf die Aufwendungen des Bayerischen Staates für die Bezüge der Geistlichen […] in der Leitung und Verwaltung der Diözesen […] nur Geistliche [verwendet]“, welche die in Art. 13 § 1 BayK genannten Qualifikationen erfüllen (deutsche Staatsbürgerschaft, Hochschulreife, universitäres Theologiestudium).
Das Amt des Generalvikars kann somit, was äußere Rahmenbedingungen und innere Eignungsvoraussetzungen anbelangt, auf eine durchaus wechselvolle Geschichte zurückblicken, die vielleicht ihren Endpunkt noch nicht erreicht hat. Denn die gegenwärtig an Popularität gewinnende Idee (vgl. hier, hier und hier), die Diözesankurie (sprich: das [erz-]bischöfliche Ordinariat) durch eine „Doppelspitze“ aus Generalvikar und Amtschef*in zu führen und dabei eine für ungeweihte Christgläubige zugängliche Variante des kodikarischen Amts eines Moderators der Kurie (vgl. c. 473 §§ 2-3) zu etablieren, mag längerfristig auch zu einer Neuausrichtung und Profilschärfung des Amtes des Generalvikars beitragen.
Eines ist indes im Wandel der Zeiten bislang gleich geblieben: Der Anspruch gesteigerter Loyalität, wie sie das kodikarische Recht nunmehr in c. 480 einfordert. Im Recht der katholischen Ostkirchen (und entsprechend in den Kirchen der Orthodoxie), wo dem Amt des Generalvikars das Amt des Protosynkellos entspricht (vgl. c. 245 CCEO), wird diese Loyalität ebenfalls als selbstverständlich vorausgesetzt (vgl. c. 249 CCEO). Sie wird dabei interessanter Weise gemäß c. 250 CCEO mit einer Geste besonderer Wertschätzung flankiert, nämlich der Gestattung an jene Protosynkelloi, die der Weihe nach nur Priester sind, für die Dauer ihres Amtes bestimmte bischöfliche Insignien – wie etwa ein Pektorale (Brustkreuz) – zu tragen. Damit wird der „orientalische Generalvikar“ in der laienhaften Außenwahrnehmung vielleicht noch stärker zum „alter Ego“ des Bischofs, als dies in der lateinischen Kirche der Fall ist. (Wobei freilich dem kirchlichen Rechtshistoriker ein Pektorale für den Inhaber eines Amtes, das anfänglich auch lediglich Tonsurierten offen stand, durchaus merkwürdig erscheinen würde.) Wenn nun aber der aufmerksame Beobachter des kirchlichen Zeitgeschehens einwendet, dass doch auch Domdekan Dr. Jürgen Vorndran bei seiner Ernennung ein „Brustkreuz“ getragen habe (siehe hier), so steht dies keineswegs in Widerspruch zu den vorstehenden Darlegungen: Denn jenes Kreuz ist keine Amtsinsignie des neuen Generalvikars, sondern das Domkapitelszeichen, wie es gemäß § 16 Abs. 4 der Statuten des Würzburger Domkapitels ein Bestandteil der Domherrenkleidung ist.
Möge also das Bistum Würzburg in den kommenden Jahren unter seinem amtierenden Bischof und dessen neuen Generalvikar eine gute, von wechselseitiger Loyalität und Wertschätzung inspirierte Leitung erleben.
C. 869 § 1: „Si dubitetur num quis baptizatus fuerit, aut baptismus valide collatus fuerit, dubio quidem post seriam investigationem permanente, baptismus eidem sub condicione conferatur.“
C. 869 § 1: „Wenn ein Zweifel besteht, ob jemand getauft ist oder ob die Taufe gültig gespendet wurde, der Zweifel aber nach eingehender Nachforschung bestehen bleibt, ist dem Betreffenden die Taufe bedingungsweise zu spenden.“
von Martin Rehak
Der Vatikanische Pressesaal hat am 06.08.2020 die Antworten (responsa) der Kongregation für die Glaubenslehre vom 24.06.2020 (Hochfest Johannes des Täufers) auf zwei ihr vorgelegte Zweifelsfragen (dubia) zum Sakrament der Taufe veröffentlicht. Die beiden Zweifelsfragen lauteten:
„Ist die Taufe unter Anwendung der Formel ‚Wir taufen dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes‘ gültig?“
„Müssen Personen, in deren Tauffeier diese Formel angewendet wurde, in forma absoluta getauft werden?“
Die Kongregation hat gemäß dem kurialen Stil für responsa ad dubia beide Fragen mit apodiktischer Kürze beantwortet, und zwar die erste Frage mit „Nein“ und die zweite mit „Ja“. Zugleich wurde eine Lehrmäßige Note der Kongregation publiziert, aus der die Gründe für ihre Entscheidung hervorgehen. Wie den Medien zu entnehmen ist (siehe hier), wurden die Zweifelsfragen von einem italienischen Bischof vorgelegt, der damit gegen einen liturgischen Missbrauch in seinem Bistum vorgehen wollte. Der gesamte Vorgang ist – unter Einbeziehung der Norm des c. 869 § 1, wo der Spezialfall einer bedingungsweisen Taufe geregelt wird – einer genaueren Betrachtung wert.
Die Kongregation für die Glaubenslehre hatte sich in jüngerer Vergangenheit schon einmal mit dem Problem alternativer, in den liturgischen Büchern nicht vorgesehener Spendeformeln des Taufsakraments befasst. In ihrer Antwort auf vorgelegte Zweifelsfragen vom 01.02.2008 (vgl. AAS 100 [2008] 200) hat die Kongregation die Spendeformeln „I baptize you in the name of the Creator, and of the Redeemer, and of the Sanctifier“ und „I baptize you in the name of the Creator, and of the Liberator, and of the Sustainer“ für ungültig erklärt. (Die Ungültigerklärung schließt etwaige Übersetzungen aus dem Englischen mit ein.) Eine nähere Begründung dieser Entscheidung durch die Kongregation selbst erfolgte nicht, ergibt sich aber aus einem Beitrag von Antonio Miralles, (damals) Professor für Sakramententheologie an der Päpstlichen Universität Santa Croce und Konsultor der Kongregation: Angefangen mit Mt 28,19 ist die Tradition der Kirche, die Taufe auf den Namen des dreieinen Gottes zu spenden und dazu ausdrücklich die drei Personen der göttlichen Trinität anzurufen, breit und eindeutig bezeugt (vgl. etwa DH 123, 176 f., 214, 445, 580, 589, 592, 644, 646, 757, 802, 903 u.ö.). Zur Bezeichnung der drei Personen der göttlichen Trinität jedoch sind Begriffe zu wählen, welche die drei Personen eindeutig bezeichnen und dabei zugleich die Beziehung der drei Personen zueinander zum Ausdruck bringen. Insoweit bezeichneten die vorgeschlagenen Begriffe „Creator“, „Redeemer“ bzw. „Liberator“ und „Sanctifier“ bzw. „Sustainer“ in trinitätstheologischer Perspektive nicht das Proprium der jeweiligen göttlichen Person, sondern könnten – insofern ohne weiteres beispielsweise auch der Heilige Geist als Schöpfer und der Sohn als Heiland bezeichnet werden kann – lediglich als Appropriationen angesehen werden.
Im Gegensatz zum dubium von 2008 betrifft die jetzt entschiedene erste Zweifelsfrage eine Spendeformel, die in trinitätstheologischer Hinsicht völlig rechtgläubig und unzweifelhaft ist. Als verungültigend wird stattdessen angesehen, dass der Spender von sich nicht im Singular spricht („Ich taufe ...“), sondern ein plurales „Wir taufen …“ gebraucht und damit gleichsam als Sprecher eines Kollektivs von mehreren Taufspendern (insbesondere den Eltern des Täuflings, Paten, u.a.m.) auftritt.
Dazu erläutert die Lehrmäßige Note mit einer eher amtstheologischen Argumentation, dass die Kirche zwar „bis zu einem gewissen Grad die Riten festlegen kann, die die von Christus angebotene sakramentale Gnade zum Ausdruck bringen,“ im Übrigen aber keine eigene Verfügungsmacht über die Substanz der sieben Einzelsakramente der Kirche hat. Indem das rituelle Handeln der Kirche der überlieferten Tradition treu bleibt, wird es zugleich als Handeln Christi erkennbar. Der Spender des Sakraments ist daher das „Präsenzzeichen“ – die Note verwendet diesen Ausdruck drei Mal – für Christus als den eigentlichen Spender der Taufe. Dies setzt aber voraus, dass der Spender die Intention hat, bei seiner Handlung das zu tun, was die Kirche tut, wenn sie tauft. „Denn“ – die Note wiederholt sich argumentativ – „der Spender handelt als Präsenzzeichen des eigentlichen Handelns Christi, das sich in der Ritushandlung der Kirche vollzieht.“ Selbst dann, wenn man mit dem II. Vaticanum die Liturgie als Handeln der ganzen Kirche verstehe, sei es daher nicht angängig, dass ein Taufspender die Spendeformel abwandele, um aus der Gemeinschaft der Kirche die Eltern, Paten oder andere Personen mit einer besonderen Beziehung zum Täufling herauszugreifen.
Auf den ersten Blick erscheint die Entscheidung der Kongregation – zumal im Lichte der in der Lehrmäßigen Note gegebenen Begründungen – als ziemlich hart, sehr am Ausgangsfall und an der Abstellung des dort angesprochenen liturgischen Missbrauchs orientiert, und möglicherweise nicht in allen Konsequenzen durchdacht. Denn die Kongregation erklärt inzident, dass die „Ich-Form“, d.h. die Bezeichnung des Taufspenders im Singular, zur unverfügbaren Substanz des Sakraments gehöre, während eine kollektive Taufspendung nicht möglich sei. Damit provoziert eine Reihe von Rückfragen:
- Was unterscheidet die Taufe von der Krankensalbung, die nach der Lehre der Kirche (im Anschluss an Jak 5,14) durchaus von mehreren Priestern gemeinsam gespendet werden kann (vgl. DH 2524)?
- Wie kann die Bezeichnung des Spenders zum dogmatisch relevanten, unabänderlichen Kern der Spendeformel gehören, wenn gemäß der Lehre der Kirche und der Praxis der orientalischen Christenheit auch die deprekative, passivische Spendeformel („Sei getauft …“) gültig ist (vgl. Dz. 696 = DH 1314)?
- Und warum wird in der Lehrmäßigen Note das Handeln des Taufspenders als „amtliches“ Handeln betont und damit ausgeblendet, dass im Falle einer Nottaufe der Spender der Taufe offenbar Christus repräsentieren kann, ohne dass er dafür von der Kirche mit einem Amt betraut wird?
Geradezu beiläufig wird eingangs der Lehrmäßigen Note mitgeteilt, dass die Kongregation als Autoritätsargument für ihre Entscheidung Thomas von Aquin auf ihrer Seite habe, der in seiner Theologischen Summe die Frage, utrum plures possint simul baptizare unum et eundem (S.Th. III, q. 67 art. 6), verneint habe. Die Kongregation geht in ihrer Note auf die dortigen Erwägungen nicht weiter ein, was auch daran liegen mag, dass diese Erwägungen die jetzige Positionierung der Glaubenskongregation meines Erachtens nur teilweise stützen. Thomas setzt argumentativ bei der Feststellung ein, dass die „Ich-Form“ die traditionelle Spendeformel (der lateinischen Kirche) sei. Mit Blick auf die griechische Kirche und die dort übliche passivisch-deprekative Spendeformel sei dies allein freilich noch kein hinreichendes Argument gegen die „Wir-Form“, da eine indikativische „Wir-Form“ der klassischen lateinischen „Ich-Form“ viel ähnlicher sei als die Spendeformel der Griechen. Sodann bringt Thomas gegen die Taufe durch mehrere Spender bzw. gegen eine „Wir-Form“ der Spendeformel zwei Einwände vor. Mit eher defensiven Formulierungen („videtur“, „oportet“) macht er zum einen geltend, dass eine Sakramentenspendung durch mehrere Spender verdunkele, dass der menschliche Spender nur als Minister an Christi statt handelt: „Quod quidem videtur esse contra rationem ministerii, homo enim non baptizat nisi ut minister Christi et vicem eius gerens; unde, sicut unus est Christus, ita oportet esse unum ministrum qui Christum repraesentet.“ Zum anderen weist Thomas darauf hin, dass die Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit der Taufe (vgl. dazu auch c. 845 § 1) strikt beachtet werden müsse. Dabei sei die Spendung des Sakraments nur dann gültig, wenn jeder Spender Materie und Form des Sakraments setzt – von Thomas anschaulich an dem Beispiel illustriert, dass sich ein Gelähmter und ein Stummer nicht in der Weise als Taufspender zusammentun können, dass der Gelähmte die Spendeformel spricht und der Stumme den Täufling mit Wasser übergießt. Beim Versuch der Taufspendung durch mehrere Spender ist daher jener als der einzige Spender anzusehen, der als erster (den Täufling untertaucht bzw. mit Wasser übergießt und) die Spendeformel ausspricht, während alle übrigen als Wiedertäufer zu bestrafen seien. Allerdings, so Thomas abschließend, sei auch der (eher theoretische) Fall denkbar, dass alle Spender absolut zeitgleich eine Taufhandlung vornehmen und die Spendeformel sprechen. In einem solchen Fall sei die Taufe durch mehrere Spender zwar unerlaubt („inordinatus“), aber – weil Christus dann eben durch mehrere Spender handelt – doch gültig:
„Si autem omnino simul verba proferrent et hominem immergerent aut aspergerent, essent puniendi de inordinato modo baptizandi, et non de iteratione Baptismi, quia uterque intenderet nonbaptizatum baptizare, et uterque, quantum est in se, baptizaret. Nec traderent aliud et aliud sacramentum, sed Christus, qui est unus interius baptizans, unum sacramentum per utrumque conferret.“
Als Zwischenfazit lässt sich also wohl folgendes sagen: Nach Auffassung der Kongregation begründet die „Wir-Form“ der Spendeformel durchgreifende Zweifel an der rechten Intention des Spenders, insbesondere an seiner Bereitschaft, Christus als den eigentlichen Spender (causa principalis) und sich selbst nur als Werkzeug (causa instrumentalis) zu verstehen, also gleichsam mit den Worten „Ich taufe dich …“ Christus selbst sprechen zu lassen. Das erscheint mir, wie gesagt, als eine ziemlich harte, aber zugleich vertretbare Auffassung. Ohne dadurch den katholischen Glauben preiszugeben, wäre auf der Basis der Theologie des doctor angelicus aber wohl auch eine konträre Positionierung möglich gewesen, wonach die „Wir-Form“ als zwar missbräuchlich, unerlaubt und womöglich einen Irrglauben begünstigend, aber dennoch als gültig anzusehen gewesen wäre.
Die vorliegende Angelegenheit regt daher auch zum Nachdenken darüber an, dass also diejenigen, die im Bereich der kirchlichen Disziplin und Liturgie die kirchliche Ordnung missachten, durch ihr Verhalten möglicherweise überzogene Entscheidungen im Bereich der kirchlichen Doktrin provozieren.
Die Antwort auf die zweite Zweifelsfrage lenkt den Blick auf die praktischen pastoralen Konsequenzen, die aus der lehrmäßigen Entscheidung gemäß der Antwort auf die erste Frage folgen. Die Kongregation erklärt, dass im Falle einer sicher ungültigen Taufe – wie dies bei Verwendung einer ungültigen Spendeformel der Fall ist – diese Taufe „in forma absoluta“ erneut zu spenden ist.
Die Taufspendung in absoluter Form ist der Normalfall der Taufspendung, weshalb dieser Begriff im kodikarischen Recht überhaupt nicht aufscheint. Allerdings begegnet in c. 869 §§ 1-2 der Gegenbegriff, nämlich der Begriff der bedingungsweisen Taufe (baptisma sub condicione). Die bedingungsweise Taufe ermöglicht der pastoralen Praxis einen Ausweg aus dem Dilemma, welches aus den dogmatischen Vorgaben der Heilsnotwendigkeit der Taufe einerseits und der Unwiederholbarkeit der Taufe andererseits entstehen kann. Besteht nämlich im Einzelfall eine nicht aufklärbare Ungewissheit über das Getauftsein einer Person, so ist die Taufe bedingungsweise – nämlich unter der Bedingung, dass die fragliche Person in Wahrheit tatsächlich ungetauft ist – zu spenden (vgl. dazu auch DH 758). Am Rande bemerkenswert ist, dass das Konzept der bedingungsweisen Taufe in den Quellen erstmals während des Pontifikats Alexanders III. (1159–1181) begegnet (vgl. X 3.42.2 = DH 758), also zu einer Zeit, als die Kirchenrechtswissenschaft eine erste Blütezeit erlebt. Die Ungewissheit kann dabei als quaestio facti die Frage betreffen, ob überhaupt jemals eine Taufspendung unternommen wurde; oder als quaestio iuris die Frage, ob eine Taufspendung zwar versucht wurde, aber aus Gründen der Glaubenslehre als ungültig anzusehen ist.
Bestehen im Einzelfall derartige Ungewissheiten, so ist nach Möglichkeit zunächst der wahre Sachverhalt aufzuklären. Die diesbezügliche Untersuchung kann denkbarer Weise zu drei unterschiedlichen Ergebnissen führen. Entweder lässt sich eine gültige Taufe positiv feststellen („constare“). Oder eine gültige Taufe bleibt zweifelhaft („non constare“). In diesem Fall greift c. 869 ein und ist im weiteren eine bedingungsweise Taufe zu spenden. Oder es lässt sich negativ feststellen, dass eine Taufe entweder gar nicht oder ungültig gespendet wurde („constare de non“).
Aufgrund der Antworten der Glaubenskongregation auf vorgelegte Zweifelsfragen vom 24.06.2020 ist nunmehr geklärt, dass Taufspendungen, bei denen die „Ich-Form“ der Spendeformel zu einer „Wir-Form“ abgewandelt wurde, in die dritte Kategorie fallen: Eine so gespendete Taufe ist nach der (derzeitigen) Lehre der Kirche sicher ungültig, so dass eine (nur) bedingungsweise Wiederholung der Taufe nicht veranlasst ist. Statt dessen ist die Taufe – sofern von dem betroffenen Täufling bzw. dessen Personensorgeberechtigten gewünscht – in absoluter Form zu spenden, ohne hinzufügen der Klausel „Falls Du noch nicht getauft bist, …“. Auch wenn die fragliche Lehre (derzeit) keine Unfehlbarkeit für sich in Anspruch nehmen kann, handelt es sich doch um eine objektive Feststellung, die mithin also auch in der Vergangenheit mit der ungültigen Formel gespendete Pseudo-Taufen betrifft.
Aus einer solchen ungültigen Taufspendung ergibt sich daher ein ganzes Potpourri weiterer Konsequenzen, auf die hier nicht im Einzelnen eingegangen werden kann. Nur beispielhaft sei etwa darauf hingewiesen, dass sich die Ehe zwischen zwei an und für sich gut katholisch sozialisierten Eheleuten in der jetzt geforderten ex post-Betrachtung als ungültig (aber sanierbar) herausstellen könnte, wenn und weil infolge ungültiger Taufe des einen Ehegatten die Ehe aufgrund des Ehehindernisses der Religionsverschiedenheit ungültig ist. Diese und weitere wichtige denkbaren Konsequenzen hat der (inzwischen verstorbene) Kirchenrechtler Urbano Card. Navarrete SJ in einer kleinen Studie zusammengetragen, die er anlässlich der oben referierten Responsa ad dubia von 2008 verfasst hatte.
Im Lichte des in dubio-Grundsatzes mag es zwar für Altfälle vielfach so sein, dass man ungeachtet der jetzigen lehrmäßigen Klärung doch eher zu einem „non constare“ statt zu einem „constare de non“ in der Beurteilung früherer Taufspendungen gelangt. In Zeiten, in denen der konkrete Ablauf kirchlicher Gottesdienste mittels technischer Aufzeichnungen dokumentiert und auch nach Jahrzehnten noch beweiskräftig rekonstruiert werde kann, kann die hier besprochene Entscheidung der Kongregation aber auch jene weitreichenden Folgen haben, die nun im Fall des US-amerikanischen Priesters (bzw. Pseudo-Priesters) Matthew Hood aus dem Erzbistum Detroit zu bewältigen sind. Hood hatte sich kürzlich nochmals die Videoaufnahmen seiner eigenen „Taufe“ angeschaut und entsetzt festgestellt, dass der Diakon, der ihn seinerzeit als Säugling vermeintlich getauft hatte, die verungültigende „Wir-Form“ verwendet hatte. Folglich waren nicht nur seine spätere Firmung, Diakonen- und Priesterweihe ungültig (vgl. dazu c. 842 § 1), sondern auch die seit seiner Priesterweihe im Jahre 2017 von ihm zelebrierten Eucharistiefeiern sowie die in vermeintlichen Beichten erteilten Absolutionen. Hingegen sind – wie das Erzbistum Detroit zu Recht verlautbart – die vom ihm gespendeten Taufen als gültig anzusehen (der in c. 861 § 2 verlangte Notfall wird nicht zur Gültigkeit der Nottaufe, sondern nur zu ihrer Erlaubtheit gefordert). Zur weiteren Schadensbegrenzung hat der Erzbischof von Detroit unverzüglich gehandelt und Matthew Hood binnen Tagen nicht nur nochmals – erstmals gültig – die Initiationssakramente gespendet, sondern – unter Dispens u.a. vom einfachen Weihehindernis aus c. 1042 Nr. 3 und dem Interstitium gemäß c. 1031 § 1 – auch die heiligen Weihen zum Diakon und zum Priester erteilt.
c. 34 § 2 CIC
„Instructionum ordinationes legibus non derogant,
et si quae cum legum praescriptis componi nequeant, omni vi carent.“
„Anordnungen von Instruktionen heben Gesetze nicht auf,
und wenn irgendwelche mit Vorschriften von Gesetzen nicht in Einklang gebracht werden können, entbehren sie jeder Rechtskraft.“
von Martin Rehak
Die Kongregation für den Klerus hat, datiert auf den 29.06.2020, die Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ erlassen, die von Papst Franziskus am 27.06.2020 in allgemeiner Form approbiert worden war, und die am 20.07.2020 in einer konzertierten Aktion vom Vatikanischen Pressesaal wie auch von nationalen Bischofskonferenzen der Öffentlichkeit vorgestellt worden ist.
Die Instruktion hat im deutschen Episkopat ein überaus geteiltes Echo gefunden. Ihre Unterstützung haben namentlich Kardinal Woelki (Köln) sowie die Bischöfe Hanke (Eichstätt) und Meier (Augsburg) signalisiert. In unterschiedlicher Intensität eher kritische Stimmen waren von Kardinal Marx (München und Freising) sowie den (Erz-)Bischöfen Ackermann (Trier), Bode (Osnabrück), Feige (Magdeburg), Fürst (Rottenburg-Stuttgart), Jung (Würzburg), Kohlgraf (Mainz), Overbeck (Essen) und Schick (Bamberg) zu vernehmen. Die Erzbischöfe Heße (Hamburg) und Burger (Freiburg) erklärten, dass das römische Dokument dem im jeweiligen Erzbistum laufenden Reformprozess nicht entgegenstehe. In der Stellungnahme von Kardinal Kasper (Rom, vormals Rottenburg-Stuttgart) paart sich Kritik an den Kritikern mit eigener Kritik an der Instruktion.
Wollte man die von den genannten Bischöfen ebenso wie die von Hochschullehrer*innen der Theologie und weiteren kirchlichen Akteur*innen geäußerte Kritik evaluieren, so müsste man zunächst wohl die Bezugspunkte und Maßstäbe dieser Kritik benennen und reflektieren. Würde man dazu beispielsweise die letzte Verlautbarung der Kleruskongregation zum Thema Pfarrei und Pfarrer, nämlich die Instruktion „Der Priester, Hirte und Leiter der Pfarrgemeinde“ vom 04.08.2002, als Referenz heranziehen, so wäre im direkten Vergleich der beiden Instruktionen wohl eine doch erhebliche Entwicklung oder Perspektivenänderung zu beobachten. Die Instruktion von 2002 war in zwei Hauptteile gegliedert und entfaltete zunächst ein Priesterbild, das den Priester vor allem über seine Teilhabe am besonderen Priestertum Christi definierte, um sodann den als Pfarrer eingesetzten Priester vor allem als Repräsentanten Christi gegenüber der Pfarrgemeinde darzustellen. Demgegenüber denkt die aktuelle Instruktion die Pfarrei als „lebendige Gemeinschaft von Glaubenden“ (Nr. 9), also letztlich vom Begriff der Kirche als Volk Gottes her (vgl. auch Nrn. 10, 27–29). Während die Instruktion von 2002 keinen Gedanken an etwaige diözesane Prozesse zur Umstrukturierung der Pfarreienlandschaft verschwendet, widmet die aktuelle Instruktion dieser Thematik breiten Raum (vgl. Nrn. 42–51, 54–61). Während die Instruktion von 2002 die Diakone nur beiläufig erwähnt, bietet die aktuelle Instruktion einen umfangreichen Abschnitt zum diakonalen Dienst (vgl. Nrn. 79–82). Bei alldem erweist sich das aktuelle römische Dokument als ein Essay über die missionarische Kirche auf der Ebene der Pfarrei, wobei das Thema Mission rondoartig wiederholt und gleichsam als Florileg aus verschiedenen Ansprachen und Enzykliken von Papst Franziskus gestaltet und aktualisiert wird. Jedenfalls ist der amtierende Papst mit über 30, zum Teil längeren O-Tönen die am häufigsten zitierte Autorität. Auf Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils wird ca. zehnmal Bezug genommen, während die Päpste Johannes Paul II., Paul VI., und Benedikt XVI. zusammen rund ein Dutzend weiterer Zitate beisteuern. Hinsichtlich kurialer Dokumente wird vor allem das von der Kongregation für die Bischöfe verantwortete Direktorium für den Hirtendienst der Bischöfe Apostolorum Successores vom 22.02.2004 ausgewertet.
Neben den Betrachtungen zur missionarischen Pfarrei verfolgt das aktuelle römische Dokument freilich auch die zentrale Aufgabe einer Instruktion, nämlich die Vorschriften des Gesetzes zu erklären und Vorgehensweisen zur rechten Anwendung des Rechts zu geben (vgl. c. 34 § 1 CIC). Vor allem den Diözesanbischöfen und ihren Generalvikaren – die zwar nicht explizit als primäre Adressaten der Instruktion genannt werden, es aber aus Sachgründen sind – will die Instruktion daher
„eine Anwendungsweise der kanonischen Normen [vorlegen], die die Möglichkeiten, die Grenzen, die Rechte und die Pflichten der Hirten und der Laien festlegt, damit die Pfarrei sich selbst wieder als grundlegenden Ort der Verkündigung des Evangeliums, der Feier der Eucharistie, als Raum der Geschwisterlichkeit und der Caritas entdeckt, von dem aus das Zeugnis des christlichen Glaubens in die Welt ausstrahlt“ (Nr. 123).
Die hohe Auffassung, welche die Kongregation hier vom Kirchenrecht hat – korrekt angewandtes Kirchenrecht als Motor eines missionarischen pastoralen Wirkens der Pfarrei –, ist bemerkenswert. Ungeachtet dieser Freude über die Wertschätzung des Kirchenrechts verdient die vorliegende Instruktion allerdings auch eine differenzierte kanonistische Würdigung, die sich hier am Kriterium des c. 34 § 2 CIC orientiert. Gemäß dieser Norm haben Instruktionen von sich aus keine Gesetzeskraft und sind daher unbeachtlich, sofern und soweit sie mit den geltenden Gesetzen unvereinbar sind. Die fachwissenschaftliche Analyse kann also drei Kategorien bilden und danach fragen,
- inwieweit die Instruktion lediglich die kodikarische Rechtslage paraphrasiert (bzw. schlicht zitiert);
- zu welchen Normen weiterführende Erklärungen und Präzisierungen des kodikarischen Rechts vorgelegt werden, und welche Tendenzen bzw. Einblicke in die Rechtspraxis der Römischen Kurie hierbei erkennbar werden; und
- ob die Instruktion solche Darlegungen beinhaltet, die (anscheinend) dem geltenden kodikarischen Recht widersprechen; mit der Folge, dass die Erläuterungen der Instruktion gemäß c. 34 § 2 CIC insoweit (wohl) keine Rechtskraft entfalten.
Dabei versteht sich, dass die Grenze zwischen einer engen bzw. restriktiven Auslegung des geltenden Rechts (Kategorie II) und der Unvereinbarkeit von vermeintlichen Erklärungen der Gesetze bzw. der Vorgehensweisen bei ihrer Anwendung mit ebendiesen Gesetzen (Kategorie III) fließend sein kann. Im Folgenden sei daher ein Blick auf jene Ausführungen der Instruktion geworfen, mit denen die Kongregation entweder eine ausgesprochen restriktive, den Anwendungsbereich massiv einengende Auslegung geltender Normen vorlegt oder sich sogar, sei es scheinbar oder tatsächlich, in Widerspruch zu den Vorgaben des kodikarischen Rechts begibt:
- Im Zuge der Erläuterungen zu c. 515 § 2 CIC will die Instruktion in Nr. 48 die legitime Aufhebung einer Pfarrei auf solche Fälle eingeschränkt wissen, in denen der Grund der Aufhebung unmittelbar und dauerhaft in der Pfarrei selbst verankert ist. Weder ein Priestermangel im Bistum; noch die allgemeine Finanzsituation des Bistums; noch eine irgendwie prekäre, aber voraussichtlich nur vorübergehende Situation der Pfarrei sollen ein hinreichender Grund für ihre Aufhebung sein. Es scheint, als gebe die Kongregation hier Hinweise dazu, in welchen Fällen sie bereits bischöfliche Pfarreiaufhebungsdekrete kassiert hat oder künftig zu kassieren gedenkt. Da sich gemäß Art. 136 § 1 des Regolamento Generale della Curia Romana, in: AAS 91 (1999) 629–699, der Prüfungsumfang der Kongregation bei hierarchischen Rekursen sowohl auf Fragen der Rechtmäßigkeit, als auch auf Fragen der Zweckmäßigkeit eines solchen Dekrets erstreckt, führt – sofern entsprechende bischöfliche Entscheidungen im Beschwerdeweg angegriffen werden – die Auffassung der Kongregation letztlich zu einem erheblichen eigenen Mitspracherecht bei der Umstrukturierung von Diözesen. Der Ausschluss bestimmter Begründungen als illegitim untergräbt die kodikarische Kompetenzzuweisung des c. 515 § 2 CIC, wonach die Aufhebung oder Veränderung von Pfarreien „allein Sache des Diözesanbischofs“ ist.
In diesem Zusammenhang erläutert die Instruktion in Nr. 50, dass ein Pfarreiaufhebungsdekret konkret und detailliert zu begründen ist, wofür ein pauschaler Verweis „auf das ‚Heil der Seelen‘“ nicht ausreicht. Dazu sei bemerkt, dass – in einer Paraphrase des c. 1748 CIC – die Kongregation es in Nr. 69 der Instruktion anscheinend als hinreichend erachtet, wenn die Versetzung eines Pfarrers unter Berufung auf das Heil der Seelen begründet wird.
- In ähnlich restriktiver Weise wie zur Aufhebung von Pfarreien äußert sich Nr. 51 der Instruktion zu der Frage, welche „schwerwiegenden Gründe“ im Sinne des c. 1222 § 2 CIC die Profanierung einer Kirche rechtfertigen können. Auch hier sollen weder ein Klerikermangel im Bistum, noch ein Bevölkerungsrückgang, noch finanzielle Krisen des Bistums legitime Gründe sein. Stattdessen scheint die Kongregation die Profanierung von Kirchen auf die Fälle des c. 1222 § 1 CIC beschränken zu wollen, in denen sich das Gotteshaus in einem für die Feier der Liturgie unbrauchbaren, irreparablen Zustand befindet.
Mit anderen Worten: Es ist besser, ein Gotteshaus erst verfallen zu lassen und dann zu profanieren, als es bei noch intakter Bausubstanz für einen anderen, nicht unwürdigen Gebrauch umzuwidmen.
- Nr. 71 der Instruktion stellt es als Aufgabe der Diözesanbischöfe hin, einen Pfarrer, der das 75. Lebensjahr vollendet hat, zum Verzicht auf sein Amt einzuladen. Ob die Annahme einer solchen bischöflichen Einladung für den Pfarrer eine moralische oder eine Rechtspflicht ist, lässt die Instruktion sodann bewusst offen. Damit sind die Rollenvorgaben des kodikarischen Rechts glatt vertauscht. Gemäß c. 538 § 3 CIC ist ein solcher Pfarrer gehalten, von sich aus dem Diözesanbischof seinen Amtsverzicht anzubieten; es ist sodann Sache des Bischofs, ob bzw. wann er diesen Verzicht annimmt.
Man fragt sich unwillkürlich, was wohl passiert, wenn diese Interpretation des kodikarischen Rechts Schule macht, so dass zukünftig auch Bischöfe und Dikasterienleiter der Römischen Kurie – entgegen cc. 401 § 1, 411 CIC bzw. Johannes Paul II., Apostolische Konstitution Pastor Bonus vom 28.06.1988, in: AAS 80 (1988) 841–912, hier Art. 5 § 2; Franziskus, Motu Proprio Imparare a congedarsi vom 12.02.2018, in: AAS 110 (2018) 379–381, hier Art. 2 – vor dem Anbieten des eigenen Amtsverzichts bei Erreichen der Altersgrenze erst einmal auf eine persönliche und am besten schriftliche Einladung des Heiligen Vaters warten.
- Unter Nr. 88 der Instruktion wird ausgeführt, dass einem „Moderator der Hirtensorge“ im Sinne des c. 517 § 2 CIC „die Vollmacht und die Funktionen des Pfarrers mit den entsprechenden Pflichten und Rechten [zukommen].“ Insoweit lässt sich einerseits nicht verhehlen, dass die Kongregation bereits in ihrer Instruktion „Der Priester, Hirte und Leiter der Pfarrgemeinde“ von 2002, dort Nr. 24, die Auffassung vertreten hat, dass als Moderator ein Priester einzusetzen sei, „der mit der Vollmacht und den Pflichten eines Pfarrers ausgestattet ist“. Andererseits ist nüchtern festzustellen, dass c. 517 § 2 CIC den besagten Moderator nur mit den „Vollmachten und Befugnissen eines Pfarrers“ ausgestattet wissen will, und damit den Moderator zwar hinsichtlich seiner Rechte, aber gerade nicht hinsichtlich seiner Pflichten einem Pfarrer gleichstellt. Der Pflichtenkreis des Moderators erschöpft sich nach der kodikarischen Vorgabe in der „Leitung der Hirtensorge“. Soweit ersichtlich, ist es daher auch breiter Konsens in der Fachwissenschaft, dass der Moderator von typischen Pflichten des klassischen Pfarrers, namentlich von der Residenzpflicht (vgl. c. 533 § 1 CIC) und der Applikationspflicht (vgl. c. 534 CIC), befreit ist und daher (im Extremfall) seine Leitungstätigkeit auch nebenberuflich und aus der Ferne ausüben könnte. Nimmt man jedoch die Instruktion an dieser Stelle beim Wort, so unterliegt nunmehr auch der priesterliche Moderator den genannten Pflichten.
In der Exegese des c. 517 § 2 CIC setzt sodann Nr. 90 die ebenfalls erstmals von der Kongregation für den Klerus in der Instruktion von 2002 begründete Auslegungstradition fort, wonach bei der Auswahl der an der Hirtensorge beteiligten Personen einem hierfür verfügbaren Diakon der Vorrang vor Laien gebührt. Dem Wortlaut des c. 517 § 2 CIC ist ein solcher Vorrang nicht zu entnehmen.
Bereits in der eben erwähnten Instruktion aus dem Jahr 2002, dort Nr. 23, wie auch zuvor in der Interdikasteriellen Instruktion Ecclesiae de mysterio („Laieninstruktion“) vom 15.08.1997, in: AAS 89 (1997) 852–877, dort Art. 4 § 1, hatte der Apostolische Stuhl deutlich gemacht, dass Gemeindeleitung gemäß c. 517 § 2 CIC als eine außerordentliche, provisorische Form der Gemeindeleitung anzusehen sei. Dabei erklärte zwar bereits die Instruktion von 2002, dass die Beteiligung von Laien an der Gemeindeleitung eine „Mitarbeit ‚ad tempus‘“ sei. Als hauptsächlicher Grund dafür, dass es sich um eine außerordentliche Form der Gemeindeleitung handelt, war wohl jedoch der Umstand anzusehen, dass in den Fällen des c. 517 § 2 CIC das Amt des Pfarrers in der so geleiteten Pfarrei vakant bleibt. Von daher war auch die Mitarbeit auf Zeit dahingehend zu verstehen, dass hiermit die Zeitspanne bis zur ordentlichen Wiederbesetzung des Pfarramts zu verstehen war. Demgegenüber bestimmt Nr. 89 der aktuellen Instruktion, dass eine Pfarreileitung gemäß c. 517 § 2 CIC „nicht unbefristet, sondern nur innerhalb des dafür zeitlich notwendigen Rahmens erfolgt“. Zur Begründung wird auf das Direktorium für den Hirtendienst der Bischöfe Apostolorum Successores aus dem Jahre 2004, dort Nr. 215 c, verwiesen. Dort freilich ist – anders als dies die jetzige Instruktion meines Erachtens insinuiert – in keiner Weise von einer Befristung der Pfarreileitung in dem Sinne die Rede, dass ex ante ein Endtermin anzugeben wäre. Stattdessen ist davon die Rede, dass der Diözesanbischof, der das Ganze verantwortet, „darum besorgt sein [soll], diese Situation so bald als möglich zu beenden“. Zwischen der Befristung eines Provisoriums und dessen baldmöglichster Beendigung besteht ein kleiner, aber feiner Unterschied.
- In Nr. 97 der Instruktion ist arglos davon die Rede, dass „gemäß can. 230 § 1 […] Laien als Lektoren und Akolythen in beständiger Weise beauftragt werden [können].“ Nun stehen allerdings die in c. 230 § 1 CIC genannten laikalen Dienstämter in der Tradition der Niederen Weihen und wurden deshalb von Papst Paul VI. im Motu Proprio Ministeria quaedam vom 15.08.1972, in: AAS 64 (1972) 529–534, ausschließlich Männern vorbehalten (vgl. a.a.O., 533 [Ziff. VII]). Dementsprechend heißt es auch in c. 230 § 1 CIC [a.F.] unmissverständlich: „Männliche Laien […] können […] für die Dienste des Lektors und des Akolythen auf Dauer bestellt werden; […]“. Man darf also rätseln, ob der Kongregation die Beschränkung der besagten Dienstämter auf männliche Laien möglicherweise unbekannt ist; oder ob sie zwar bekannt ist, eine besondere Betonung dieses Umstands jedoch dermaßen inopportun erschien, dass diese nicht ganz unwesentliche Information im Verweis auf die Maßgaben des c. 230 § 1 CIC gleichsam versteckt wurde; oder ob die Kongregation womöglich der Auffassung ist, die von Papst Paul VI. vorgenommene Beschränkung sei heute nicht mehr zeitgemäß und ein Traditionsbruch an dieser Stelle einer wahrhaft missionarischen Kirche förderlich.
- Zu c. 537 CIC betont die Instruktion in Nr. 102, dass ein Vermögensverwaltungsrat (ebenso wie der pfarrliche Pastoralrat gemäß c. 536 CIC) nur ein zuarbeitendes Beratungsgremium sei und weist – wie im Rahmen des c. 532 CIC durchaus zutreffend – dem Pfarrer die alleinige Letztverantwortung für das Pfarrvermögen zu. Dazu hat Monsignore Ripa, der Untersekretär der Kongregation, in seiner Präsentation der Instruktion vom 08.07.2020 ausdrücklich erklärt: „Unbeschadet legitimer regionaler Regelungen wird festgehalten, dass beide Räte Beratungsgremien sind, die den Pfarrer, der den Vorsitz innehat, in der Leitung der Pfarrei maßgeblich unterstützen.“ Es verwundert daher und ist überaus misslich, dass das offenbare Wissen um legitime regionale Besonderheiten in der Instruktion selbst mit keiner Silbe zur Sprache kommt, obwohl es in der einschlägigen Fachliteratur nicht an Mahnungen und Hinweisen dazu mangelt (vgl. etwa Hallermann, Pfarrei und pfarrliche Seelsorge, 382; Kalde in: HdbKathKR3, 743), dass es insbesondere in Deutschland derartiges Sonderrecht gibt. Denn Papst Johannes Paul II. hatte am 12.01.1984 den deutschen Bischöfen im Wege eines Indults bestätigt, dass dort, wo
„das Vermögensverwaltungsrecht auf staatlicher Gesetzgebung oder auf staatskirchenrechtlichen Vereinbarungen beruht und auch dort, wo ehedem staatliches Recht durch darauf beruhendes kirchliches Partikularrecht ersetzt worden ist, die alleinige Vertretung des pfarrlichen Vermögens durch den Pfarrer nicht eingehalten werden muss“ (Hallermann, a.a.O.).
Dieser Gewährung von Sonderrecht kann nicht entgegengehalten werden, dass die Interdikasterielle Instruktion Ecclesiae de mysterio („Laieninstruktion“) aus dem Jahre 1997, welche Papst Johannes Paul II. in forma specifica approbiert hatte, erstens in Art. 5 §§ 2–3 unterstreicht, dass der pfarrliche Vermögensverwaltungsrat ein reines Beratungsgremium und dort gegen die Stimme des Pfarrers beschlossene Entscheidungen eo ipso ungültig seien; und zweitens am Ende der Instruktion jene Partikulargesetze und jenes Gewohnheitsrecht, die den Bestimmungen der Instruktion entgegenstehen, widerrufen seien. Denn dieser Widerruf konnte nicht das besagte Indult bzw. etwaige konkordatäre Grundlagen des deutschen Partikularrechts zur pfarrlichen Vermögensverwaltung erfassen. Es ist bedauerlich, dass das deutsche Sonderrecht im Licht des aktuellen römischen Dokuments erneut, aber zu Unrecht, als illegitime Normabweichung erscheint. Gleichwohl hat die jetzige Instruktion den rechtlichen Rahmen für die pfarrliche Vermögensverwaltung in den deutschen Bistümern in keiner Weise verändert.
Zusammenfassend lassen die vorstehenden Beobachtungen leichte Zweifel daran aufkommen, ob sich die Kongregation für den Klerus – wie es gemäß Art. 156 der Apostolischen Konstitution Pastor Bonus; Art. 125 Regolamento Generale della Curia Romana, in: AAS 91 (1999) 629–699, vorgesehen ist – vor Veröffentlichung der Instruktion mit dem Päpstlichen Rat für die Gesetzestexte ins Benehmen gesetzt hat. Man wäre angesichts der diskutierten Punkte nicht überrascht, wenn dies nicht der Fall gewesen wäre. Eine (Detail-)Kritik an dem jüngsten Dokument der Kongregation erscheint jedenfalls aus kanonistischer Sicht durchaus berechtigt. Da Instruktionen kein neues Recht schaffen, sondern nur an der Rechtskraft des bereits bestehenden Gesetzesrechts, welches sie erläutern, partizipieren, vermögen die Darlegungen der Kongregation, soweit diese Darlegungen mit dem kodikarischen Recht unvereinbar sind, die Rechtslage nicht zu ändern und sind daher kirchenrechtlich unbeachtlich.
Die Zeit wird zeigen, ob die Kongregation vielleicht sogar gewillt ist, in einen fruchtbaren Dialog mit ihren Kritikern zu treten. Denn eine in sich erklärungsbedürftige Instruktion sollte wohl besser durch eine gelegentliche editio altera emendata ersetzt werden, welche keine Zweifel an der wahren Rechtslage mehr aufkommen lässt.
* * *
Mit dem Motu Proprio Spiritus Domini vom 10.01.2021 hat Papst Franziskus c. 230 § 1 CIC a.F. abgeändert, so dass die Dienstämter des Lektoren und Akolythen nicht mehr Personen männlichen Geschlechts vorbehalten sind (siehe dazu hier). Diese im Sommer 2020 im Rom bereits fest geplante Änderung des kodikarischen Rechts wurde von der Kleruskongregation bereits in Nr. 97 der hier diskutierten Instruktion „eingepreist“.
* * *
c. 1284 § 1
„Omnes administratores diligentia boni patrisfamilias suum munus implere tenentur.“
„Alle Verwalter sind gehalten, ihr Amt mit der Sorgfalt eines guten Hausvaters zu erfüllen.“
von Martin Rehak
Mit dem Motu Proprio La diligenza del buon padre di famiglia (dt.: Die Sorgfalt eines guten Hausvaters) vom 19.05.2020, welches am Pfingstmontag, den 01.06.2020 vom Vatikanischen Pressesaal veröffentlicht wurde, hat Papst Franziskus ein Regelwerk verabschiedet, durch das Transparenz, Kontrolle und Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge des Apostolischen Stuhls und des Staates der Vatikanstadt gefördert werden sollen. Wie einem Kommunique des Vatikanischen Pressesaals zu entnehmen ist, hatten an der Erarbeitung dieser Gesetzgebung namentlich das Staatssekretariat, der Wirtschaftsrat, das Wirtschaftssekretariat, die Güterverwaltung des Apostolischen Stuhls (APSA) und das Governatorat des Staates der Vatikanstadt mitgewirkt.
Das besagte Regelwerk beinhaltet zum einen die 86 Artikel umfassenden Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, zum anderen eine in 12 Artikel gegliederte Gerichts- und Prozessordnung (Tutela giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano). Bei den Norme sulla trasparenza handelt es sich rechtstechnisch um ein typisches zeitgenössisches Verwaltungsgesetz (erkennbar etwa an Art. 2 dieses Gesetzes, das in 15 Unterpunkten Legaldefinitionen der vom Gesetzgeber benutzten Begriffe bietet), das sich inhaltlich an vergleichbaren weltlichen Gesetzen orientiert und der Umsetzung der United Nations Convention against Corruption (Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption) von 2003 dient. Zu dieser Konvention hatte der Heilige Stuhl am 19.06.2016 seinen Beitritt erklärt (siehe hier). Die Norme sulla trasparenza sind in vier Titel gegliedert (I: Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen, Allgemeine Grundsätze; II: Zentralisierung, Programmierung, Verzeichnis der Mitarbeiter, Datenbank; III: Verfahren, Vergabe, Ausnahmen, Konzessionen, Vertragserfüllung, Betrieb im Immobilienbereich; IV: Beschwerden und Güteversuch, Monitoring und Kontrolle, Übergangs- und Schlussbestimmungen), wobei die Titel wiederum in mehrere Kapitel untergliedert sind. In Art. 81 § 1 S. 1 der Norme sulla trasparenza wird erklärt, dass sämtliche Verträge dem kanonischen Recht unterliegen, womit wohl insbesondere an das kodikarische Vermögensrecht gedacht ist. Zugleich wird in dieser Norm ausdrücklich c. 1290 CIC nebst dessen Weiterverweis auf das weltliche Recht thematisiert. Das insoweit maßgebliche Recht seien zunächst die Gesetze des Staates der Vatikanstadt (Norme sulla trasparenza, Art. 81 § 1 S. 2). Für den Fall, dass bestimmte Vertragstypen dort nicht normiert sind, sei italienisches Recht anwendbar, vorausgesetzt, dieses ist seinerseits mit dem kanonischen Recht vereinbar (Norme sulla trasparenza, Art. 81 § 1 S. 3).
Bevor im Weiteren die „Sorgfalt des guten Hausvaters“, die für das neue Motu Proprio namensgebend wurde, näher betrachtet wird, gestattet sich der Kanonist, für einen Augenblick bei der Frage der Promulgation und des Inkrafttretens zu verweilen. Laut der Schlussklausel des Motu Proprio sollte dessen Promulgation durch Veröffentlichung auf der Homepage des L’Osservatore Romano erfolgen; ein späterer Abdruck in den Acta Apostolicae Sedis, der irgendwann erfolgen wird, hat also entgegen c. 8 § 1 CIC nur dokumentarische Funktion. Soweit zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Beitrags nachvollziehbar, scheint der L’Osservatore Romano bzw. dessen Internetredaktion der vom Papst gestellten Aufgabe in der Weise nachgekommen zu sein, dass von einem Bericht über das Motu Proprio auf die Volltexte auf den Webseiten des Vatikanischen Pressesaals verlinkt wurde. Ebenfalls laut Schlussklausel sollte das Motu Proprio nebst den Norme sulla transparenza und der Tutela giurisdizionale nach dreißig Tagen in Kraft treten. Dies ist wohl so zu verstehen, dass der Tag der Veröffentlichung – ausnahmsweise, vgl. dazu c. 203 § 1 mit c. 8 § 1 CIC analog – mitzuzählen ist, mithin also das gesamte Regelwerk am 01.07.2020, 0 Uhr MESZ, in Kraft getreten ist.
Das Incipit, also die Anfangsworte des Motu Proprio, bieten ein bewusst gewähltes Zitat aus c. 1284 § 1 CIC. Aus diesem Anlass sei nachstehend die Frage aufgegriffen, was unter der „Sorgfalt eines guten Hausvaters“ im Kontext des kirchlichen Vermögensrechts zu verstehen ist. Handelt es sich hierbei lediglich um gesetzgeberische Lyrik? Oder soll den Verwalter*innen kirchlichen Vermögens ein bestimmtes Leitbild für ihr Handeln vor Augen gestellt werden? Oder wird damit – wenn auch sehr abstrakt – ein ganz bestimmter Haftungsmaßstab formuliert?
In einer ersten Annäherung an diese Frage sei zunächst der Hinweis gestattet, dass bereits in den Schriften des Neuen Testaments der gute Verwalter zum Thema wird (vgl. insbesondere 1 Petr 4,10; Lk 12, 42 f.; 16,1–8).
Sodann sei darauf aufmerksam gemacht, dass für Kenner*innen des Zivilrechts romanischer Länder die Rechtsfigur des „guten pater familias“ bzw. dessen Sorgfalt keine unbekannte Größe ist. So begegnet die „diligenza del buon padre di famiglia“ in den Artt. 382, 1001, 1148, 1176, 1587, 1710, 1768, 1804, 2148, 2167 des Italienischen Zivilgesetzbuchs von 1942. Ebenso stellt das spanische Bürgerliche Gesetzbuch von 1889 in mehreren Normen auf den „buen padre de familia“ bzw. dessen „diligencia“ ab (vgl. Artt. 270, 497, 1094, 1104, 1719, 1788, 1801, 1867, 1889, 1903 Código Civil). Von dort ist diese Rechtsfigur auch im Zivilrecht verschiedener lateinamerikanischer Länder bis auf den heutigen Tag beheimatet. Ferner kannte auch das französische Zivilrecht bis ins Jahr 2014 den Haftungsmaßstab der „Sorgfalt des guten Hausvaters“, bis dieser geprägte Fachausdruck aus Gründen der Gleichstellung der Geschlechter aus der französischen Rechtssprache ausgemerzt und durch das Adjektiv „raisonnable“ bzw. das Adverb „raisonnablement“ (dt. vernünftig, besonnen) ersetzt wurde – womit wohl nicht zuletzt auf die in der angloamerikanischen Rechtstradition beheimatete „besonnene Person (reasonable person)“ angespielt wurde.
Im Blick auf die kirchliche Rechtsgeschichte ist zunächst festzustellen, dass c. 1284 § 1 CIC substanziell auf den ersten Halbsatz des can. 1523 CIC/1917 zurückgeht. Hinsichtlich der vier offiziösen Quellenstellen zu diesem Kanon fällt auf, dass sich die Redeweise von der Sorgfalt eines guten pater familias offensichtlich nicht bis in das mittelalterliche Corpus Iuris Canonici zurückverfolgen lässt. Vielmehr datiert die einzige Quelle zu can. 1523 CIC/1917, in der dieser Ausdruck begegnet, aus dem Jahr 1807; es handelt sich um eine Instruktion der S. Congregatio de Propaganda Fide (vgl. Justinian Serédi [Hg.], Codicis Iuris Canonici Fontes, Bd. 7, Vatikanstadt 1935, S. 216–218 [Nr. 4688], hier 217): Die Personen – schreibt die Kongregation –, die kirchliche Güter oder Geld verwalten, dürfen sich von Mühen und Schwierigkeiten nicht abschrecken lassen, wobei sie „omnem diligentiam in hisce omnibus adhibentes, quam prudens ac probus paterfamilias adhibere solet in rebus suis.“ Letztlich wirft dieser Befund die Frage auf, ob die Formulierung des can. 1523 CIC/1917 möglicherweise nicht im Rückgriff auf die kanonische Rechtstradition im engeren Sinn, sondern auf das zeitgenössische Zivilrecht zustande gekommen ist – eine Hypothese, der im Rahmen dieses Beitrags leider nicht weiter nachgegangen werden kann.
Im römischrechtlichen Corpus Iuris Civilis, dort vor allem in den Digesten, wird die Sorgfalt des pater familias, also des antiken Hausvorstands, wiederholt thematisiert. Zu nennen wären etwa D. 4.4.11.5, D. 7.1.65 pr., D. 10.2.25.16, D. 13.6.18 pr., D. 13.7.14, D. 13.7.22.4, D. 19.1.54, D. 35.1.111, D. 38.1.20.1, D. 38.15.2.5 und D. 45.1.137.2, wo der „diligens pater familias“ begegnet, sowie D. 7.1.9.2, D. 7.8.15.1, D. 18.1.35.4 und D. 40.4.22, wo vom „bonus pater familias“ die Rede ist. Der sorgfältige bzw. gute Hausvater, so die Quintessenz aus den genannten Stellen, ist zwar gegen Zufälle und Schicksalsschläge nicht gefeit. Zugleich unternimmt er jedoch jede Anstrengung, um sich und die Seinen vor vorhersehbarem Schaden zu bewahren. Wirtschaftet er mit fremdem Gut, so wirtschaftet er nachhaltig und beutet den Anderen nicht aus, sondern trägt dafür Sorge, dass sich das anvertraute Vermögen nicht verschlechtert. Zugleich haftet der Hausvater – der allein den antiken Oikos im Rechtsverkehr nach außen vertritt – nicht nur für eigenes Verschulden, sondern auch für das Verschulden der ihm unterstehenden Personen. Insgesamt ist der Hausvater in dieser Rolle wohl zu einer höheren und zugleich objektivierten Sorgfalt verpflichtet, die über den (subjektiven) Maßstab der Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten hinausgeht. (Insofern bietet die erwähnte Instruktion der Propaganda in der zitierten Formulierung eine Mischform zweier unterschiedlicher Sorgfaltsmaßstäbe, da sie einerseits den „prudens ac probus paterfamilias“ ins Spiel bringt, andererseits von dessen „diligentia quam in rebus suis“ spricht.) Wer dagegen anvertrautes Gut ohne Not einem erhöhten Verlustrisiko aussetzt, kann auch zu einer verschuldensunabhängigen Haftung herangezogen werden. Ferner zeichnet sich der sorgsame Hausvater dadurch aus, dass er sich insbesondere in rechtlichen Zweifelsfragen fachkundig beraten lässt. Kurz gesagt ist der gute Hausvater also derjenige, der „an alle Mitglieder der Familie zu denken hat, weil er die tatsächliche und wirtschaftliche Verantwortung für sie trägt, und er es auch ist, der seine Entscheidungen zum Wohle aller trifft“ (Katharina Stypulkowski, Der bonus pater familias im klassischen Römischen Recht, Hamburg 2017, S. 54).
Wie jedoch soll in der alltäglichen Verwaltungspraxis dieses abstrakte Ideal eingeholt und operabel gemacht werden? Im bereits erwähnten Kommunique des Vatikanischen Pressesaals wird versucht, die Figur des „guten Familienvaters“ und dessen Sorgfalt in der Vermögensverwaltung mithilfe eines modernen Vokabulars anschaulich zu machen: Es sei damit jener Verwalter zum Leitbild erhoben, „che desidera una gestione efficace ed etica delle proprie risorse (dt.: der sich eine effektive und ethische Verwaltung seiner Ressourcen wünscht)“. Die Anreicherung des Leitbilds um ethisches Handeln ist insofern bemerkenswert, als zwischen einer effektiven und einer ethischen Verwaltung ohne weiteres Zielkonflikte denkbar sind, die also von wahrhaft guten Verwalter*innen auszubalancieren sind. Nüchterner, aber vielleicht auch hilfreicher, sind dagegen zwei Ansätze des Kirchenrechts, in denen das Schlagwort vom „guten Hausvater“ zu konkreten Handlungsanweisungen heruntergebrochen wird.
Zu nennen ist hier zum einen der § 2 unseres c. 1284 CIC, der in einem (allerdings in der im CIC vorliegenden Redaktion nur neun Punkte umfassenden) „Dekalog des guten Verwalters“ wichtige Handlungsweisen vorschreibt, die Verwalter*innen als Mindeststandard erfüllen müssen, um sich das Prädikat „gut“ zu verdienen:
- Sicherung des anvertrauten Vermögens gegen Schaden und Verlust;
- Sicherung der Rechtsstellung als Eigentümer nach weltlichem Recht;
- Beachtung des kanonischen und des weltlichen Rechts und der Stiftungszwecke sowie Abwendung von Schaden, der aus Nichtbeachtung des weltlichen Rechts entstehen kann;
- ordnungsgemäße Einforderung und Verwendung von Einkünften und Erträgnissen;
- ordnungsgemäße Bedienung und Tilgung von Darlehen;
- vorteilhafte Anlage von Bilanzüberschüssen;
- geordnete Führung der Bücher;
- jährliche Rechenschaftslegung;
- ordentliche Führung und Aufbewahrung von Dokumenten und Belegen.
Zum anderen ist auf das von der Kongregation für die Bischöfe im Jahre 2004 herausgebrachte Direktorium für den Hirtendienst der Bischöfe hinzuweisen, wo in Nr. 189 zunächst fünf grundlegende Kriterien für die bischöfliche Güterverwaltung genannt werden, nämlich das Kriterium pastoraler und technischer Kompetenz; das Kriterium der Beteiligung, d.h. der Beachtung von Beispruchsrechten (Anhörungsrechten); das aszetische Kriterium; das apostolische Kriterium, d.h. eine strikte Zweckbindung der auszugebenden Mittel; sowie das Kriterium des guten Hausvaters. Unter letzterem Kriterium versteht die Kongregation dann allerdings nicht etwa (nur) die aus c. 1284 § 2 CIC bekannten Handlungsmaximen, sondern erstellt in sechs eigenen Punkten, die sich nur teilweise mit den Vorgaben gemäß c. 1284 § 2 CIC überschneiden, geradezu ein Kompendium wichtiger Normen des kanonischen Vermögensrechts:
- Sicherung der Eigentumsverhältnisse in zivilrechtlich gültiger Form sowie Beachtung der Bestimmungen des kanonischen und des zivilen Rechts sowie der Stiftungszwecke (vgl. c. 1284 § 2 Nrn. 2–3 CIC);
- Beachtung des weltlichen Arbeits- und Sozialrechts nebst Beachtung der Grundsätze der katholischen Soziallehre (vgl. c. 1286 Nr. 1 CIC);
- Beachtung des weltlichen Rechts, insbesondere im Bereich des Vertragsrechts sowie des Rechts der Verfügungen von Todes wegen (vgl. cc. 1290; 1299 § 2 CIC);
- Beachtung der Regelungen betreffend Akte der außerordentlichen Verwaltung sowie die kanonischen Vorschriften betreffend die Veräußerung, Vermietung und Verpachtung von Kirchenvermögen (vgl. cc. 1277; 1292 § 1; 1297 CIC);
- Weckung von Verantwortungsbewusstsein bei den übrigen Hirten und Verwaltern, auch hinsichtlich des Schutzes wertvoller (Kunst-)Gegenstände vor Beschädigung und Diebstahl (vgl. c. 1220 § 2 CIC);
- Förderung der Erstellung von Inventarverzeichnissen (vgl. c. 1283 Nr. 2 CIC).
Die Differenz der beiden Regelungskataloge legt nahe, dass der „gute Hausvater“ als Inbegriff guter Verwalterschaft für den kirchlichen Gesetzgeber eine idealtypische Figur ist, auf die Tugenden wie Weitblick, Verantwortungsbewusstsein, Klugheit, soziale Achtsamkeit und Sinn für Gerechtigkeit projiziert werden können, ohne dass damit jedoch bereits ein fertiges Rollenmuster vorgegeben wäre. Vielmehr bleibt es Aufgabe der Rechtsordnung, diesen Idealtyp zu dechiffrieren und konkrete Rechtspflichten abzuleiten. Zugleich – und zahlreiche Fundstellen aus dem Römischen Recht, in denen der Besitzer einer fremden Sache sich und sein Verhalten am Maßstab der Sorgfalt eines guten paterfamilias messen lassen muss, unterstreichen dies – erinnert dieses Leitbild alle Verwalter*innen kirchlichen Vermögens daran, dass sie fremdes Gut verwalten; und deshalb mit dem anvertrauten Gut mindestens genauso sorgfältig, wenn nicht sogar noch gewissenhafter umgehen müssen als mit ihrem privaten Eigentum.
Möge in diesem Sinne die jüngste vermögensrechtliche Gesetzgebung des Papstes den in der Vermögensverwaltung des Apostolischen Stuhls und des Staates der Vatikanstadt tätigen Verwalter*innen dabei helfen, ihrer Aufgabe angesichts der ökonomischen und ethischen Herausforderungen der heutigen Zeit und ihres Wirtschaftssystems noch besser gerecht zu werden.
c. 534 § 1
„Parochus […] obligatione tenetur singulis diebus dominicis atque festis in sua dioecesi de praecepto Missam pro populo sibi commisso applicandi; qui vero ab hac celebratione legitime impediatur, iisdem diebus per alium aut aliis diebus per se ipse applicet.“
„Der Pfarrer ist […] verpflichtet, an allen Sonntagen und in seiner Diözese gebotenen Feiertagen eine Messe für das ihm anvertraute Volk zu applizieren; ist er an dieser Zelebration rechtmäßig verhindert, so hat er an denselben Tagen durch einen anderen oder an anderen Tagen persönlich zu applizieren.“
von Martin Rehak
Im nachstehenden Beitrag wird die Frage aufgeworfen, ob die Applikationsverpflichtung der Pfarrer zu einer Missa pro populo – in der deutschen Pfarrpraxis nicht selten als „Pfarrgottesdienst“, „Amt für die Pfarrgemeinde“, „Pfarrmesse“, „Eucharistiefeier für die Pfarrgemeinde“, „Messfeier für die Pfarreiengemeinschaft“ oder ähnlich bezeichnet – auch während des (faktischen) Verbots öffentlicher Gottesdienste aufgrund der Corona-Pandemie bestand und besteht. Dabei wird „Applikation“ üblicherweise in etwa dahingehend definiert, dass der Priester jemanden so in die Messfeier einordnet, dass diese Person in besonderer Weise als Mitopfernde*r erscheint und/oder an den Gnadenwirkungen des heiligen Opfers teilhat. Im Zuge der Verpflichtung zur Applikation für das Pfarrvolk ist der Pfarrer also gehalten, die besagten Gnadenwirkungen dem gesamten Pfarrvolk zuzuteilen. Zum besseren Verständnis seien dazu im Folgenden zunächst die theologischen Hintergründe des Konzepts der Mess-Applikation erläutert sowie die Rechtsgeschichte der Applikationspflicht skizziert:
Theologische Hintergründe
Es heißt in der Schrift: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht“ (Joh 12,24). Und ein anderes Schriftwort sagt: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht“ (Joh 15,5). Die Fülle neutestamentlicher Schriftstellen, in denen die Frage des Fruchtbringens (vor allem im Blick auf die Wirksamkeit der Verkündigung des Evangeliums) reflektiert wird, ließe sich leicht vermehren. Mit Blick auf die hier ausgewählten Schriftstellen – die vielleicht nicht zufällig im Evangelium nach Johannes vor und nach dessen Darstellung des Letzten Abendmahls Jesu (vgl. Joh 13,1–14,31) platziert sind – fällt jener nexus mysteriorum auf, wie er für die christliche Glaubenslehre und die katholische Theologie eigentümlich ist: Eine offensichtliche Verknüpfung zwischen (1) der Materie des eucharistischen Opfers – Wein vom Weinstock und Brot aus Weizenmehl (vgl. c. 924 CIC) –, (2) dem Opfergedanken in Verbindung mit dem Tod des Protagonisten, (3) dem Konzept inniger communio zwischen dem Herrn und seinen Jünger*innen, sowie (4) dem Gedanken des Fruchtbringens. Es kann daher nicht verwundern, dass seit den Anfängen christlicher Theologie eine wechselseitige Deutung des Kreuzestodes Jesu und des christlichen Gottesdienstes in Gestalt des vom Herrn gestifteten Gedächtnismahles stattgefunden hat. Nach katholischer Glaubenslehre ist die Eucharistiefeier eine Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Jesu Christi und damit zugleich ein Opfer des Dankes und Lobes, aber auch ein Bittopfer und ein Opfer der Versöhnung (vgl. zu Letzterem statt anderer Röm 3,25). Die wesentliche Opferhandlung ist dabei die Wandlung – genauer gesagt die Doppelkonsekration von Brot und Wein –, mit der die Hingabe Christi „für uns und für die Vielen“ gleichsam aktualisiert, zeichenhaft versinnbildlicht, und immer wieder neu in das Bewusstsein der feiernden Gemeinde gerückt wird. Dabei ist es zwar der Priester, der als sacerdos die dos sacra, die eucharistischen Gaben, als „mein und euer Opfer“ darbringt. Die Trägerin des christlichen Gottesdienstes ist jedoch stets die gesamte Gemeinde, wie etwa in 1 Kor 14,26 („Wenn ihr zusammenkommt, trägt jeder etwas bei“) unmissverständlich zum Ausdruck gebracht wird; bei Paulus freilich mit Blick auf immaterielle Beiträge. Bereits im 2. Jh. dürfte sich jedoch der Brauch entwickelt haben, dass die Mitfeiernden materielle Gaben zur Eucharistiefeier mitbrachten, darunter auch (aber nicht nur) das Brot und den Wein für das eucharistische Opfer. Seither sind der Ritus der Gabenbereitung, gelegentlich noch erweitert um eine Gabenprozession, sowie die zeitgleiche (Geld-)Kollekte ein integrierender Bestandteil der Messe. Auf diese Weise wird die gesamte versammelte Gemeinde zu Mit-Opfernden und konstituiert sich mit anderen Worten als Opfergemeinschaft, was insbesondere auch in der Einleitung zum Gabengebet – zumindest in Form A: „die Gaben der Kirche“ und in Form C: „mein und euer Opfer“ – deutlich zum Ausdruck kommt. (Von daher wäre es im Weiteren wohl eine Verkürzung, wenn man die Dimensionen von Lob, Dank und Bitte als anabatisches Handeln der Gemeinde beschriebe, die Dimension der Versöhnung [bzw. antiquierter ausgedrückt: der Sühne] hingegen als katabatisches Handeln Gottes – denn auch die Versöhnung mit Gott in der Eucharistiefeier kann als ein aktives Tun des/der Gläubigen, auf den/die die Messe appliziert wird, verstanden werden; freilich ein Tun, das ihm/ihr nur in, mit und durch Christus möglich ist.)
Seit dem frühen Mittelalter hat sich der Brauch entwickelt, dass Gläubige ihre Opfergaben nicht nur während der Eucharistiefeier gegeben haben, sondern auch schon zeitlich vorher (und dann an der Messe, für die die Gaben gegeben wurden, vielleicht gar nicht persönlich teilgenommen haben). Mit dieser Praxis der zeitlichen Entkoppelung von Opfergabe und persönlicher Teilnahme an der Eucharistiefeier war das Mess-Stipendium (früher auch: Mess-Almosen) geboren. Der/die Almosen- oder Stipendiengeber*in verband mit seiner/ihrer Gabe freilich die Erwartung, dass er/sie trotz körperlicher Abwesenheit dennoch als zumindest geistig Mitfeiernde*r angesehen wurde, also der eucharistischen Opfergemeinschaft verbunden blieb. Um dies zu ermöglichen, gewann die Intention des Zelebranten eine zentrale Bedeutung. Kraft entsprechender Intention des Zelebranten war es möglich, eine konkrete Zuordnung von Gabe, Geber*in und Eucharistiefeier auch dann vorzunehmen, wenn der/die Geber*in bei dieser Feier gar nicht persönlich anwesend war, so dass dank der Intention des Zelebranten der/die Geber*in weiterhin als Mit-Opfernde*r dieser einzelnen Feier angesehen werden konnte.
Insofern die Eucharistiefeier Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Jesu Christi ist, vergegenwärtigt sie nun auch dessen Wirkungen; oder bildlich gesprochen, dessen Früchte – nämlich Leben und Heil für die Welt (vgl. dazu Hochgebete I und II: „Brot des Lebens“, „Kelch des Heiles“). Durch das „Opfer unserer Versöhnung“ (Hochgebet III) wird gleichsam das erlösende Heilshandeln Gottes in Christus, welches die allgemeine und abstrakte Ursache für die Heilshoffnung der Gläubigen ist, für die einzelnen Gläubigen, die Eucharistie feiern, konkrete Wirklichkeit und entfaltet konkrete Wirksamkeit. Diese Zuwendung der Heilstat Gottes am Kreuz in der Eucharistie an die einzelnen Gläubigen wird in der theologischen Fachsprache als Applikation bezeichnet – in Anlehnung an ein Diktum des Thomas von Aquin, wonach man eine allgemeine Ursache (nur) durch etwas Spezielles so zuwenden (applicare) kann, dass hieraus individualisierte Wirkungen für den Einzelnen resultieren (vgl. Thomas Aquinatus, Summa Theologie III, q. 52 art. 1 ad 2: „Causa autem universalis applicatur ad singulares effectus per aliquid speciale.“). Das Spezielle wäre dann in unserem Zusammenhang – je nach Deutung – entweder die Eucharistiefeier an sich oder die Intention des Zelebranten.
In der scholastischen Theologie wurden unterschiedliche Auffassungen in der Frage vertreten, ob der Wert einer Eucharistiefeier im Hinblick auf die Wirkungen, die sie gleichsam in den Herzen der Gläubigen erzielen kann; oder anders gesagt: im Hinblick auf die Früchte, die sie hervorbringt und die dann potenziell den Gläubigen zugewandt werden können, endlich oder unendlich ist. Während Thomas von Aquin und im Anschluss an ihn die von Dominikanern getragene theologische Tradition von der unendlichen Größe jeder einzelnen Messopferfrucht ausgingen, hat die Scholastik franziskanischer Prägung – mit Bonaventura und Duns Scotus als bekanntesten Protagonisten – eine endliche Größe der Frucht, die eine einzelne Messe in der Vergegenwärtigung des unendlich großen Kreuzesopfers hervorbringen kann, angenommen. (Zu meiner persönlichen Überzeugung ist die thomistische Theologie in dieser Frage die einzig richtige; jedoch ist die Wirkung, welche die einzelne Eucharistiefeier im Herzen des einzelnen Gläubigen erzielen kann, normalerweise endlich und durch die Größe der fides und der devotio des/der Einzelnen begrenzt, wie Thomas im Anschluss an die Theologie des Hochgebets I betont [vgl. Canon Romanus, Memento I: „Herr, Du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe; für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar, und sie selbst opfern es dir für sich und alle, die ihnen verbunden sind; für die Erlösung ihrer Seelen und für die Hoffnung auf ihr Heil und ihre Unversehrtheit“]). In der Folge hat Duns Scotus die bis ins 20. Jh. hinein intensiv rezipierte Auffassung vertreten, dass die Wirkungen oder Früchte, die der Eucharistiefeier als Bitt- und Sühnopfer entspringen, in ganz besonderer Weise (specialissime) dem Zelebranten zugutekommen; in mittlerer oder besonderer Weise (medio modo vel specialiter) dem/der Geber*in eines Mess-Stipendiums, aber nur in allgemeiner Weise (generale) den sonstigen mitfeiernden Gläubigen. Damit war die von der Alten Kirche geschaffene Ausgangssituation geradezu auf den Kopf gestellt, insofern aus dem Sonderfall – Zuwendung der Messe (bzw. deren Frucht) an eine*n persönlich Abwesende*n – zumindest im Bewusstsein vieler Gläubiger der Regelfall wurde; um von der privilegierten Stellung des Zelebranten ganz zu schweigen.
Rechtsgeschichte der Applikationspflicht für das Volk
Es zählt zu den bleibenden Verdiensten des Reformkonzils von Trient (1545–1563) – oder um es noch deutlicher zu sagen: dem Verdienst des Kirchenrechts in Gestalt der nachfolgenden, von Trient inspirierten päpstlich-kurialen Gesetzgebung – hier für die katholische Kirche eine Trendwende eingeleitet zu haben. Denn das Tridentinum hat in seiner 23. Sitzung mit Blick auf die Pfarrer verkündet, dass „durch göttliche Weisung allen, denen die Seelsorge anvertraut ist, geboten ist, ihre Schafe zu kennen [und] für sie das Opfer darzubringen“ (vgl. Conc. Tridentinum, sessio 23, decreta super reformatione, can. 1 = Alberigo / Wohlmuth [Hg.], Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bd. 3: Konzilien der Neuzeit, S. 744). Diese Regelung korrespondiert in gewisser Weise mit der vom selben Konzil bereits in der 22. Sitzung eingeschärften Sonntagspflicht (vgl. dazu jetzt c. 1247 CIC) der Gläubigen (vgl. Conc. Tridentinum, sessio 22, doctrina et canones de sanctissimo missae sacrificio, cap. 6 = Alberigo / Wohlmuth [Hg.], COD III, S. 734). Auf dieser Grundlage wurde erstmals in einer Einzelfallentscheidung der Konzilskongregation aus dem Jahre 1648 klargestellt, dass für diese Pfarrmesse kein Mess-Stipendium angenommen werden dürfe (vgl. SC Conc., Entscheidung vom 08.08.1648, in: Gasparri [Hg.], CIC-Fontes, Bd. 5, S. 308 f. [Nr. 2685]). Damit hat Rom zugleich zu dem seinerzeitigen Fachdiskurs in der Kanonistik Stellung bezogen, ob Trient den Pfarrern lediglich die Zelebration für das Volk, oder auch die Applikation der zelebrierten Messe für das Volk aufgetragen habe. In der Folge wurden unter Bezugnahme auf die genannte Präzedenzentscheidung wiederholt Anfragen von Pfarrern mit dem Ziel, sich – unter Verweis auf ihre Armut und die Notwendigkeit, sich über Mess-Stipendien zu finanzieren – der sonntäglichen Applikationspflicht zu entziehen, abschlägig beschieden. Von Papst Benedikt XIV. (1740–1758) stammt die Enzyklika Cum semper aus dem Jahre 1744, mit der erstmals – allerdings räumlich beschränkt auf Italien – eine umfassende kirchenrechtliche Regelung der Applikationspflicht erfolgte. Auch hier wurde das Thema möglicher Befreiungsgründe äußerst restriktiv gehandhabt. Nur im Falle einer wirklichen Notlage gestattete der Papst die Annahme eines Mess-Stipendiums für Sonntagsmessen, dies allerdings geknüpft an die Bedingung, dass der Pfarrer (1) diese gesponsorte Messe öffentlich und in der Pfarrkirche feiert und (2) die Verpflichtung zur Applikation einer Messe für das Pfarrvolk an einem der darauffolgenden Werktage nachholt. Die vielleicht schon vom Konzil von Trient angelegte Koppelung zwischen der Sonn- und Feiertagspflicht der Gläubigen und der Pflicht zur Applikation der Messe für das Volk kam in der Gesetzgebung Benedikts XIV. darin zum Vorschein, dass die Applikationspflicht auch für „halbe“ Feiertage galt, an denen die Gläubigen zwar zum Besuch der Messe verpflichtet waren, danach aber ihrer Arbeit nachgehen konnten oder mussten. Darüber hinausgehend vertraten die römischen Kongregationen in der Folgezeit dann sogar die Auffassung, dass die Applikationspflicht, einmal eingeführt, auch an zwischenzeitlich durch Reform des liturgischen Kalenders „aufgehobenen“ Feiertagen fortgelte, an denen die Gläubigen nicht mehr zum Messbesuch verpflichtet waren. Die Logik dieser Regelung bestand darin, dass mit der gesetzlichen Applikationspflicht ein Mindestmaß an Mess-Applikationen für das Volk geschaffen und der einmal etablierte Mindeststandard nicht mehr unterschritten werden sollte; eine höhere Quote der Mess-Applikationen für das Volk in Relation zu den Mess-Applikationen nach Meinung des/der Geber*in eines Stipendiums war jedoch erwünscht. Mit weiteren Gesetzgebungen der Päpste Pius IX., Leo XIII. und Pius X. erfuhr das Recht der Applikationspflicht pro populo dann jene Ausgestaltung, die vom Kodex des kanonischen Rechts des Jahres 1917 rezipiert wurde und mit geringen Änderungen auch heute geltendes Recht ist.
Geltende Rechtslage
Von daher kann Heribert Hallermann in seiner Monographie „Pfarrei und pfarrliche Seelsorge“ das Wesen und den theologisch-pastoralen Sinn der pfarrerlichen Applikationspflicht zutreffend so zusammenfassen:
„Die Applikation der Messe ist ein Willensakt des Zelebranten, durch den er einen Gläubigen oder eine Gemeinschaft von Gläubigen so als aktiv Mitfeiernde in die Messfeier einordnet, dass die Betreffenden in besondere Weise an den Früchten des heiligen Opfers teilhaben. Weil der Pfarrer kraft seines Amtes für den Aufbau und das Wachstum und das immer fruchtbarere Leben der ihm anvertrauten Pfarrei verantwortlich ist, ist die Feier der Eucharistie für die ihm anvertraute Gemeinde auf geistlicher Ebene der entscheidende Beitrag, um dieser Hirtenverantwortung gerecht zu werden. Die Applikation macht einerseits deutlich, dass das Amt des Pfarrers zutiefst ein geistliches Amt ist, und andererseits, dass es Christus selber ist, der seine Gemeinde zusammenruft, aufbaut und belebt“ (vgl. a.a.O., S. 319).
Zur rechtlichen Ausgestaltung der Applikationspflicht gemäß c. 534 CIC kann zusammenfassend gesagt werden, dass diese Verpflichtung dem Grundsatz nach eine höchstpersönliche Pflicht ist. Nur ausnahmsweise, nämlich im Falle rechtmäßiger Verhinderung (z.B. bei Erkrankung oder Pfarreiabwesenheit zwecks Urlaubs, Exerzitien, oder aus dienstlichen Gründen), kann der Pfarrer einen anderen Priester bitten, stellvertretend für ihn die Applikationsverpflichtung zu erfüllen. Findet der Pfarrer keinen derartigen Stellvertreter, so muss er die ausgefallenen Applikationen pro populo später persönlich an Werktagen nachholen. Im Übrigen gilt eine analoge Applikationspflicht gemäß c. 540 § 1 CIC auch für Pfarradministratoren und gemäß c. 543 § 2 Nr. 2 CIC auch für die bzw. einen der Priester, die als Equipe gemäß c. 517 § 1 CIC solidarisch eine Pfarrei leiten. Dagegen nimmt c. 549 CIC den Pfarrvikar ausdrücklich von der Applikationspflicht aus; das bedeutet dann übrigens (nach meinem Verständnis), dass ein Pfarrer auch im Falle eigener Verhinderung einen ihm als mitwirkenden Priester zugewiesenen Pfarrvikar nicht einfach so anweisen kann, ihn im genannten Fall rechtmäßiger Verhinderung zu vertreten. (Eine Regelung, die vom pastoralen Standpunkt freilich nur insoweit verständlich und von innerer Berechtigung ist, inwieweit in manchen Teilen der Weltkirche ein Pfarrvikar auch heute noch auf Mess-Stipendien angewiesen ist, um daraus seinen Lebensunterhalt zu finanzieren.) Und auch der priesterliche Moderator, der in vakanten Pfarreien gemäß c. 517 § 2 CIC als Beauftragter des Diözesanbischofs die Ausübung der Hirtensorge durch einen oder mehrere Pfarrbeauftragte (Diakon oder Laien) anleitet, ist ausdrücklich von den Pflichten eines Pfarrers und damit von der Applikationsplicht gemäß c. 534 CIC befreit.
Die Annahme eines Mess-Stipendiums für die Messe mit Applikationspflicht pro populo ist (nach wie vor) untersagt, was sich (etwas versteckt) aus der Norm des c. 948 CIC ergibt, wonach für verschiedene Intentionen auch verschiedene Messen zu feiern sind, was also die Kumulation der Intentionen, die Messe für das anvertraute Volk und nach Meinung des/der Stipendiengeber*in zu feiern, ausschließt. (Davon zu unterscheiden ist der Brauch, auch im „Amt für die Pfarrgemeinde“ die Namen von Mess-Stipendiengeber*innen zu nennen, was mit deren ausdrücklicher Genehmigung möglich ist.) Die Applikationspflicht ist damit zugleich ein Instrument des Gesetzgebers, den Pfarrern immer wieder neu vor Augen zu führen, dass das Amt des Pfarrers – anders, als das im Mittelalter und der Neuzeit oft der Fall gewesen ist – nicht als ein Wirtschaftsbetrieb aufgefasst werden möge, bei dem aus entsprechenden Einnahmen der eigene Lebensunterhalt zu generieren ist. Vielmehr – ohne dass dies gegen jenes andere Schriftwort, wonach „der Arbeiter seines Lohnes wert ist“ (vgl. Lk 10,7), ausgespielt werden soll – wird damit jenes Schriftwort betont: „Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben“ (Mt 10,8). Die Applikationspflicht ist mit anderen Worten – gegen die privatrechtliche, immer an der Schwelle zur Simonie lavierende Mess-Stipendienpraxis früherer Jahrhunderte – ein Ausdruck der innerkirchlichen Solidarität und Uneigennützigkeit seitens des zelebrierenden Priesters.
Unterschiedliche Auffassungen lassen sich wohl in der Frage vertreten, ob (wie vorzugswürdig) die Pfarrmesse nicht nur für die lebenden, sondern auch für die verstorbenen Pfarrangehörigen zu applizieren ist; oder nur für die Lebenden. Die Positionierung in dieser Frage ist dann entscheidend für den (hoffentlich eher theoretischen) Fall, dass einem Pfarrer sein Pfarrvolk durch welchen Unglücksfall oder welche demographische Entwicklung auch immer restlos abhandenkommt. Folgt man der zweitgenannten Auffassung, so geht mit dem Pfarrvolk allerdings auch die Applikationspflicht unter.
Befreiung von der Applikationspflicht wegen Corona-Pandemie?
Mit Blick auf die Gottesdienstverbote der zurückliegenden zwei Monate sei nach den vorstehenden Grundlegungen nun die Frage aufgeworfen, ob dies für die betroffenen Pfarrer zu einer Befreiung von der Applikationspflicht geführt hat?
Insoweit ist zunächst kurz die Frage anzureißen, ob – angesichts der Theorie des Tridentinums, wonach die Applikationspflicht sich „göttlicher Weisung“ verdanke – eine Befreiung, etwa im Wege einer (stillschweigenden?) Dispens, überhaupt denkbar ist? Hierzu ist zu sagen, dass diese Qualifikation der Applikationspflicht seitens Trient sicherlich überzogen war und vom Konzil selbst die Formulierung wohl als kirchenpolitisches Vehikel gebraucht wurde, um die Pfarrer überhaupt zur Beachtung der Applikationspflicht (und der im selben Kanon statuierten Residenzpflicht) zu ermutigen. Denn es ist nicht oder jedenfalls nicht ohne weiteres eingängig, wie eine Norm dem ius divinum zugehören kann, die ersichtlich erstmals im 16. Jh. aufgestellt wurde; die dabei nur die Inhaber eines unstreitig auf dem rein kirchlichen Recht beruhenden Amts des Pfarrers betraf (die analoge Applikationspflicht der Bischöfe ist eine sekundäre nachtridentinische Entwicklung!); und deren Geltungsumfang durch die Bezugnahme auf die gebotenen Feiertage den Änderungen des liturgischen Kalenders unterworfen ist, wobei es überdies nicht auf die gesamtkirchlichen, sondern die teilkirchlichen Festsetzungen ankommt.
Sodann sei darauf hingewiesen, dass es für die jüngere kanonistische Lehrtradition unstreitig war, dass die Applikationspflicht dann entfällt, und zwar ersatzlos entfällt, wenn es verboten war, an dem fraglichen Tage eine Messe zu feiern. Allerdings ist zu sehen, dass insoweit nur liturgierechtliche Messverbote im Blick waren, wie sie – nach dem Festkalender vor der vatikanischen Liturgiereform im Gefolge des Zweiten Vatikanischen Konzils – sich dann ergeben konnten, wenn das Fest Mariä Verkündigung (25.03.) auf einen Karfreitag (bzw. nach der Reform der Liturgie der Karwoche unter Pius XII. in den 1950er Jahren ggf. auch auf einen Karsamstag) fiel.
Dieses Argument ist indes mit Blick auf die Problematik der Pandemie-bedingten Gottesdienstbeschränkungen nicht wirklich stichhaltig: Denn hierdurch wurden nur – mit Blick auf die strikten Versammlungsbeschränkungen – öffentliche Eucharistiefeiern untersagt. Die Pfarrer hatten weiterhin die Möglichkeit, in faktisch privaten Eucharistiefeiern ihrer Applikationspflicht nachzukommen. In diesem Sinne wurde ja auch in den einschlägigen Dekreten des Bischofs von Würzburg darauf hingewiesen, dass die private Zelebration „in der gegenwärtigen Situation ein stellvertretender Vollzug“ sei (vgl. Dekret vom 16.03.2020, in: Abl. Würzburg 166 [2020] 88 f.).
Eine Besonderheit ergab sich für das Bistum Würzburg im zurückliegenden Monat Mai nun allerdings daraus, dass per Dekret des Diözesanbischofs vom 28.04.2020 zwar ab dem 04.05.2020 wieder öffentliche Gottesdienste, und zwar auch und besonders an Sonntagen, gestattet wurden; die Feier der Eucharistie hiervon aber einstweilen ausdrücklich ausgenommen wurde – eine Rechtslage, die durch das Bischöfliche Dekret vom 15.05.2020 mittlerweile dahingehend abgeändert wurde, dass seit dem 21.05.2020 auch wieder öffentliche Eucharistiefeiern gestattet sind, wenn auch nur unter den einschlägigen Auflagen. Was galt in Sachen sonntäglicher Applikationspflicht der Pfarrer im Bistum Würzburg aber am fünften und sechsten Sonntag der diesjährigen Osterzeit (10.05. und 17.05.2020): War hier weiterhin – fiat iustitia, pereat mundus – c. 534 CIC als geltendes Recht anzusehen? Konnte und musste also von den Pfarrern des Bistums erwartet werden, dass sie neben jenem (Wort-)Gottesdienst, den sie inhaltlich und organisatorisch für ihr Pfarrvolk vorbereitet und mit ihm gefeiert haben, zusätzlich privat eine missa pro populo zelebrierten? Oder durften sich die betroffenen Pfarrer – angesichts einer ausdrücklichen Nichtgestattung öffentlicher Eucharistiefeiern seitens ihres Bischofs – als immerhin rechtmäßig verhindert ansehen (mit der Folge, dass sie die Applikationspflicht gemäß c. 534 § 1 CIC an einen Dritten hätten delegieren können oder gemäß c. 534 § 3 CIC nach Wegfall des Hinderungsgrundes die versäumten Messen für das Volk nachzuholen hätten)? Oder waren sie als von der Applikationspflicht vollständig befreit zu betrachten?
Wie würden Sie entscheiden?
Da dort, wo kein Kläger, auch kein Richter ist, mag eine abschließende Beantwortung dieser Frage einstweilen dahinstehen. Und sollte bei einem Pfarrer infolge der Lektüre dieses Beitrags womöglich ein schlechtes Gewissen anschlagen, ist das insofern kein größeres Drama, als ja die Möglichkeit besteht, etwaige Pandemie-bedingt unterlassene Zelebrationen pro populo in den kommenden Tagen und Wochen nachzuholen; wobei das logischerweise nur in werktäglichen Eucharistiefeiern möglich ist, für die nicht bereits Mess-Stipendien angenommen wurden.
Und so sei der Blick abschließend von der Vergangenheit wieder auf die Gegenwart und Zukunft gelenkt: Insoweit ist nämlich abschließend zu bemerken, dass in Sachen Applikationspflicht der Juni 2020 ein relativ intensiver Monat ist. Denn zusätzlich zu den vier Sonntagen, die jeder Monat automatisch mit sich bringt, sind in Deutschland die Pfarrer auch am Pfingstmontag, der partikularrechtlich als Feiertag festgelegt ist (vgl. dazu MKCIC–Ahlers, c. 534, Rz. 9) und am Fronleichnamsfest zur Applikation für das Volk verpflichtet.
c. 838 § 4 CIC
„Ad Episcopum dioecesanum in Ecclesia sibi commissa pertinet, intra limites suae competentiae, normas de re liturgica dare, quibus omnes tenentur.“
„Dem Diözesanbischof steht es zu, in der ihm anvertrauten Kirche innerhalb der Grenzen seiner Zuständigkeit Normen für den Bereich der Liturgie zu erlassen, an die alle gebunden sind.“
von Martin Rehak
„Krisen bringen das Beste und das Schlechteste im Menschen hervor“. Hinsichtlich unserer Kanones des Monats sorgt die gegenwärtige Krise der SARS-CoV-2-Pandemie dafür, dass einigermaßen unverhofft mit c. 838 § 4 CIC ein Kanon erneut zu betrachten ist, dessen §§ 2–3 bereits im Oktober 2018 näher beleuchtet wurden.
C. 838 CIC thematisiert generell die Instanzen, die für disziplinäre (kirchenrechtliche) Regelungen in Bezug auf die Liturgie, d.h. den amtlichen Gottesdienst der Kirche (vgl. dazu c. 834 § 1 CIC), zuständig sind; nämlich den Apostolischen Stuhl (vgl. c. 838 §§ 1–3 CIC), die Bischofskonferenzen (vgl. c. 838 §§ 2–3 CIC) und den Diözesanbischof (vgl. c. 838 §§ 1+4 CIC).
Die Zuständigkeit des Diözesanbischofs für die Liturgie in seinem Bistum ergibt sich bereits aus seinem kanonischen Amtsprofil. Er hat gem. c. 381 § 1 CIC in seinem Bistum „alle ordentliche, eigenberechtigte und unmittelbare Gewalt“, so dass es ihm gem. c. 391 § 1 CIC zukommt, „die ihm anvertraute Teilkirche […] mit gesetzgebender, ausführender und richterlicher Gewalt zu leiten“. Dabei ist er gleichsam der erste Liturge seines Bistums (vgl. c. 387 CIC: „praecipuus mysteriorum Dei dispensator [der vornehmliche Ausspender der Geheimnisse Gottes]“), der nicht nur gem. c. 388 §§ 1–2 CIC gehalten ist, regelmäßig persönlich der Eucharistiefeier vorzustehen und diese für das ihm anvertraute Volk zu applizieren, sondern auch das geistliche Wachstum der Gläubigen aus und mit den Sakramenten und dem Gottesdienst der Kirche zu fördern (vgl. c. 387 CIC), sowie etwaigen Missbräuchen entgegenzutreten (vgl. c. 392 § 2 CIC).
Vor diesem Hintergrund bestätigt c. 838 § 4 CIC die gesetzgeberische Zuständigkeit des Diözesanbischofs für den Bereich der Liturgie. Diese Zuständigkeit ist bezogen auf die ihm anvertraute Teilkirche (vgl. dazu c. 368 CIC). Doch auch für Teilkirchen, die nicht in der Regelform der Diözese (des Bistums) verfasst sind, gilt c. 838 § 4 CIC. Mit anderen Worten: Unter dem Diözesanbischof im Sinne des c. 838 § 4 CIC sind also auch jene (ggf. nicht-bischöflichen) Leiter von Teilkirchen zu verstehen, die gem. c. 381 § 2 CIC dem Diözesanbischof im Recht gleichgestellt sind.
Bei seiner normsetzenden Tätigkeit muss der Diözesanbischof allerdings „innerhalb der Grenzen seiner Zuständigkeit“ verbleiben, damit seine Gesetzgebung rechtmäßig ist und kanonischen Gehorsam seitens der Gesetzesunterworfenen erheischen kann. Wie jedoch ist die Zuständigkeit des Diözesanbischofs begrenzt, und wofür ist er umgekehrt positiv zuständig?
Eine negative Abgrenzung ergibt sich vor allem aus c. 12 § 1 i.V.m. c. 135 § 2 CIC. Aus dem einen Kanon folgt, dass allgemeine, sprich gesamtkirchlich geltende Gesetze überall auf der Welt alle verpflichten, für die das fragliche Gesetz erlassen wurde. Der andere Kanon bestimmt, dass die Gesetzgebung untergeordneter Gesetzgeber – wie es die Diözesanbischöfe im Verhältnis zum Apostolischen Stuhl sind – ungültig ist, wenn sie höherem Recht, also einem gesamtkirchlichen Gesetz, widerspricht. Daher wäre die Gesetzgebungskompetenz des Diözesanbischofs gem. c. 838 § 4 CIC insoweit bereits erloschen, als die fragliche Materie bereits im kodikarischen Recht oder durch sonstige, auch die jeweilige Ortskirche betreffende Normsetzungen des Apostolischen Stuhls geregelt ist. Positiv umfasst die Zuständigkeit des Diözesanbischofs etwa die Herausgabe liturgischer Bücher mit teilkirchlichem Charakter (vgl. MKCIC–Althaus, c. 838, Rz. 5) sowie alle Regelungsgegenstände, die im Kodex des kanonischen Rechts selbst dem Diözesanbischof bzw. dem Ortsordinarius zugewiesen sind (vgl. dazu die Auflistung ebd.).
Nach Maßgabe des c. 678 § 1 CIC („Die Ordensleute unterstehen der Gewalt der Bischöfe […] in dem, was die Seelsorge, die öffentliche Abhaltung des Gottesdienstes und andere Apostolatswerke betrifft“) erstreckt sich die Regelungskompetenz des Diözesanbischofs dabei in personaler Hinsicht auch auf die Angehörigen der Orden päpstlichen Rechts. Das bedeutet, dass eine auf der Grundlage des c. 838 § 4 CIC ergangene diözesane Rechtssetzung auch von Ordensleuten zu beachten ist, wenn diese ihre Gottesdienste öffentlich abhalten. In Zeiten der Corona-Krise und den vielfältigen technischen Möglichkeiten, Gottesdienste beispielsweise durch Live-Streams im Internet zu verbreiten, ist dabei klarstellend auf folgendes hinzuweisen: Für die Öffentlichkeit im Sinne des c. 678 § 1 CIC kommt es nicht darauf an, ob der Raum, in dem der Gottesdienst gefeiert wird, der Öffentlichkeit zugänglich ist; sondern darauf, ob das Apostolat des Ordens in das Bistum hinein ausstrahlt.
Aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie hat c. 838 § 2 CIC als kodikarische Rechtsgrundlage bischöflicher Rechtssetzung in Bezug auf gottesdienstliche Feiern und Sakramentenspendungen eine neue Aktualität und Bedeutung erhalten. Seit März d. J. wurde bundesweit mit einer wohl bislang einmaligen Häufigkeit partikulares liturgisches Recht gesetzt.
So hatte noch vor Bekanntmachung der „Leitlinien zum einheitlichen Vorgehen zur weiteren Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich angesichts der Corona-Epidemie in Deutschland“ der Bundesregierung sowie der Ministerpräsident*innen der Länder vom 16.03.2020 der Kardinalerzbischof von München und Freising ein Allgemeines Dekret vom 13.03.2020 erlassen, mit dem – zunächst befristet bis 03.04.2020, eine Verlängerung bis zum 19.04.2020 erfolgte mit weiterem Allgemeinen Dekret vom 02.04.2020 – öffentliche Gottesdienste abgesagt, die Gläubigen von der Sonntagspflicht dispensiert, und weitere Verfügungen zu Taufen, Trauungen, Hauskommunion, Krankensalbungen und den Exsequien getroffen wurden, darunter die Erlaubnis nach c. 860 § 1 CIC zu eventuellen Taufspendungen in privaten Häusern und Wohnungen.
Der Bischof von Würzburg hat mit Dekret vom 16.03.2020 (vgl. Abl. Würzburg 166 [2020] 88 f.) für den Zeitraum 17.03.–19.04.2020 die Feier öffentlicher Gottesdienste verboten (vgl. § 1 Abs. 1 des Dekrets). Die „private Zelebration der Priester, ggf. mit einem Mitglied des Pastoralteams,“ blieb gem. § 1 Abs. 2 des Dekrets erlaubt, wobei der Bischof betonte, dass dies „in der gegenwärtigen Situation ein stellvertretender Vollzug“ sei. (An dieser Stelle wäre es gewiss reizvoll, etwa in dogmatischer, liturgiewissenschaftlicher und pastoraler Rücksicht die Frage zu vertiefen, ob nicht auch außerhalb der gegenwärtigen Situation all diese, die ihrer Sonntagspflicht [vgl. c. 1247 CIC] physisch nachkommen, die Eucharistie zugleich stellvertretend für all jene getauften Katholik*innen mitfeiern, die als Kasualienfromme, spirituelle Wanderer, Eventchristen sowie aus gesundheitlichen, Alters- oder sonstigen Gründen bei der gottesdienstlichen Feier nicht persönlich vor Ort anwesend sind.) Die weiteren Absätze des § 1 des Dekrets betrafen zum einen die Liturgien der Kar- und Ostertage (diese waren nicht öffentlich zu feiern) sowie Erstkommunionfeiern, Tauffeiern, Trauungen (diese waren alle, abgesehen von Nottaufen, zu verschieben); zum anderen Beisetzungen (im engsten Familienkreis statthaft, aber ohne Requiem) und Krankensalbungen sowie die Öffnung der Gotteshäuser zum privaten Gebet (beides statthaft).
Im selben Zeitraum (ca. 13.–18.03.2020) ergingen ähnliche Regelungen auch in anderen deutschen Bistümern, wie hier exemplarisch an weiteren zur Freisinger Bischofskonferenz gehörigen Bistümern illustriert sei: Im Bistum Augsburg erging „auf Weisung des Diözesanadministrators“ seitens des Generalvikariats eine Anordnung vom 16.03.2020, deren Regelungen mit Schreiben vom 07.04.2020 des Ständigen Vertreters des Apostolischen Administrators bezüglich der Absage von Erstkommunionfeiern, Firmungen, Trauungen und Taufen bis 01.06.2020 einschließlich verlängert wurde. Sofern im Erzbistum Bamberg und im Bistum Eichstätt über die bis zum 15.03.2020 verfügten Regelungen (vgl. dazu den bundesweiten Überblick) weitere Rechtssetzungsakte erfolgten, ist dies zumindest im Internet augenscheinlich nicht dokumentiert. Für die Bekanntmachung der im Bistum Passau zunächst bis zum 19.04.2020 geltenden Regelungen vom 16.03.2020 wurde die Form der Pressemitteilung gewählt. Als Besonderheit gegenüber den vergleichbaren Anordnungen anderer Bistümer sticht der Vermerk hervor, dass bei Bestattungen „der für das Triduum geltende Bestattungsritus zur Anwendung zu bringen“ sei. Im Bistum Regensburg wandte sich der Generalvikar mit einem Rundschreiben vom 18.03.2020 an die Pfarrer und Pfarradministratoren, in welchem klargestellt wurde, dass in jeder Pfarrei weiterhin Messfeiern stattfinden, „aber ohne Öffentlichkeit“, die der Priester „ggf. mit dem Kaplan/Pfarrvikar/Ruheständler, mit Diakon, Pastoralreferenten, Gemeindereferentin, Organist, und/oder Mesner, die das Kirchenvolk repräsentieren“, aber ohne Ministrant*innen feiert. Ergänzende pastorale Anregungen und Weisungen hierzu ergingen mit weiterem Rundschreiben vom 01.04.2020. Im Bistum Speyer wurden erste Regelungen vom 13.03.2020 zunächst durch Dienstanweisung (Rundschreiben) vom 17.03.2020 (auch in: Abl. Speyer 113 [2020] 60–64) des Generalvikars aktualisiert, der unter dem 26.03.2020 für die Pfarreien im rheinland-pfälzischen Teil und die Pfarreien im saarländischen Teil des Bistums ergänzende Dienstanweisungen und Hinweise folgten, wobei ungeachtet der Differenzierung nach Bundesländern beide Dienstanweisungen, abgesehen von einer farblich gekennzeichneten Abweichung für die saarländischen Pfarreien, wortwörtlich übereinstimmten und für gleiches Recht in allen Pfarreien des Bistums sorgten.
Was die Zielsetzung der vorgenannten Dekrete, Anordnungen und Dienstanweisungen anbetrifft, so war es das erkennbare Anliegen der kirchlichen Seite, den Staat bei seinen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie durch ein „Herunterfahren“ des öffentlichen Lebens zu unterstützen und die staatlicherseits verfügten Versammlungsverbote bzw. Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen nachzuvollziehen und gleichsam in kirchliches Recht zu transformieren.
Hinsichtlich der Methodik ist bemerkenswert, dass in den verschiedenen in den Blick genommenen Bistümern unterschiedliche Vorgehensweisen gewählt wurden. Neben der förmlichen Partikulargesetzgebung durch (erz‑)bischöfliches Dekret – im Fall des Erzbistums München und Freising mit der alle Zweifel ausräumenden Klarstellung, dass es sich um ein Allgemeines Dekret im Sinne des c. 29 CIC („Allgemeine Dekrete […] sind im eigentlichen Sinn Gesetze […]“) handelt, auf dessen Inkrafttreten die Regelung des c. 8 § 2 CIC anwendbar ist – hat es eine nicht geringe Zahl anderer Bistümer vorgezogen, die Behandlung dieser Thematik den Generalvikaren (bzw. im Falle des vakanten Bistums Augsburg dem Ständigen Vertreter des Apostolischen Administrators) zu überlassen, wobei diese – nicht zuletzt mangels eigener Gesetzgebungskompetenz, vgl. dazu c. 135 § 2 CIC – auf das Instrument der Dienstanweisung bzw. pastoral gehaltener Informationsschreiben zurückgegriffen haben.
Nachdem sich jedenfalls für das Bundesland Bayern eine Verlängerung des „Lockdown“ über den 19.04.2020 hinaus abzeichnete, war die neu geschaffene innerkirchliche Rechtslage entsprechend fortzuschreiben. So hat beispielsweise der Kardinalerzbischof von München und Freising die mit den Dekreten vom 13.03./02.04.2020 geschaffene Rechtslage durch ein im Übrigen inhaltlich unverändertes weiteres Dekret vom 20.04.2020 bis zum 03.05.2020 verlängert.
Ebenso hat der Bischof von Würzburg ein weiteres Dekret vom 17.04.2020 erlassen, das am 20.04.2020 in Kraft trat und „bis auf weiteres“ gelten sollte. Auch dieses Dekret schrieb die Regelungen vom 16.03.2020 im Wesentlichen fort, erweiterte aber in § 1 Abs. 2 den Kreis derer, die an nichtöffentlichen Eucharistiefeiern teilnehmen dürfen: „Die private Zelebration der Priester, ggf. mit einem Diakon, einem Altardiener / einer Altardienerin, einem Lektor / einer Lektorin, einem Kantor / einer Kantorin und einem Organisten / einer Organistin, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ist erlaubt […].“ Wie dem Verfasser dieses Beitrags aus eigener Anschauung – etwa der Liturgie der Osternacht, wie sie für das gläubige Volk in einem lokalen Fernsehsender übertragen wurde – bekannt ist, entsprach eine derartige Besetzung des liturgischen Dienstes zu diesem Zeitpunkt der bereits vom Bischof selbst erprobten Praxis… Was also konnte es schaden, eine gute eigene Praxis zum allgemeinen Partikulargesetz für das Bistum zu machen? Ius sequitur vitam.
Nachdem seit etwa Mitte April d. J. der Ruf nach einer (beschränkten) Wiederzulassung öffentlicher Gottesdienste zunehmend lauter wurde (vgl. statt anderer die Überlegungen aus dem Bereich der Deutschen Bischofskonferenz), hat auch die bayerische Staatsregierung eine Lockerung der bisherigen Verbote unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen ab dem 04.05.2020 in Aussicht gestellt. Nachdem bereits die Deutsche Bischofskonferenz am 24.04.2020 ein Arbeitspapier mit Empfehlungen zur Feier der Liturgie in Zeiten der Corona-Krise veröffentlicht hatte, haben auch die bayerischen (Erz‑)Diözesen in Abstimmung mit der bayerischen Staatsregierung ein Schutzkonzept erstellt (vgl. die Veröffentlichungen im Internet hier und hier). Auf dieser Geschäftsgrundlage haben sich seit Ende April weitere gesetzgeberische Aktivitäten der bayerischen (Erz-)Bischöfe ergeben, welche die liturgischen Feiern in den jeweiligen (Erz‑)Bistümern ab dem 04.05.2020 betreffen.
Im Bistum Augsburg hat der Ständige Vertreter des Apostolischen Administrators Diözesane Ausführungsbestimmungen / Erläuterungen zum Schutzkonzept der bayerischen (Erz-)Diözesen vom 29.04.2020 erlassen.
Im Bistum Eichstätt hat der Generalvikar per Rundschreiben vom 29.04.2020 an die Priester, Diakone und pastoralen Mitarbeiter*innen in einem ersten Teil des Schreibens über das gemeinsame Schutzkonzept der bayerischen (Erz-)Diözesen sowie im zweiten Teil des Schreibens über besondere Hinweise für die Diözese Eichstätt informiert. Zur genauen Befolgung der besagten Regelungen wurde eindringlich aufgefordert.
Für das Erzbistum München und Freising erging ein Allgemeines Dekret vom 29.04.2020, welches am 04.05.2020 in Kraft tritt. Gemäß Ziff. 1 des Dekrets können ab dem 04.05.2020 öffentliche Gottesdienste nach Maßgabe des Infektionsschutzkonzepts des Erzbistums sowie der „erläuternden weiteren Vorgaben und Weisungen von Generalvikar und Amtschefin“ stattfinden. Die Befolgung des c. 912 CIC (Anspruch der Gläubigen auf Kommunionempfang) und des c. 1221 CIC (freier und kostenloser Zugang zu Kirchenräumen während dortiger Gottesdienste) wird in das Ermessen der Zelebranten gestellt. Gemäß Ziff. 3 des Dekrets wird allen Priestern im Erzbistum die Bination an Werktagen sowie die Trination an Sonn- und gebotenen Feiertagen gestattet (vgl. dazu auch c. 905 § 2 CIC). Ziff. 6 des Dekrets befasst sich mit der Spendung der Hauskommunion und der Krankensalbung. Die Regelung endet mit dem Satz: „Bei COVID-19 Erkrankten ist die Sakramentenspendung durch eigens dafür geschulte und ausgerüstete Priester und Diakone zu gewährleisten.“ Wüsste man es nicht besser – vgl. erneut c. 135 § 2 CIC, jetzt i.V.m. c. 1003 § 1 CIC –, so könnte man glauben, der partikulare Gesetzgeber schaffte mit dieser Norm die Rechtsgrundlage für die Spendung des Sakraments der Krankensalbung durch Diakone. Tatsächlich ist Ziff. 6 des Dekrets an dieser Stelle aber wohl nur (zu) knapp und daher missverständlich formuliert, so dass die Bestimmung kodexkonform ausgelegt werden kann und muss.
Im Bistum Passau wurden Anweisungen zur Feier öffentlicher Gottesdienste ab 04.05.2020 veröffentlicht. Die Anweisungen sind ungeachtet der förmlichen Überschrift doch eher in Form eines Rundschreibens an die lieben Mitbrüder im priesterlichen und diakonalen Dienst sowie an die lieben Mitarbeiter*innen in Pastoral und Verwaltung formuliert. Der Verfasser bleibt indes – jedenfalls in der im Internet einsehbaren Version – anonym.
Das Bistum Regensburg hat auf der Grundlage des gemeinsamen Schutzkonzepts Diözesane Anweisungen für die Liturgie ab dem 4. Mai 2020 in der Diözese Regensburg zur Einhaltung der staatlichen Infektionsvorschriften erstellt, die am 29.04.2020 vom Generalvikar erteilt wurden. Zugleich wurde bereits ein konkretes Schutzkonzept für den Regensburger Dom erarbeitet; demnach können nach vorheriger Anmeldung per Telefon oder E-Mail maximal 120 Gläubige künftig die dortigen Messen mitfeiern.
Für das Bistum Würzburg hat der Bischof das Dekret vom 28.04.2020 betreffend öffentlicher Gottesdienste unter strengen Auflagen erlassen. Dieses schreibt zum Teil die bisherigen Dekrete vom 16.03. bzw. 17.04.2020 fort und gilt wiederum „bis auf weiteres“. Entscheidend neu ist § 1 Abs. 1: „Öffentliche Gottesdienste dürfen ausschließlich unter Einhaltung der in Anlage 1 genannten Sicherheitsmaßnahmen gefeiert werden. Die Anlage 1 wird gegebenenfalls fortgeschrieben.“ Die Anlage 1, auf die mithin wohl in dynamischer Weise (= es gilt die jeweils aktuelle Fassung der Anlage 1) verwiesen wird, erläutert die Rahmenbedingungen und [den] mögliche[n] Ablauf öffentlicher Gottesdienste mit beschränkter Teilnehmerzahl ab dem 4. Mai 2020 in der Diözese Würzburg. Dieses Dokument ist in 15 Punkte (z.T. mit weiteren Unterpunkten) gegliedert. Dabei wird in Ziff. 6–10 u. 12–13 der Inhalt der Ziff. 1–5 (ohne 5.1–5.2) u. 6–7 des gemeinsamen Schutzkonzepts der bayerischen (Erz-)Diözesen weitgehend wörtlich, im Übrigen zumindest sinngemäß wiedergegeben. Eine beachtliche Besonderheit besteht allerdings darin, dass gem. Ziff. 3 der Rahmenbedingungen für das Bistum Würzburg nur „eine gestufte Wiederzulassung öffentlicher Gottesdienste“ vorgesehen ist: „Zunächst sind nur nichteucharistische Gottesdienstformen erlaubt.“ Dies wird in Ziff. 4 der Rahmenbedingungen damit begründet, dass es fraglich sei, ob angesichts der zu beachtenden Vorgaben des Schutzkonzepts „die Feiergestalt der gottesdienstlichen Vollzüge in ihrem Sinn erhalten bleibt oder geradezu konterkariert wird“.
„Aller Anfang ist schwer“; und „Ende gut, alles gut“, sagt der Volksmund. So bleibt am Schluss dieser Betrachtungen die Hoffnung, dass den im Rahmen des c. 838 § 4 CIC vorgenommenen bischöflichen Normsetzungen der letzten Tage und Wochen so bald wie gesundheitspolitisch möglich ein letztes Dekret folgen möge, dessen einziger Paragraph in etwa so lauten könnte: „Das Dekret vom 28.04.2020 wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben“.
* * *
Tatsächlich dauerte die vom Deutschen Bundestag festgestellte „epidemische Notlage von nationaler Tragweite“ bis zum 25.11.2021. Die bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung erlebte zwischen März 2020 und September 2022 nicht weniger als 17 Auflagen und wurde erst mit Wirkung vom 01.03.2023 aufgehoben. Bereits ab dem 03.04.2022 wichen für das Bistum Würzburg die einschlägigen Dekrete des Bischofs sowie die Verordnungen seines Generalvikars bloßen Empfehlungen. Für manche an Covid-19 erkrankte Menschen ist die Pandemie bis heute nicht vorbei.
* * *
„O du eselhafter Peierl“ / „O du eselhafter Martin“
(KV 559a / KV 560, W. A. Mozart, vierstimmiger Kanon in F-Dur / G-Dur)
von Katharina Leniger
Es fällt schwer, angesichts der aktuellen Weltlage, die sich in den vergangenen Tagen und Wochen so unfassbar schnell zugespitzt hat, einen dem Tag angemessenen, zum Schmunzeln bringenden Text in der Reihe „Kanon des Monats“ zu verfassen. Gründe, dies zu unterlassen, gibt es sicher viele: Pietätlosigkeit, die viel existentiellere Lektüre wichtiger Nachrichten oder die Unlust, sich in die Reihen der quantitativ exorbitant gestiegenen Mitteilungslustigen in den Weiten des Internets einzureihen. Ich möchte hier nur kurz an Home-Office-Podcasts von Künstler*innen und „Freude schöner Götterfunken“ spielende Musiker*innen auf deutschen Balkonen erinnern, ganz zu schweigen von solo-selbständig anmutenden Priestern, die in ihrem Herrgottswinkel Messen unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor ihrem Stativ zelebrieren und von jenen, die darüber wild twittern. Und wo wir gleich von Kanons sprechen werden: Wie wäre es angesichts des Kontaktverbotes mit „Wo zwei oder zwei in meinem Namen versammelt sind“? Nichts läge mir dabei ferner als eine Wertung dieser kreativen Versuche, der Corontäne zum Trotz irgendwie weiter zu machen, ihr gegebenenfalls sogar etwas Positives abgewinnen zu können.
Das Fazit dieses Absatzes werden Sie sich denken können: Den Unkenrufen zum Trotz werde ich diesen kleinen Aprilscherz trotzdem wagen. Hier ist also der zweite humoristische Beitrag aus der Reihe „Kanon des Monats“. Und wieder geht es um Mozart: In Serien würde man von einem „Spin-Off“ sprechen, der eine mögliche Nachgeschichte zum April-Kanon des vergangenen Jahres „Difficile lectu mihi Mars“ (KV 559) erzählt. Dabei handelt es sich allerdings nicht nur um eine weitere Facette des obszönen Witzes und der musikalischen Finesse des Wolfgang Amadeus Mozart, sondern möglicherweise um die Geschichte, die erst die ganze humoristische Tiefe der Aufführungsereignisse des „Difficile“-Kanons auslotet und zum Vorschein bringt.
Aber beginnen wir dort, wo meine Ausführungen im vergangenen Jahr endeten, bei den Scherzen des W. A. Mozart und seiner Neigung, Regeln zu missachten oder zumindest bis ins kleinste Detail auszureizen, nicht selten mit dem Effekt, seine Freunde oder Bekannten gehörig auf den Arm zu nehmen. Glaubt man den Erzählungen von Gottfried Weber, so diente der pseudolateinische Kanon „Difficile“, der oben zitiert und in seiner textlichen Gestalt im vergangenen Jahr besprochen wurde, dazu, den berühmten Tenor Johann Nepomuk Peierl in ein derb-komisches Licht zu rücken. Jener „Kegel- und Trinkfreund“ (Wikipedias Mozart-Artikel sei hier zitiert) Peierl weilte zwischen 1786 und 1787 wohl in Wien und war dort Mozarts Schalk heillos ausgeliefert. Zum Mozart‘schen Plan: Der beliebte Bariton mit dem keinesfalls zu überhörenden bayerischen Dialekt sollte den Kanon „Difficile“ vortragen in der Annahme, das zu interpretierende Werk wäre an Ernsthaftigkeit und Kunstfertigkeit nicht zu übertreffen. Anhand des lateinischen Textes sollte der unanständige Inhalt des Liedes vom Interpreten unentdeckt bleiben in dem Kalkül, dass im Moment der Aufführung der Dialekt Peierls den gewünschten Effekt beim Publikum erzielen möge. Mit dem Ende seines Vortrags sollte anschließend die zuhörende Gesellschaft ihrerseits mit einem Kanon antworten, „O du eselhafter Peierl!“ in F-Dur, der nicht ohne Grund bis heute die Verzeichnisnummer KV 559a trägt (über die Fragen der Nummerierung wäre ein eigener Artikel zu schreiben).
„O du eselhafter Peierl!
o du peierlhafter Esel!
du bist so faul als wie ein Gaul,
der weder Kopf noch Haxen hat.
Mit dir ist gar nichts anzufangen;
ich seh dich noch am Galgen hangen.
Du dummer Gaul, du bist so faul,
du dummer Peierl bist so faul als wie ein Gaul.
O lieber Freund, ich bitte dich,
o leck mich doch geschwind im Arsch!
Ach, lieber Freund, verzeihe mir,
den Arsch, den Arsch petschier ich dir
Peierl! Nepomuk! Peierl! verzeihe mir!“
Es fällt jedoch auch auf, dass die Geschichte in mancherlei Hinsicht doch eher konstruiert wirkt: Denn zu fragen bleibt doch, warum ein einzelner Mann einen Kanon vorsingen sollte. Noch dazu wäre zu erklären, warum ein äußerst gebildeter und kluger Mensch, der Peierl gewesen sein musste, diese einfache lateinische Nonsense-Konstruktion nicht durchschaut hatte. Aber selbst wenn die Begebenheit so nie stattgefunden haben sollte, müsste in Zeiten der Corontäne ja möglich sein, sich diese in den buntesten Farben und Facetten vorzustellen (einschließlich der Wehmut, überhaupt irgendwann selbst wieder einmal einen Kanon mit anderen Menschen singen zu können).
Damit jedoch nicht genug: Später erhielt der Kanon eine leicht veränderte Gestalt sowie einen Tonartwechsel. Die nun als KV 560 geführte, revidierte Version in G-Dur trägt den Titel „O du eselhafter Martin“, ist jedoch in zweierlei Formen überliefert (im Text in eckigen Klammern dargestellt, abweichende Textzeilen und Schreibweisen sind der langen und nicht mehr klar nachzuvollziehenden Überlieferungstradition geschuldet).
O du eselhafter [Jakob|Martin]!
o du [jakobischer|martinischer] Esel!
du bist so faul als wie ein Gaul,
der weder Kopf noch Haxen hat.
Mit dir ist gar nichts anzufangen;
ich seh dich noch am Galgen hangen.
Du dummer Paul, halt du nurs Maul,
Ich scheiß dir aufs Maul, so hoff' ich wirst doch erwachen.
O lieber Lipperl, ich bitte dich recht schön,
o leck mich doch geschwind im Arsch!
O, lieber Freund, verzeihe mir,
den Arsch, den Arsch petschier ich dir.
Lipperl! [Jakob|Martin]! Lipperl! verzeihe mir!
Hatte Mozart gleich zwei weitere Bekannte, einen Jakob und einen Martin mit Nachnamen Lipperl, auf’s Korn genommen? Man wird dies nicht gänzlich herausfinden können. Möglich wäre, dass es sich bei dem besungenen Martin um den Komponisten Vicente Martín y Soler handelt, der zur selben Zeit in Wien äußerst erfolgreich mit seinen komischen Opern war und damit in gewisser Konkurrenz zu Mozart selbst stand. Wahrscheinlicher könnte allerdings sein – so auch die Hypothese des Mozartschülers Alfred Einstein – dass der Besungene der Freund und Kollege Philip Jakob Martin war und somit beide Namensversionen ihm zuzuordnen sind (umso mehr, weil Lipperl als gängiges Diminutiv von Philipp gebildet wird). Mozart und Ph. J. Martin hatten gemeinsam viele der berühmt gewordenen Wiener Augartenkonzerte durchgeführt, die Martin als Organisator leitete. Auch in der „Alten Mehlgrube“, einer Art bürgerlichem Casino, veranstaltete Martin wöchentlich so genannte „Dilettantenkonzerte“, u.a. in Zusammenarbeit mit Mozart. Zur Ehrenrettung Mozarts ist zu sagen, dass es sich bei dem kleinen musikalischen Scherz sowohl bei Peierl als auch bei Martin vermutlich eher um ein freundschaftliches Necken denn um eine tiefgründige Denunziation gehandelt haben muss. Dies könnte man aus dem Umstand herauslesen, dass Martin wohl der Taufpate des erstgeborenen Sohnes von Mozart wurde – wenn auch nur infolge der Abwesenheit desjenigen, der für diesen Dienst eigentlich vorgesehen war.
Wird man doch über die textliche Gestalt des Kanons zumindest kurz die Stirn runzeln, zeigt sich in musikalischer Hinsicht die große Kunstfertigkeit des Wolfgang Amadeus Mozart. (Empfohlen sei an dieser Stelle die parallele Ansicht und ein Hörbeispiel, die die folgende kleine analytische Näherung vielleicht zu visualisieren und in Tonsprache zu übersetzen vermag: „Mozart - O du eselhafter Peierl - Chorus Viennensis“). Wie für einen Kanon üblich, wird der gesamte Melodieverlauf in vier Abschnitten oder Stimmen zunächst einstimmig vorgetragen. Auffallend sind die melodisch und rhythmisch parallel verlaufende erste und zweite Zeile, sowohl im zunächst punktierten „O“ und den repetitiv wirkenden „du e-sel-haf-ter“ oder „du mar-ti-ni-scher“ auf demselben Ton. Daran schließen sich jeweils zwei abfallenden Terzen an, die die Worte „Mar-tin“ und „E-sel“ auskleiden. Fast würde einem geneigten Zuhörenden hier langweilig werden – zweimal die gleiche Anlage führt schnell zu Ermüdung. Daraufhin jedoch verdoppelt sich das Tempo in der Relation zwischen Text und Melodie, in aufsteigenden Quarten schießt das „so faul“ und „wie ein Gaul“ hervor, bevor der erste der vier Teile mit gleichbleibenden kadenzierenden Vierteln abschließt. Der nächste Abschnitt beginnt nun auftaktig, jedoch auch die Gestalt des ersten Teils mit den abfallenden Terzen aufgreifend. Durch diese Verschiebung um einen halben Takt wird im später zusammengesetzten Kanon spielend leicht ein Echoeffekt erzeugt, der die drei Achtel „du bist so“ und „du dummer“ direkt aufeinander folgen lässt und die Spitzentöne auf „faul“ und „Gaul“ einander „zugesungen“ werden können. Sicher ist auch kein Zufall, dass in Oktavsprüngen auf eine gehaltene halbe Note gerade die Textstelle „O leck“ wiederholt wird und fast penetrant durch die anderen Stimmen herauszuhören ist. Im vierten Abschnitt bilden die Ausrufe des Namens jeweils Quint- und Sextsprünge, die wiederum durch Pausen zuvor und danach deutlich hörbar bleiben. Musikalisch wurde der Kanon also so angelegt, dass vor allem die verschiedenen Namen, die Beschreibungen als „Gaul“ und „faul“ sowie die Aufforderung „leck“ zu hören sind. Mozart wusste um die Wirkung der Obszönitäten und kannte alle Tricks, diese ins rechte Licht oder die beste Akustik zu setzen, um sein Publikum mit einem genialen Überraschungseffekt zum Lachen zu bringen.
Und auch in diesem Jahr kann man fragen: Was bleibt nun nach diesem neuerlichen Ausflug in die Musikwissenschaft zu einem weiteren schamlosen Kleinwerk Mozarts? Zunächst kann man sich gegebenenfalls der Erkenntnis nicht entziehen, dass Mozart ein kleines ordinäres Genie war, wobei sich die geringe Größe auf sein kindliches Temperament in Bezug auf musikalische Scherze dieser Art beziehen soll. Dass jedoch der mozart’sche Kanon auch andere Stimmungen aufgreifen kann, zeigt sich eindrucksvoll und in seiner Tragik diese Kindlichkeit geradezu kontrastierend im Kyrie des berühmten Requiems in d-Moll KV 626. In der aktuellen Weltlage und zur Fastenzeit wäre eine ernsthafte Besprechung dieses Kanons sicher angemessener gewesen. Trotzdem, davon bin ich überzeugt, kann gerade ein Kanon, der ursprünglich in geselliger, bürgerlicher Runde seine Bestimmung fand, den Menschen auch – oder gerade – heute Erbauung und ein Grund zum Schmunzeln sein. Mozart hätte mit Sicherheit seine Freude daran gehabt, diesen Kanon auch ein weiteres Mal umzudichten, denn auch heute hätte es ihm an Namen sicher nicht gemangelt: COVID-19, Corona-Virus, SARS-CoV-2. Welch Freude, wenn – hoffentlich bald – große Gesellschaften mit hunderten Menschen im Real Life gemeinsam im Kanon singen, ob nun diesen oder einen ganz anderen. Bis es soweit ist, begnügen wir uns mit Sangesbrücken zwischen Balkonen und dem nie endenden Quell der weltweiten digitalen Vernetzung.
c. 989 CIC
„Omnis fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, obligatione tenetur peccata sua gravia, saltem semel in anno, fideliter confitendi.“
„Jeder Gläubige ist nach Erreichen des Unterscheidungsalters verpflichtet, seine schweren Sünden wenigstens einmal im Jahr aufrichtig zu bekennen.“
von Anna Krähe
Der vorliegende Beitrag ist Teil einer Reihe im Rahmen von „Kanon des Monats“, in der in loser Reihenfolge jedes der sogenannten fünf Kirchengebote (vgl. KKK 2041–2043) aus kanonistischer Perspektive betrachtet und bezüglich seiner Verortung und Funktion im geltenden Recht untersucht wird. Bisherige Teile: Teil 1 (c. 1251 CIC; Fasten- und Abstinenzgebot); Teil 2 (c. 920 CIC; Osterkommunion); Teil 3 (c. 1247 CIC; Sonntagspflicht); Teil 4 (c. 222 § 1 CIC; Beitragspflicht).
Wieder einmal Quadragesima und damit Zeit für allerlei Vorsätze, Verzichtserklärungen, neue spirituelle Anstöße und Vorhaben. Im letzten Jahr konnten Sie Ihre Fastenpläne an dieser Stelle mit Bezug auf c. 1251 CIC und das fünfte Kirchengebot ein- oder vielleicht sogar neu ordnen. Zwölf Monate später wird nun die sogenannte „Jahresbeichte“ den Reigen der kanonistischen Betrachtung der Kirchengebote beschließen und vielleicht Ihrer Vorbereitung auf das diesjährige Osterfest einen weiteren Impuls hinzufügen.
Die jährliche Beichtpflicht nach Erreichen des Unterscheidungsalters, welches der kirchliche Gesetzgeber mit der Rechtsvermutung des c. 97 § 2 CIC bei der Vollendung des 7. Lebensjahres ansetzt, geht auf c. 21 des IV. Laterankonzils (1215) zurück (vgl. DH 812) und betraf schon dort explizit Christgläubige beiderlei Geschlechts. Dies bekräftigen später auch das Konzil von Trient (vgl. Conc. Trid., Sess. XIV v. 25.11.1551, c. 8: DH 1708) sowie can. 906 CIC/1917. Der Festlegung auf das Unterscheidungsalter liegt die Vorstellung zugrunde, dass der bzw. die Gläubige die Fähigkeit besitzen muss, Gutes und Böses zu unterscheiden und somit überhaupt wissen- und willentlich schwere Sünden zu begehen. Er bzw. sie soll Fehlverhalten erkennen, dies vor Gott zur Sprache bringen sowie Reue empfinden können und umkehren wollen. Diese Fähigkeit ist zwar individuell verschieden, die Kodexväter entschieden sich aber für die Beibehaltung des Unterscheidungsalters als einerseits äußerlich, rechtlich fassbaren Zeitpunkt und andererseits innerlich, subjektive Voraussetzung (vgl. Comm 31 [1999], 276).
Mit der Verpflichtung zur Beichte aller schweren Sünden ist c. 989 CIC dem Konzil von Trient gefolgt, welches entgegen c. 21 des IV. Laterankonzils – dies hatte die Beichte aller Sünden gefordert (vgl. DH 812) – in c. 7 die Beichtverpflichtung auf die, an die Zehn Gebote anknüpfenden, Todsünden beschränkte, während die verzeihlichen (oder auch lässlichen) Sünden, wenn auch ihre Beichte empfohlen wurde, verschwiegen werden konnten (vgl. Conc. Trid., Sess. XIV vom 25.11.1551, c. 7: DH 1680. 1707). Folge der Begehung von Todsünden – ob öffentlich oder im Verborgenen – war für die Trienter Konzilsväter, gerade in Abgrenzung zu den Thesen der Reformation, der Verlust der Gnade Gottes und eine schwere Verwundung der Seele, die nur durch das vollständige Bekenntnis vor und die Bitte um Verzeihung von Gott im Sakrament der Buße wiederhergestellt und geheilt werden konnte. Auch wenn der CIC/1917 ebenso lediglich die verpflichtende Beichte von Todsünden forderte (vgl. cann. 901, 902 CIC/1917), sprach can. 906 CIC/1917 wiederum von einer Beichtverpflichtung bezüglich aller Sünden. Dies konkretisierte die Glaubenskongregation im Jahr 1972 insoweit, als dass wenigstens die Beichte schwerer Sünden verpflichtend sei (vgl. Glaubenskongregation, Pastorale Norm Sacramentum paenitentiae v. 16.06.1972; lat.: AAS 64 [1972], 510–514, hier 512 f. [Nr. VII]). Mit der Begründung, dass die Verpflichtung zur Beichte lässlicher Sünden kein Gegenstand des geltenden Rechts sein könne, übernahmen die Kodexväter diese Regelung (vgl. Comm 31 [1999], 276). Der Gesetzgeber selbst gibt jedoch keine Definition schwerer bzw. lässlicher Sünden; insoweit muss auf die Erkenntnisse der Moraltheologie und der theologischen Ethik zurückgegriffen werden. Nach kirchlicher Tradition liegt schweren Sünden ein bewusster und angestrebter, besonders schwerwiegender Gegenstand zugrunde, durch welchen der bzw. die Betreffende das im Menschen wohnende Prinzip der göttlichen Liebe angegriffen und sich so von Gott abgewendet hat; bei lässlichen Sünden ist die Beziehung zu Gott zwar auch geschädigt, bleibt aber bestehen (vgl. KKK 1855). Nur auf der Basis einer sorgfältigen Gewissenserforschung, eines persönlichen Bekenntnisses und in der Gesamtbetrachtung können das menschliche Verhalten und dessen Folgen erfasst werden, weswegen auch die Beichte lässlicher Sünden empfohlen wird (vgl. c. 988 § 2; DBK, Weisung zur Bußpraxis v. 24.11.1986, Nr. 5).
Auffällig ist, ähnlich wie bei der sogenannten „Osterkommunion“ in c. 920 CIC, dass der Gesetzgeber sich bezüglich der Verpflichtung wiederum lediglich auf die einmal jährliche Beichte beschränkt und somit die Minimalforderung des IV. Laterankonzils bewusst übernimmt (vgl. auch Comm 31 [1999], 275f.). Dies scheint sowohl mit c. 988 CIC als auch mit den Empfehlungen für Priesterseminaristen (cc. 240, 246 § 4 CIC), Kleriker (c. 276 § 2 Nr. 5 CIC) sowie Ordensleute und Mitglieder von Säkularinstituten (cc. 664, 719 § 3 CIC) zu kollidieren, welche zum möglichst häufigen Empfang des Bußsakraments angehalten sind. Auch der Ordo Paenitentiae betont in Nr. 7 b) der „Praenotanda“ (vgl. dt. Übersetzung) die Nützlichkeit der häufigen Beichte und erwähnt die Jahresbeichte lediglich implizit im Anhang III „Schema zur Gewissenserforschung“. – Dort lautet eine der an das Gewissen zu stellenden Fragen unter Nr. 3, II, 5: „Habe ich das Gebot der österlichen Beichte und Kommunion erfüllt?“ Diese Frage erscheint insofern bedenkenswert, als sich die Frage stellt, ob eine Nicht-Erfüllung dieses Gebots wiederum eine zu beichtende Sünde ist. – Darüber hinaus wird bereits im zweiten Kanon im Kapitel über das Bußsakrament des CCEO, can. 719, einerseits dessen baldiger Empfang nach Begehung einer schweren Sünde, sofern bewusst, sowie generell der häufige Empfang besonders zur Fasten- und Bußzeit empfohlen, jedoch keine Pflicht aufgestellt. Die jährliche Verpflichtung ist also nach Vorstellung des Gesetzgebers lediglich das „Beicht-Minimum“ eines christlichen Lebens. Allen Gläubigen, besonders den (angehenden) Klerikern und Ordensleuten unter ihnen, legt der Gesetzgeber aber häufiges Beichten nahe. Er verdeutlicht damit die Notwendigkeit und zugleich die Chance, eigenes Verhalten immer wieder zu hinterfragen, umzukehren, Versöhnung zu finden und so das eigene Christsein zu vertiefen und daraus zu leben. In c. 916 CIC sowie in can. 711 CCEO verbietet der Gesetzgeber, mit Ausnahme von schwerwiegenden Gründen, die Feier der Messe sowie den Kommunionempfang ohne vorherige Beichte bewusster, schwerer Sünden. Für die innigste Gemeinschaft mit Gott in der Feier und im Empfang der Eucharistie soll der bzw. die Gläubige vorbereitet sein, das Gewissen geprüft haben und mögliche Gräben zwischen ihm bzw. ihr und Gott durch die Beichte überwinden. So ist der Empfang des Bußsakraments zugleich eine Vorbereitung auf den Kommunionempfang und findet seine Fortsetzung darin (vgl. auch KKK 1389; c. 914 CIC bettet die Erstbeichte in die Erstkommunionvorbereitung ein). So ergibt sich das Gebot der Jahresbeichte aus der Vorgabe des einmal jährlichen Kommunionempfangs zur Osterzeit (vgl. c. 920 CIC; KKK 2042) und passt auch vor diesem Hintergrund in die 40tägige Fastenzeit. Zudem ist der Zeitraum eines Jahres für den bzw. die Gläubige wohl noch soweit überschaubar, dass das eigene Verhalten, mögliche Fehler und Sünden bedacht, hinterfragt und reflektiert werden können.
Das II. Vatikanischen Konzil hatte, unter Bezugnahme auf die urchristliche Bußpraxis, neben der individuellen Versöhnung des Pönitenten bzw. der Pönitentin mit Gott besonders deren sozialen und kirchlichen Charakter wieder in Erinnerung gerufen (vgl. insb. LG 11,2). Wenn auch die Konzilsväter hier wohl nicht spezifisch die sogenannten Kirchengebote im Blick hatten, kommt dabei doch etwas ihnen allen Gemeinsames in den Blick: Sie haben sowohl eine persönliche als auch eine gemeinschaftliche, ekklesiologische Dimension. Zum Abschluss dieser „Kirchengebote-Reihe“ soll damit noch einmal auf alle fünf Gebote, ihre Bedeutung und ihren rechtlichen Charakter geblickt werden. Dem Katechismus nach stehen die Kirchengebote „im Dienst eines sittlichen Lebens, das mit dem liturgischen Leben verbunden ist“ und sollen „das unerläßliche Minimum an Gebetsgeist und an sittlichem Streben, im Wachstum der Liebe zu Gott und zum Nächsten sichern“ (KKK 2041). Bereits im frühen Mittelalter bildeten sich für die Katechese hilfreiche Kurzformeln christlichen Lebens heraus, die allerdings je nach Region inhaltlich und in ihrer Anzahl Unterschiede aufwiesen. Die heute übliche Fünf-Zahl der Gebote prägte unter anderem Petrus Canisius in seinem 1555 erschienenen Katechismus, wobei dieser noch das Verbot zur Heirat zu verbotenen Zeiten als 5. Gebot kannte (vgl. S. 31f.). Ignatius v. Loyola nannte die praecepta oder mandata Ecclesiae bei den Themen zur Unterweisung einfacher Leute in religiösem Leben (vgl. Alfred Feder S.J. (Ed.), Ignatius von Loyola. Geistlichen Übungen, 2. Aufl., Regensburg 1922, 18. Bemerkung, 28). Von ihrem Ursprung her dienen die Kirchengebote, als religiöse Lebensregeln mit disziplinierendem und verbindlichem Charakter, der Erziehung und Einübung christlicher Praxis; ähnlich den 613 Mizwot im Judentum oder den fünf Säulen des Islam (für einen kleinen Überblick s. hier und hier).
So bestimmen die Kirchengebote in kurzer Formel markante und prägende Vollzüge eines christlichen Lebens im Verlauf des Kirchenjahres (vgl. KKK 2042f.): Die Verpflichtung zur Teilnahme an der sonntäglichen Eucharistiefeier sowie zur Haltung der gebotenen Feiertage (vgl. KdM zu c. 1247 CIC, 09/2019) als 1. und 4. Gebot; die Minimalforderung der wenigstens einmal jährlichen (österlichen) Beichte im 2. sowie des wenigstens einmal jährlichen (österlichen) Kommunionempfangs im 3. Gebot (vgl. KdM zu c. 920 CIC, 06/2019); ebenso das 5. Gebot mit der Pflicht, Zeiten des Fastens und der Buße zu halten (vgl. KdM zu c. 1251 CIC, 03/2019). Die Beiträge der Gläubigen zur materiellen Unterstützung der Kirche (vgl. KdM zu c. 222 § 1 CIC, 12/2019) zählt der Katechismus nicht zur Fünfer-Reihe, aber dennoch zu den schweren Pflichten der Gläubigen.
Der Katechismus selbst verweist darauf, dass die Kirchengebote „von den Hirten der Kirche erlassen[e] positiv[e] Gesetze“ (KKK 2041) sind und gibt hierfür auch direkt die entsprechenden Kanones des geltenden Rechts an. In einem weiten Sinn sind natürlich alle kirchlichen Normen „Kirchengebote“; im engeren Sinn werden hierunter aber die genannten, aus der katechetischen Praxis über Jahrhunderte gewachsene Gebote kirchlichen Lebens und Handelns verstanden. Die rechtliche Qualität der Kirchengebote entstammt wohl teils ihrer Herausbildung als Gewohnheitsrecht. Ihr eigentlich katechetischer und moralischer Charakter kommt aber auch heute noch in der Art ihrer rechtlichen Normierung zur Geltung, denn der Gesetzgeber hat die Kirchengebote zumindest im universalkirchlichen Recht als iura imperfecta verfasst. Im Gegensatz zum ius perfectum oder auch strictum, dem vollkommenen oder strikten Recht, sind bei Verstößen gegen die Gesetze des unvollkommenen Rechts keine disziplinarischen oder strafrechtlichen Konsequenzen und keine Nichtigkeitssanktionen vorgesehen. Der Gesetzgeber stellt mit der Festlegung solcher Normen demnach zwar verbindliche und verpflichtende Gebote auf – es handelt sich daher nicht lediglich um Empfehlungen –, sanktioniert aber deren Nicht-Einhaltung in keiner Weise. Die Kirchengebote bleiben auch als Normen des geltenden Rechts strenge Gewissenspflichten und binden den bzw. die Gläubige als moralisch-religiöse Normen im forum internum; aber auch wenn ihre Einhaltung als Gesetze ebenso im forum externum gefordert ist, bedient sich die kirchliche Autorität keiner (Zwangs-)Maßnahmen zur Durchsetzung dieser Pflichten. Eine Ausnahme bildet hier, je nach Verständnis, die Umsetzung der Beitragspflicht in Form der Kirchensteuer in Deutschland in Verbindung mit den im Dekret der DBK zum Kirchenaustritt (2012) genannten Folgen (vgl. KdM 12/2019). Ihre rechtliche Normierung ist dennoch nicht zu vernachlässigen. Durch die positive Festlegung als Rechtsnormen gibt der Gesetzgeber auch den in den Kirchengeboten enthaltenden Werten und Gütern rechtliche Relevanz. Daraus folgt zunächst, dass der Gesetzgeber diese Rechtsgüter ebenfalls auszugestalten und zu schützen hat. Darüber hinaus muss den Gläubigen, um ihren Verpflichtungen nachzukommen, von Seiten der kirchlichen Autorität auch ein entsprechendes Angebot bereitgestellt werden; z.B. Sonntags- und Feiertagsgottesdienste, Möglichkeiten zum Kommunionempfang, Beichtgelegenheiten, konkrete Formen zur Erbringung materieller Leistungen, Angebote und ggf. Begleitung während der Fasten- und Bußzeiten. Es gelten darüber hinaus für die Kirchengebotsnormen des geltenden Rechts auch die allgemeinen rechtlichen Bedingungen bezüglich Alter, Adressatenkreis, Ort, Zeit usw. Ebenso ist in bestimmten Einzelfällen durch Dispens oder aufgrund von Epikie oder aequitas canonica eine Ausnahme von der Einhaltung der Gebote möglich. Schließlich sind die Kirchengebote auch eine rechtliche Konkretisierung der in c. 210 CIC allgemein formulierten Pflicht aller Gläubigen, ein heiliges Leben zu führen und damit zu Wachstum, Aufbau und Heiligung der Kirche beizutragen, womit sie nachdrücklich die tiefe persönliche, aber auch ekklesiologische Bedeutung eines lebendigen christlichen Lebens zum Ausdruck bringen.
In den rechtlich positiv gesetzten Kirchengeboten kommen fünf praktisch notwendige und pastoral wichtige Grundvollzüge kirchlichen Lebens zum Ausdruck und erfahren eine rechtliche Einrahmung. Sie verdeutlichen damit auch eine besondere Eigenart des kirchlichen Rechts, welches sich nicht in der Sicherung einer äußeren, friedlichen Ordnung erschöpft, sondern aus dem Selbstverständnis kirchlicher Gemeinschaft und dem gelebten Glauben ihrer Glieder heraus geformt wird und zugleich Gewissen, Glauben und Heilsweg der Gläubigen prägen und leiten möchte.
c. 352 §§ 1–2 CIC
„§ 1. Cardinalium Collegio praeest Decanus […]; Decanus […] nulla in ceteros Cardinales
gaudet potestate regiminis, sed ut primus inter pares habetur.
§ 2. Officio Decani vacante, Cardinales titulo Ecclesiae suburbicariae decorati, iiqui soli, praesidente Subdecano si adsit, aut antiquiore ex ipsis, e coetus sui gremio unum eligant qui Decanum Collegii agat; eius nomen ad Romanum Pontificem deferant, cui competit electum probare.“
„§ 1. Dem Kardinalskollegium steht der Dekan vor […]. Der Dekan […] hat gegenüber
den übrigen Kardinälen keinerlei Leitungsgewalt; vielmehr gilt er als Erster unter Gleichen.
§ 2. Ist das Amt des Dekans vakant, so wählen die Kardinäle, die den Titel einer suburbikarischen Kirche innehaben, und zwar diese allein, unter Vorsitz des Subdekans, wenn er anwesend ist, oder des Ältesten von ihnen aus ihrem Kreis einen aus, der als Dekan des Kollegiums walten soll; dessen Namen haben sie dem Papst zu übermitteln, dem die Bestätigung des Gewählten zusteht.“
von Martin Rehak
Das Kollegium der Kardinäle der Kirche Gottes, die in Rom „paroikiert“ (vgl. dazu die Grußformel des Ersten Clemensbriefes), hat einen neuen Dekan. Wie der Vatikanische Pressesaal am 25.01.2020 unter der Rubrik „Rinunce e nomine“ (Amtsverzichte und Ernennungen) verlautbarte, hat Papst Franziskus bereits am 18.01.2020 die Wahl von Kardinal Giovanni Battista Re zum Dekan des Kardinalskollegiums sowie am 24.01.2020 die Wahl von Kardinal Leonardo Sandri zum Vizedekan (Subdekan) bestätigt. Zuvor hatte Papst Franziskus, wie der Vatikanische Pressesaal in seinen Rinunce e nomine vom 21.12.2019 verlautbarte, den Verzicht des bisherigen Dekans, Kardinal Angelo Sodano, auf dieses Amt angenommen und ihm den Ehrentitel eines „emeritierten Dekans“ verliehen. Sodano hatte dieses Amt seit April 2005 innegehabt.
Das Kardinalskollegium ist historisch aus dem Klerus der Stadt Rom sowie den Bischöfen von sieben „suburbikarischen“, d.h. im Umland Roms unmittelbar benachbarten Bischofssitzen entstanden. Daher ist das Kardinalskollegium traditionell in drei Klassen (bischöfliche, priesterliche, diakonale Klasse) gegliedert. Noch heute erfolgt die Zuordnung des einzelnen Kardinals zu einer dieser drei Klassen in der Weise, dass ihm als Titel seines Kardinalats entweder ein suburbikarisches Bistum, oder eine Titelkirche in der Stadt Rom, oder eine dortige Titeldiakonie zugewiesen wird. Kardinal Re war 2001 von Papst Johannes Paul II. zum Kardinal kreiert worden und gehörte dem Kollegium zunächst in der priesterlichen Klasse an (Titelkirche: Santi XII Apostoli). Bereits 2002, nachdem durch den Tod von Kardinal Moreira Neves OP das suburbikarische Titelbistum Sabina-Poggio Mirteto frei geworden war, wurde er unter Verleihung dieses Titels vom Papst in die bischöfliche Klasse befördert.
Gemäß c. 352 § 2 CIC wird der Dekan von jenen Kardinälen der bischöflichen Klasse, die den Titel einer suburbikarischen Kirche innehaben, gewählt – wobei eigens betont wird, dass exakt nur diese Kardinäle den neuen Dekan wählen. Damit wollte der Gesetzgeber offensichtlich eine zweifache Abgrenzung vornehmen: Zum einen zu den Kardinälen der diakonalen und priesterlichen Klasse, die nach geltendem Recht grundsätzlich nicht an der Dekanswahl beteiligt werden; aber auch zu jenen Kardinälen, die zugleich Amt und Titel eines Patriarchen einer katholischen Ostkirche innehaben (derzeit also Antonios Naguib, der emeritierte Patriarch der koptisch-katholischen Kirche; Béchara Boutros Raï, der in Bkerke, Libanon, residierende Patriarch der Maroniten; und Louis Raphaёl I. Sako, der in Bagdad, Irak, residierende Patriarch der chaldäisch-katholischen Kirche). Gemäß c. 350 § 1 CIC gehören diese Orientalen zwar dem Kardinalskollegium in der bischöflichen Klasse an; ihr Titel als Kardinal ist jedoch nicht etwa ein suburbikarisches Bistum, sondern gemäß c. 350 § 3 CIC ihr eigener Patriarchensitz (also bei den vorgenannten drei Orientalen Alexandria, Antiochia [am Orontes] und „Babylon“). Damit wird bei den Kardinälen, die zugleich Patriarch einer katholischen Ostkirche sind, von der Fiktion Abstand genommen, sie gehörten zum Klerus der stadtrömischen Kirche; weswegen sie konsequenterweise auch nicht als Kardinäle der heiligen römischen Kirche („S[anctae] R[omanae] E[cclesiae] Cardinales“), sondern als Kardinäle der heiligen katholischen Kirche angesprochen werden.
Indes hatte Papst Franziskus bereits im Juni 2018 gemäß einem Rescriptum ex Audientia Ss.mi vom 26.06.2018 den Kreis derer erweitert, die aktiv und passiv für das Amt des Dekans des Kardinalskollegiums wahlberechtigt sind, indem er die Eminenzen Pietro Parolin (Kardinalstaatssekretär), Leonardo Sandri (Kardinalpräfekt der Kongregation für die orientalischen Kirchen), Marc Ouellet PSS (Kardinalpräfekt der Kongregation für die Bischöfe) und Fernando Filoni (Kardinalpräfekt der Kongregation für die Evangelisierung der Völker, vormals: S.C. de Propaganda Fide) zu den Kardinälen der bischöflichen Klasse kooptiert hat und sie – die cc. 350 §§ 1–2, 352 §§ 2–3 CIC ausdrücklich außer Kraft setzend – in allem den Kardinälen der bischöflichen Klasse gleichgestellt hat.
Insgesamt waren somit bei den eingangs erwähnten Wahlen die Kardinäle Sodano (92 Jahre alt, Titelbistum Albano), José Saraiva Martins CMF (88 Jahre alt, Titelbistum Palestrina), Francis Arinze (87 Jahre alt, Titelbistum Velletri-Segni), Giovanni Battista Re (Titelbistum Sabina-Poggio Mirteto), Tarcisio Bertone SDB (85 Jahre alt, Titelbistum Frascati) sowie die kooptierten Parolin, Sandri, Ouellet PSS und Filoni wahlberechtigt. Das suburbikarische Bistum Porto-Santa Rufina dient derzeit keinem Kardinal als Titel. Das suburbikarische Bistum Ostia dient dem jeweils amtierenden Dekan des Kardinalskollegiums als Titel seiner Dekanswürde (vgl. c. 350 § 4 CIC).
Bezüglich der Amtszeit des Dekans des Kardinalskollegiums traf das kodikarische Kirchenrecht bislang keine Festlegungen. Die Wahl erfolgte somit grundsätzlich auf Lebenszeit, wobei dem Amtsinhaber ein vorzeitiger Amtsverzicht selbstverständlich frei stand.
Wie bereits in einem früheren Beitrag dieser Reihe (c. 694 n.F. [Mai 2019]) festgestellt wurde, ist Papst Franziskus ein eifriger Gesetzgeber. So hat er nun anlässlich des Amtsverzichts von Kardinal Sodano mit dem Motu Proprio Nel corso dei secoli vom 21.12.2019 die Amtszeit der Dekane des Kardinalskollegiums auf fünf Jahre begrenzt. Dies wurde damit begründet, dass mit der zunehmenden Gesamtzahl der Kardinäle auch die Arbeitsbelastung des Dekans des Kollegiums zugenommen habe. Diese fünfjährige Amtszeit bleibt „eventualmente rinnovabile“, d.h. eine erneute Wahl bzw. Bestätigung für weitere 5 Jahre ist statthaft.
Zu den Aufgaben eines Dekans des Kardinalkollegiums sede plena, d.h. solange es einen amtierenden Papst gibt, äußert sich das Kirchenrecht – soweit ersichtlich – nicht (oder jedenfalls nicht in für die Allgemeinheit veröffentlichten Ordnungen und Gesetzen). Dagegen kommen dem Kardinaldekan sede vacante, d.h. bei Sedisvakanz der Cathedra Petri, insbesondere jene Aufgaben zu, die sich aus dem geltenden Papstwahlrecht gemäß der Apostolischen Konstitution Universi dominici gregis [UDG] vom 22.02.1996 ergeben. Demgemäß
- leitet er die Generalkongregationen der Kardinäle im so genannten Vorkonklave (vgl. Nr. 9 UDG);
- nimmt er den übrigen Kardinälen das Versprechen und den Schwur ab, bei der Papstwahl die besagte Apostolische Konstitution genau zu beachten und alles, was sich auf die Wahl des neuen Papstes bezieht, geheim zu halten (vgl. Nr. 12 UDG);
- übernimmt er zusätzlich die Aufgaben des Camerlengo, falls dieses Amt während der Sedisvakanz ebenfalls unbesetzt sein sollte (vgl. Nr. 15 UDG);
- teilt er, sobald er selbst vom Camerlengo und vom Präfekten des Päpstlichen Hauses hierüber unterrichtet worden ist, allen Kardinälen den Tod des Papstes mit und beruft sie zum Vorkonklave sowie zum Konklave nach Rom ein (vgl. Nr. 19 UDG); zugleich unterrichtet er auch das beim Apostolischen Stuhl akkreditierte Diplomatische Korps sowie die Staatsoberhäupter der Entsendestaaten vom Tod des Papstes (vgl. ebd.);
- erwählt er sich für das Konklave einen Kleriker, der als sein Assistent fungiert (vgl. Nr. 46 UDG);
- nimmt er den im Konklave versammelten aktiv wahlberechtigten Kardinälen nochmals die eidliche Versicherung ab, die Papstwahl ordnungsgemäß durchzuführen (vgl. Nrn. 52–53 UDG);
- stellt er durch entsprechende Nachfrage fest, ob jeder Kardinal mit den Regularien der Papstwahl vertraut ist und also mit der Wahl des neuen Papstes begonnen werden kann (vgl. Nr. 54 UDG);
- erfragt er nach erfolgreicher Wahl, ob der Gewählte die Wahl annimmt und – falls diese Frage bejaht wird – welchen Papstnamen der Gewählte führen möchte (vgl. Nr. 87 UDG); sollte freilich der Kardinaldekan selbst der neu zum Papst Gewählte sein, so stellt diese Fragen nicht er sich selbst, sondern der nach ihm ranghöchste und älteste Kardinal im Konklave;
- spendet er – im außergewöhnlichen Fall, dass der Gewählte noch nicht zum Bischof geweiht ist – diesem noch im Konklave die Bischofsweihe (vgl. c. 355 § 1 CIC, Nrn. 88–90 UDG).
Sollte der neue Kardinaldekan Re, der zwischenzeitlich sein 86. Lebensjahr vollendet hat, beim Eintritt der nächsten Sedisvakanz noch im Amt sein, ergibt sich allerdings gegenüber dem vorstehend skizzierten Aufgabenprofil des Kardinaldekans folgende Besonderheit: Ein Kardinal, der bei Eintritt der Sedisvakanz das 80. Lebensjahr vollendet hat, ist bei der Papstwahl nicht mehr aktiv wahlberechtigt (vgl. Nr. 33 UDG). Die Papstwahlordnung sieht unmissverständlich vor, dass am Konklave nur die aktiv wahlberechtigten Kardinäle teilnehmen und diese während der eigentlichen Papstwahl exklusiv unter sich sind (vgl. Nrn. 50–54 UDG). Dies bedeutet, dass die Aufgaben, die das Papstwahlrecht während des Konklave an sich dem Kardinaldekan zuweist, in diesem Fall vom „ranghöchsten und ältesten (primus ordine et aetate)“ verbliebenen Kardinal wahrzunehmen sind (vgl. Nr. 52 UDG).
Wer aber ist der ranghöchste und älteste Kardinal? Was den Rang anbelangt, so ist damit ersichtlich auf die drei Klassen des Kardinalskollegiums abgestellt. An die Stelle des im Konklave nicht wahlberechtigten Kardinaldekans tritt also vorrangig ein Kardinal der bischöflichen Klasse; sollte von diesen keiner wahlberechtigt sein, ein Kardinal der priesterlichen Klasse. Was das Alter anbelangt, so ist die Frage zu entscheiden, ob hier auf das Lebensalter oder auf das Dienstalter abgestellt wird? Man wird diese Frage zugunsten des Dienstalters zu entscheiden haben. Für diese Lösung spricht zum einen, dass im Recht auch in anderen, ähnlichen Konstellationen auf das Dienstalter abgestellt wird (vgl. cc. 395 § 4; 415; 419; 421 § 2; 425 § 3; 501 § 3; 502 § 2 CIC; kurioser Weise soll dies nach wohl herrschender Meinung allerdings nicht auch für c. 1687 § 3 CIC gelten, weil dort mit „ältester Suffraganbischof“ der Bischof des der Gründung nach ältesten Suffraganbistums gemeint sei – zweifelhaft!). Entscheidend ist aber, dass die parallele Formulierung in c. 355 § 1 CIC sehr präzise vom „antiquior Cardinalis“ spricht, womit offensichtlich das Dienstalter und nicht das Lebensalter angesprochen ist.
Und damit lässt sich dann zur Abrundung dieser Untersuchung auch ganz leicht die Frage beantworten, wer derzeit „der Älteste“ im Sinne von c. 352 § 2 CIC ist: Angelo Sodano, Kardinal der bischöflichen Klasse seit 1994.
* * *
Zwischenzeitlich ist Kardinal Sodano am 27. Mai 2022 in Rom verstorben. Der derzeit älteste Kardinal der bischöflichen Klasse ist damit Kardinal Giovanni Battista Re, der zugleich das Amt des Kardinaldekans bekleidet. Der ranghöchste dienstälteste Kardinal, der weder Dekan noch Subdekan des Kollegiums ist, ist damit momentan Kardinal Francis Arinze, der 2005 als Titelbistum die suburbikarische Diözese Velletri–Segni erhalten hat.
* * *
Das Kartenspiel
(famously featured by Bruce Low)
Ich fand zur Vesperzeit in einem Dom mich wieder,
und setzte mich im Seitenschiff auf eine Holzbank nieder.
Schräg vor mir saß ein Mann, der spielte dort mit Karten!
„Sie müssen damit“, sprach ich, „bis nach der Messe warten!“
Der Fremde hob den Kopf und sah mir ins Gesicht:
„Verzeihen Sie, mein Herr, aber ich spiele nicht!
Kommt mit hinaus“, sagte er, indem er sich entfernt,
„ich zeig‘ Ihnen, was man von meinen Karten lernt.“
Und draußen im Portal, dort, wo es niemand stört,
hat mir der Fremde dann sein Kartenspiel erklärt.
„Mit jedem Ass“, sprach er, „soll ich erinnert werden:
Es gibt nur einen Schöpfer des Himmels und der Erden.
Die 2 sagt mir: Zwei Menschen gab’s im Paradies;
Adam und seine Frau, die welche Eva hieß.
Zieh ich die Karte 3, so heißt das für den Frommen:
Drei heil’ge Könige sind nach Bethlehem gekommen.
Vier Evangelisten, zu uns’res Herren Ruhm,
haben uns gebracht das Evangelium.
Fünf Kieselsteine suchte sich David aus im Bach,
dann legte mit der Schleuder den Goliath er flach.
In sechs Tagen schwerer Arbeit erschuf sich unser Herr
die Menschen, Tiere, Pflanzen, die Erde und das Meer.
Am siebten Tage ruhte der liebe Gott sich aus,
auf einer kleinen Bank vor seinem gold’nen Haus.
Acht Menschen, wohlgezählt acht nur, und zwar die Frommen,
sind bei der großen Sintflut damals nicht umgekommen:
Noah und die drei Söhne, das sind zusammen vier,
und jede ihrer Frau’n. Danach schloss sich die Tür.
Neun Aussätzige in Israel, bis auf den Tod erkrankt,
haben für ihre Heilung dem Herrn nicht mal gedankt!
Zehn Gebote Moses den Auserwählten gab,
als er vom Berge Sinai zum Volke stieg hinab.
Ich habe hier vier Buben, ich habe hier vier Damen,
ich habe hier vier Könige, das sind Zwölf zusammen.
Zwölf Stunden hat der Tag, zwölf Stunden jede Nacht,
zwölf Monate das Jahr: So wird die Zeit gemacht.
Herz, Karo, Pik und Treff, vier Farben in der Hand:
vier Jahreszeiten färben Wald, Wiese, Feld und Land.
Zweiundfünfzig Karten hab’ ich im ganzen Spiel;
nun zähl’ im Jahr die Wochen, es sind genauso viel.
Und zählen wir die Punkte, so sind es ohne Frage:
Dreihundertfünfundsechzig, soviel ein Jahr hat Tage.“ –
„Moment!“, sprach ich, nachdem ich Papier und Blei genommen,
„ich kann nur auf dreihundert und vierundsechzig kommen?!“
„Tja-ha-ha“, meinte da der Fremde mit einem stillen Lachen:
„Sie dürfen nie die Rechnung ohne den Joker machen!!!“
c. 202 § 1 CIC
„In iure, dies intellegitur spatium constans 24 horis continuo supputandis, et incipit a media nocte, nisi aliud expresse caveatur; hebdomada spatium 7 dierum; mensis spatium 30 et annus spatium 365 dierum, nisi mensis et annus dicantur sumendi prout sunt in calendario.“
„Im Recht versteht man: unter einem Tag einen Zeitraum, der aus 24 ununterbrochenen Stunden besteht und um Mitternacht beginnt, wenn nicht etwas anderes ausdrücklich vorgesehen ist; unter einer Woche einen Zeitraum von 7 Tagen; unter einem Monat einen Zeitraum von 30 Tagen und unter einem Jahr einen Zeitraum von 365 Tagen, wenn nicht gesagt wird, dass Monat und Jahr wie im Kalender zu berechnen sind.“
von Martin Rehak
Wie wird eigentlich im kodikarischen Kirchenrecht „die Zeit gemacht“? Eine grundlegende Auskunft bietet c. 202 § 1 CIC, der eine Legaldefinition der Begriffe bzw. Zeiträume „Tag“, „Woche“, „Monat“ und „Jahr“ beinhaltet. Die fundamentale Zeiteinheit ist dabei der „Tag“; über eine festgelegte Mehrzahl an Tagen werden sodann die übrigen Zeiteinheiten definiert.
Dabei bezeichnet „Tag“ im kodikarischen Recht grundsätzlich einen Zeitraum von 24 Stunden, der um Mitternacht beginnt und endet. Dieses kanonische Verständnis ist damit völlig verschieden vom Tag-Begriff des liturgischen Rechts, der (im Anschluss an jüdische Traditionen) vor allem Sonn- und Feiertage üblicherweise mit der Vesper am Vorabend beginnen lässt. Von diesem 24-Stunden-Tag im Sinne des c. 202 § 1 CIC ist in den cc. 905 nebst 919 § 2 und 951 § 1–2 CIC (mehrmalige Zelebration an einem Tag) sowie 917 nebst 921 § 2 CIC (mehrmaliger Kommunionempfang an einem Tag) die Rede. Das bedeutet praktisch, dass etwa eine Vorabendmesse im Falle von Bination oder Trination nicht auf die Höchstzahl der höchstens an einem Sonn- oder Feiertag erlaubten Eucharistiefeiern angerechnet wird; wohl aber etwa eine samstägliche Frühmesse und eine Vorabendmesse auf die Zahl der an einem Werktag höchstens erlaubten Zelebrationen eines Priesters.
Die mit „nisi“ bzw. „wenn nicht“ eingeleitete Schlussklausel des c. 202 § 1 CIC macht auf den Unterschied zwischen der gesetzlichen und der kalendarischen Bestimmung von Zeiträumen aufmerksam. Gesetzlich ist gemäß c. 202 § 1 CIC ein Monat immer 30 Tage und ein Jahr immer 365 Tage lang; kalendarisch hingegen schwankt die Zahl der Tage in einem Monat zwischen 28 und 31 Tagen, während in so genannten Schaltjahren das Jahr 366 Tage hat.
Unter dem Begriff des Kalenders ist dabei selbstverständlich der so genannte Gregorianische Kalender zu verstehen, mit dem Papst Gregor XIII. (1572–1585) im Jahre 1582 den bis dahin (jedenfalls in der christianisierten Welt) maßgeblichen Julianischen Kalender reformierte. Beide Kalender sind so genannte Sonnenkalender, deren Bezugsgröße die (durchschnittliche) Zeitspanne ist, welche die Erde für eine vollständige Umkreisung der Sonne benötigt; nämlich etwa 365 Tage, 5 Stunden und 49 Minuten, oder grob gerundet 365,25 Tage (365 d, 6 h). Damit ist die Erde also bildlich gesprochen rund 6 Stunden „langsamer“ als der Kalender. Um dies grob auszugleichen, hatte bereits der Julianische Kalender das Konzept der Schaltjahre vorgesehen, so dass alle vier Jahre das Kalenderjahr um einen Tag (4 x 6 = 24) verlängert und dadurch an die astronomischen Gegebenheiten angeglichen wird. Auf lange Sicht wurde dann jedoch die Differenz von etwa 11 Minuten ein Problem, mit der Folge, dass der Julianische Kalender sich ungefähr alle 130 Jahre um einen Tag „verspätet“. Der Gregorianische Kalender nimmt daher eine weniger grobe Anpassung des Kalenderjahrs an das astronomische Jahr vor, indem er alle 100 Jahre ein Schaltjahr ausfallen lässt, nicht jedoch alle 400 Jahre (d.h. die Jahre 1700, 1800 und 1900 waren keine Schaltjahre und hatten 365 Tage, die Jahre 1600 und 2000 waren Schaltjahre mit 366 Tagen). Im 16. Jh. betrug die Differenz beider Kalender bereits 10 Tage, so dass bei der Einführung des neuen Kalenders die katholische Christenheit am 04.10.1582 zu Bett ging und am 15.10.1582 vom Schlaf erwachte. In nichtkatholischen Ländern wurde dagegen der neue Kalender als päpstliches Machwerk nur zögerlich akzeptiert (in Preußen ab 1612; in der Schweiz und in den protestantischen deutschen Ländern ab 1700 oder später; in osteuropäischen Ländern erst in den Jahren 1915–1919). Gegenwärtig beträgt die Differenz beider Kalender mittlerweile 13 Tage, mit der Folge, dass jene Teile der Christenheit, deren liturgische Kalender nach wie vor auf dem Julianischen Kalender basieren, das Weihnachtfest immer entsprechend später feiern als beispielsweise die katholische Kirche, nämlich – soweit es Weihnachten im Jahre des Herrn 2019 anbelangt – erst am 7. Januar 2020 nach der Zählung des Gregorianischen Kalenders.
Was nun die gesetzliche Bestimmung der Zeit nach Tagen, Wochen, Monaten und Jahren gemäß c. 202 § 1 CIC anbelangt, so erfährt die dortige Regelung durch die Festlegungen des c. 202 § 2 i.V.m. c. 201 § 1 CIC eine praktisch sehr bedeutsame Rückausnahme. So oft nämlich der Gesetzgeber bei der Bestimmung von Zeiträumen und Fristen einen ununterbrochenen bzw. einen nicht unterbrechbaren Zeitraum („tempus continuum“, vgl. dazu c. 201 § 1 CIC) mit den Zeiteinheiten Monat oder Jahr beschreibt, wird dieser Zeitraum immer gemäß dem Kalender berechnet (vgl. dazu dann c. 203 § 2 CIC). Oder anders gesagt: „Kalendarisch gemessen bilden Monat und Jahr immer zusammenhängende Zeiten. Beim gesetzlichen Monats- und Jahresbegriff kann es sich hingegen auch um unterbrochene Fristen handeln“ (MKCIC–Socha, c. 202, Rz. 9).
Von daher beschränkt sich dieser Beitrag im Folgenden darauf, kursorisch jene Kanones in den Blick zu nehmen, in denen Zeiträume nach Tag(en) und Woche(n) bemessen werden.
Dabei fällt auf, dass der kodikarische Gesetzgeber für den Zeitraum der Woche relativ wenig Verwendung hatte (beliebter ist stattdessen eine Frist von 8 oder auch von 15 Tagen, siehe dazu sogleich): Gemäß c. 533 § 2 CIC muss ein Pfarrer Abwesenheiten von seiner Pfarrei, die sich auf mehr als eine Woche erstrecken, beim Ortsordinarius anmelden. Ziemlich vage formuliert c. 876 § 1 CIC die Verpflichtung katholischer Eltern, ihre Kinder „innerhalb der ersten Wochen“ taufen zu lassen. Ein kollegial besetztes Gericht, das sich in einer ersten Urteilssitzung mit dem Fällen des Urteils schwer tut, kann die Entscheidung auf eine zweite Urteilssitzung vertagen, welche jedoch (sofern nicht erneut in das Stadium der Beweisaufnahme eingetreten wird) gemäß c. 1609 § 5 CIC binnen Wochenfrist stattfinden muss.
Zahlreicher sind im Kodex die nach Tagen bemessenen Zeiträume. Zumeist geht es dabei um Fristen, innerhalb derer rechtserhebliche Handlungen vorzunehmen oder Erklärungen abzugeben sind. In etlichen Fällen wird diese Frist rechtlich weiter qualifiziert, beispielsweise als Nutzfrist (vgl. zum Begriff c. 201 § 2 CIC; zum Gebrauch cc. 159, 177 § 1, 179 § 1, 182 § 1, 1505, 1630 § 1, 1668 § 2, 1734 § 2 CIC) oder als Ausschlussfrist (vgl. cc. 1637 § 3, 1644 § 1, 1681 CIC).
Eine Frist von 3 Tagen sieht das kodikarische Recht in den cc. 166 § 2 (Wahlanfechtung), 1659 § 3 (Anordnung Klagezustellung nach gescheitertem Güteversuch) und 1661 § 2 (Schriftsatzfrist vor mündlicher Verhandlung) CIC vor. Bei Rechtsstreiten, die im mündlichen Verfahren verhandelt werden, soll zwar das Urteil unmittelbar nach dem Ende der mündlichen Verhandlung verkündet werden; jedoch erlaubt c. 1668 § 2 CIC, dies in bestimmten Fällen um bis zu 5 Tage zu verschieben. Auch die Mindestdauer der Weiheexerzitien beläuft sich gemäß c. 1039 auf 5 Tage.
Eine Frist von 8 Tagen wird in den cc. 159 (Bedenkzeit bei Präsentation), 177 § 1 (Wahlannahme), 179 § 1 (Bitte um Wahlbestätigung), 182 § 1 (Absendung einer Wahlbitte) und 421 § 1 (Wahl des Diözesanadministrators) CIC verfügt.
Die in den cc. 700 (Beschwerde gegen Entlassungsdekret), 1451 § 2 (Aufhebungsantrag gegen Prozesshandlungen eines abgelehnten Richters), 1505 § 4 (Beschwerde gegen Ablehnung einer Klageschrift), 1506 (Fiktion der Klageannahme bei Säumigkeit des Richters trotz Anmahnung), 1513 § 3 (Abänderungsantrag nach Streitfestlegung), 1734 § 2 (Widerspruch gegen Verwaltungsdekrete) und 1736 § 2 (Wartefrist vor Antrag auf Aussetzung des Vollzugs) CIC genannten Fristen betragen jeweils 10 Tage. Die Anmahnung gemäß c. 1506 CIC setzt bei weiterer Säumigkeit des Richters eine Frist von 20 Tagen zur Vorladung zwecks Streitfestlegung in Gang.
Auf einen Zeitraum von 15 Tagen stellen die cc. 649 § 1 (entsprechende Verlängerung des Noviziats bei Abwesenheit), 649 § 2 (vorzeitige Profess vor Ende des Noviziats), 697 Nr. 2 (Wartefrist zwischen erster und zweiter Verwarnung im Entlassungsprozess), 697 Nr. 3 (Wartefrist zwischen letzter Verwarnung und Entscheidungsvorlage), 1460 § 3 (Beschwerde gegen Erklärung der Unzuständigkeit), 1630 § 1 (Berufung), 1637 § 3 (Anschlussberufung), 1649 § 2 (Beschwerde gegen Kostenfestsetzung), 1659 § 1 (Klageerwiderung), 1668 § 3 (Bekanntgabe des vollständigen Urteils mit Urteilsbegründung), 1676 § 1 (Stellungnahme der nichtklagenden Partei zum Klageantrag in Ehesachen), 1686 (Animadversiones des Ehebandverteidigers im processus brevior), 1737 § 2 (Beschwerde = hierarchischer Rekurs gegen Widerspruchsentscheidung) und 1742 (Ultimatum für freiwilligen Amtsverzicht eines Pfarrers) CIC ab.
30 Tage, mithin also einen „gesetzlichen Monat“, laufen die Fristen aus cc. 1463 § 1 (Erhebung einer Widerklage), 1644 § 1 und 1681 (Berufungsbegründung in Personenstandssachen), 1661 § 1 bzw. 1685 (Durchführung der mündlichen Verhandlung im mündlichen Verfahren bzw. im processus brevior) und 1735 (Bedenkzeit für Widerspruchsentscheidung) CIC.
Hinsichtlich der Ehelichkeit von Kindern stellt c. 1138 § 2 CIC die (widerlegliche) Vermutung auf, dass jene Kinder ehelich sind, die mindestens 180 Tage nach dem Tag der Eheschließung und höchstens 300 Tage nach dem Tag der Auflösung der ehelichen Lebensgemeinschaft geboren werden.
Kleiner Fun-Fact am Rande: Im Leben der Kirche gibt es Jahre, die sich hinsichtlich ihrer zeitlichen Dauer weder an die gesetzliche Bestimmung gemäß c. 202 § 1 CIC, noch an die kalendarische gemäß c. 202 § 2 CIC halten. Zu denken wäre etwa an das (relativ lange) Jubeljahr der Erlösung, welches vom 25.03.1983 bis zum 22.04.1984 gefeiert wurde (vgl. dazu Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben Aperite portas Redemptori vom 06.01.1983, in: AAS 75 [1983] 89–106, hier 90); oder an das (relativ kurze) Jahr der Barmherzigkeit, welches am 08.12.2015 begann und am 20.11.2016 endete (vgl. dazu Franziskus, Bulle Misericordiae vultus vom 11.04.2015, in: AAS 107 [2015] 399–420, hier 400 u. 402).
Das gerade begonnene Jahr 2020 ist (als tempus continuum im Sinne des c. 201 § 1 CIC) kalendarisch zu bestimmen und dauert vom 01.01.2020, 0:00 Uhr, bis zum 31.12.2020, 24:00 Uhr. Da es sich um ein Schaltjahr im Sinne des Gregorianischen Kalenders handelt, umfasst es 366 Tage.
Für dieses Jahr 2020 wünscht das Team des Lehrstuhls für Kirchenrecht allen Leser*innen dieses Beitrags ein herzliches „Prosit Neujahr!“, alles Gute, und Gottes Segen.
* * *
Rätselfrage: Mit welchen Zahlenwerten hat der Fremde in seinem Deck die Spielkarten Bube, Dame, König und Ass codiert?
* * *
* * *
Lösung: Die Asse haben offensichtlich den Wert „1“. Die Zahlkarten (von „2“ bis „10“) ergeben in der Summe 216 Punkte. Folglich haben die zwölf verbleibenden Bildkarten in der Summe einen Wert von 144 Punkten. Der Fremde hat zwar prinzipiell unendlich viele Möglichkeiten, diesen zwölf Karten irgendwelche Zahlenwerte zuzuweisen, die in der Summe 144 ergeben. Aus der Logik des Kartenspiels heraus ist jedoch davon auszugehen, dass in Fortsetzung des in den Betrachtungen des Fremden angelegten, aufsteigenden Schemas nur natürliche Zahlen verwendet werden. Damit dürfte allein folgende Zuordnung zutreffend sein: Buben = „11“, Damen = „12“, Könige = „13“.
* * *
c. 222 § 1 CIC
„Christifideles obligatione tenentur necessitatibus subveniendi Ecclesiae, ut eidem praesto sint quae ad cultum divinum, ad opera apostolatus et caritatis atque ad honestam ministrorum sustentationem necessaria sunt.“
„Die Gläubigen sind verpflichtet, für die Erfordernisse der Kirche Beiträge zu leisten, damit ihr die Mittel zur Verfügung stehen, die für den Gottesdienst, die Werke des Apostolats und der Caritas sowie für einen angemessenen Unterhalt der in ihrem Dienst Stehenden notwendig sind.“
von Anna Krähe
Der vorliegende Beitrag ist Teil einer Reihe im Rahmen von „Kanon des Monats“, in der in loser Reihenfolge jedes der sogenannten fünf Kirchengebote (vgl. KKK 2041–2043) aus kanonistischer Perspektive betrachtet und bezüglich seiner Verortung und Funktion im geltenden Recht untersucht wird. Bisherige Teile: Teil 1 (c. 1251 CIC; Fasten- und Abstinenzgebot); Teil 2 (c. 920 CIC; Osterkommunion); Teil 3 (c. 1247 CIC; Sonntagspflicht).
„Die Kirche und das liebe Geld.“ – Vielleicht hätte sich der eine oder die andere Leser*in zum Abschluss des kalendarischen und zu Beginn des neuen Kirchenjahres ein erquicklicheres, erbaulicheres oder besinnlicheres Thema gewünscht. Andere mögen gerade den Dezember mit Überlegungen zu geeigneten Spendenprojekten verbringen oder resümieren schon in Erwartung seiner oder ihrer Lohnsteuerbescheinigung über Sinn und Unsinn der allmonatlichen Kirchensteuerzahlung. So oder so mag vielleicht gerade der Jahreswechsel eine Gelegenheit sein, sich einer ureigenen und in ihrer Ausgestaltung zugleich immer wieder diskutierten christlichen Pflicht besonders bewusst zu werden, welche der Katechismus der katholischen Kirche so formuliert: „Die Gläubigen sind auch verpflichtet, ihren Möglichkeiten entsprechend zu den materiellen Bedürfnissen der Kirche beizutragen“ (KKK 2043).
Dieser, in seiner Kurzform als „Beitragspflicht“ bezeichnete, Anspruch an die Gläubigen reiht sich in die fünf Kirchengebote (vgl. KKK 2041–2043). Er beschreibt eine wichtige Mindestanforderung an ein kirchliches Leben jedes und jeder einzelnen Gläubigen. Dass die apostolische Tätigkeit sich nicht gänzlich ohne materielle Unterstützung von Seiten der Gläubigen und Gemeinden entfalten kann, verdeutlichen die Berichte in Apg 4,32–37 und Apg 5,1–11 über die vielen freiwilligen Gaben für Apostel; bei Paulus wird die Forderung nach materieller Unterstützung, in der Aufforderung zur regelmäßigen Sammlung für die Heiligen (1 Kor 16,1–3) und in der Betonung der Notwendigkeit von Unterhalt und Versorgung der Apostel (1 Kor 9,7–14) noch nachdrücklicher. In den folgenden Jahrhunderten fand diese urchristlich begründete Notwendigkeit immer wieder Bestätigung und nachdrückliche Verdeutlichung in verschiedensten kirchlichen Verlautbarungen (vgl. u.a. Apostolische Kanones, c. 41, zitiert im Decretum Gratiani C. 12 q. 1 c. 22). Auch das II. Vatikanische Konzil hat in PO 20,1 auf Basis der biblischen Begründung diese vera obligatione eines bzw. einer jeden Christgläubigen herausgestellt und die notwendige materielle Unterstützung zur Verwirklichung des kirchlichen Auftrags an verschiedensten Stellen betont (vgl. AA 22,2; AG 36,3). Darüber hinaus ist auch aus naturrechtlicher Perspektive zu betonen, dass es der Eigenart menschlicher Gemeinschaften entspricht, dass jedes Mitglied, welches Vorteile aus der Gemeinschaft zieht, sich im Rahmen seiner Möglichkeiten auch an deren Lasten beteiligt.
Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass die Beitragspflicht, wie auch die anderen Kirchengebote, Eingang in das geltende kirchliche Recht gefunden hat. Dennoch zeigt sie in ihrer kirchenrechtlichen Umsetzung im CIC/1983 teilweise einige Unterschiede auf:
Während die in den anderen Kirchengeboten herausgehobenen christlichen Pflichten im Rahmen des Buches IV „Über den Heiligungsdienst der Kirche“ eingeordnet wurden, findet diese Verpflichtung der Gläubigen ihren ersten Ankerpunkt bereits in c. 222 § 1 CIC und somit in herausgehobener Stellung zu Beginn des Buches II „Über das Volk Gottes“ im Rahmen der (Grund-)Rechte und Pflichten aller Gläubigen. Die Beitragspflicht der Gläubigen korreliert mit dem im kirchlichen Vermögensrecht ausgeführten Recht der Kirche, das für ihre Zwecke Notwendige von den Gläubigen zu fordern, sodass die materielle Unterstützung von Seiten der Gläubigen nach c. 222 § 1 CIC i.V.m. c. 1260 CIC einen Teil des legitimen kirchlichen Vermögenserwerbs darstellt und die Selbstständigkeit kirchlicher Vermögensträger sicherstellen soll. Die Beitragspflicht stellt eine allen christifideles qua ihrer Taufe auferlegte Verpflichtung dar. Resultierend aus c. 11 CIC, sind die konkreten Adressaten hier all jene, welche in der katholischen Kirche getauft oder in diese aufgenommen wurden und das siebte Lebensjahr vollendet haben.
Die Pflicht zur Unterstützung soll der Kirche die notwendigen Mittel verschaffen, damit diese diejenigen Aufgaben verwirklichen kann, die ihrer Sendung und ihrem Auftrag entsprechen. In ähnlicher Weise wie der Einleitungskanon zum Buch V des CIC/1983 „Über die zeitlichen Güter der Kirche“ (Kirchenvermögen), c. 1254 § 2 CIC, sind diese Aufgaben nach c. 222 § 1 CIC: Gottesdienst, Werke des Apostolats, der Caritas sowie Sorge um einen angemessenen Unterhalt für die kirchlichen Bediensteten. Die Aufzählung dieser Zweckbestimmungen ist nicht abschließend, sondern hebt die propria kirchlichen Handelns und kirchlicher Aufgaben aufgrund der kirchlichen Sendung hervor und verdeutlicht damit die schon im II. Vatikanischen Konzil betonte Vorgabe, dass kirchliches Vermögen einer klaren Zweckbindung unterliegt (vgl. PO 17,3). Nur soweit und insofern die geistliche Zielsetzung der Kirche auch materieller Güter zu ihrer Verwirklichung bedarf, ist die Beitragspflicht demnach auch gerechtfertigt. Die genannten Zwecke stehen aber dabei lediglich pars pro toto für die ganze Sendung der Kirche. Im vermögensrechtlichen Sinn sind nach c. 1258 CIC unter Ecclesia nicht nur die Gesamt- sowie die Teilkirche(n) zu verstehen, sondern grundsätzlich alle öffentlichen juristischen Personen in der Kirche.
Die Gläubigen sind verpflichtet, diesen kirchlichen Sendungsauftrag zu fördern, wobei der Gesetzgeber mit subvenire (vgl. c. 222 § 1 CIC) einen offenen Begriff gewählt hat, der verschiedenste Formen von materieller Unterstützung, Hilfeleistung oder Beistand meinen kann und nicht zu eng gefasst werden darf; so können neben Geld- auch Naturalleistungen erbracht werden. Eine nähere Beantwortung der Frage, in welchen Formen diese Unterstützung geleistet werden soll, erfolgt in den auf c. 1260 CIC folgenden Normen innerhalb des kirchlichen Vermögensrechts. Neben den freiwilligen Zuwendungen (vgl. c. 1261 § 1 CIC), die durch Kollekte, Spenden, die Beteiligung an kirchlichen Sammlungen und finanzielle Gaben erbracht werden können, macht der Gesetzgeber in c. 1262 CIC erbetene Unterstützung (subventiones rogatae) zum Regelfall der kirchlichen Beitragserbringung. Da die Form der Beitragsleistung auch von gesellschaftlichen und politischen Umständen in einem bestimmten Gebiet abhängen kann, eröffnet c. 1262 CIC den Bischofskonferenzen die Möglichkeit, diesbezüglich Normen zu erlassen. Mit der Partikularnorm Nr. 17 vom 05.10.1995 zu c. 1262 CIC haben die deutschen Bischöfe klargestellt, dass aufgrund der „im Konferenzgebiet bestehenden vertrags- und staatskirchenrechtlichen Regelungen über die Kirchensteuer […] der Erlass einer eigenen Ordnung […] derzeit nicht erforderlich“ ist. Der kirchliche Vermögenserwerb in Form diözesaner Steuern, tributa, nach c. 1263 CIC ist im CIC/1983 gegenüber der erbetenen Unterstützung lediglich eine außerordentliche Form. Insbesondere die Besteuerung natürlicher Personen und somit der einzelnen Gläubigen ist nur unter engen Voraussetzungen der vorherigen Anhörung diözesaner Räte und zudem nur, sofern eine schwere Notwendigkeit dazu drängt, als letztes Mittel des Vermögenserwerbs möglich. Mit der (salvatorischen) Vorbehaltsklausel im letzten Halbsatz des c. 1263 CIC, demnach „partikulare Gesetze und Gewohnheiten [dem Diözesanbischof] weitergehende Rechte einräumen“ können, gibt der universalkirchliche Gesetzgeber, wie auch bei der Normsetzungskompetenz der Bischofskonferenzen in c. 1262 CIC, jedoch Raum für die Fortgeltung der in den verschiedenen nationalen Staaten gewachsenen Kirchenfinanzierungsmodelle. Hierzu zählt auch die Kirchensteuer als Form der Beitragsleistung in Deutschland, welche in ihrer Ausgestaltung unter keine der vom CIC/1983 vorgesehenen Formen des Vermögenserwerbs subsumiert werden kann.
Die Ursprünge dieses in Deutschland bis heute vorherrschenden Beitragssystems reichen bis in die Anfänge des 19. Jh. zurück, wo den Kirchen im Nachgang der Säkularisation Klöster, Diözesen, Stifte und weitere Vermögenswerte entzogen und in die (man kann sagen staatliche) Hand der einzelnen Fürsten gegeben wurden, welche sich im Gegenzug verpflichtet hatten, den Kirchen regelmäßige Ausgleichszahlungen zukommen zu lassen. Die zunehmende Entflechtung und Trennung von Nationalstaat und Kirchen hatte im Verlauf des 19. Jh. auch zur Folge, dass sich die deutschen Fürsten aus der Kirchenfinanzierung zunehmend zurückzogen. Mit dem 1875 im Deutschen Reich eingeführten Kirchensteuersystem, wurde ein großer Teil der staatlichen Finanzierungsverpflichtung in die heute noch übliche Mitgliedschaftssteuer umgewandelt. In Folge dieser Entwicklung können heute Religionsgesellschaften bzw. -gemeinschaften, sofern sie Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, nach Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 6 der Weimarer Reichsverfassung (deren religionsrechtliche Bestimmungen in Teilen in das Grundgesetz als geltendes Recht aufgenommen wurden) entsprechend landesrechtlicher Bestimmungen und aufgrund der staatlichen Steuerlisten Steuern erheben (vgl. exemplarisch das Kirchensteuergesetz [KirchStG] in Bayern; zu Ausführungen und weiterer Literatur zum Thema vgl. F. Hammer, Art. Kirchensteuer: Lexikon für Kirchen- und Religionsrecht Bd. 2, 882–885). Für die katholische Kirche erfolgt die Steuererhebung hauptsächlich in Form eines Zuschlags zur Einkommens- bzw. Lohnsteuer (8–9%), wodurch eine Angleichung an die jeweilige finanzielle Leistungsfähigkeit erfolgen soll. Neben der rechtlichen Absicherung dieses kirchlichen Finanzierungssystems über cc. 1262, 1263 CIC ist das deutsche Kirchensteuersystem auch durch die schon vor 1983 bestehenden Konkordate über c. 3 CIC universalkirchlich anerkannt (vgl. u.a. das Schlussprotokoll zu Art. 13 des Reichskonkordats von 1933 [hier: S. 11]).
Innerhalb dieses Kirchensteuersystems sind all diejenigen kirchensteuerpflichtig, die staatlich als Mitglieder der jeweiligen Steuer erhebenden Religionsgemeinschaft anerkannt sind – für unseren Fall: in der röm-kath. Kirche Getaufte, die im Gebiet der BRD ihren Wohnsitz haben. Für Deutschland regelt die Partikularnorm Nr. 17 vom 05.10.1995, dass auch diejenigen, welche nicht kirchensteuerpflichtig sind, zu einer Beitragsleistung im Sinne des kodikarischen Rechts „entsprechend ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit“ verpflichtet sind; daran hat der Diözesanbischof seine Gläubigen gem. c. 1261 § 2 CIC auch zu erinnern.
Wenn auch c. 222 § 1 CIC eine strenge Pflicht der Gläubigen formuliert, ist der Verpflichtungsgrad der im Vermögensrecht ausgestalteten Beitragsleistungen nicht vollkommen gleich. Vielmehr steigt die Pflicht zur Erbringung der jeweils umgeschriebenen Beiträge in den cc. 1261–1263 CIC immer weiter an. Im deutschen Kirchensteuersystem wird dies, zumindest dort wo die Einziehung der Kirchensteuer nach Vereinbarung von den staatlichen Finanzämtern übernommen wird, zusätzlich durch die Möglichkeit zur Durchsetzung der Pflicht mittels staatlichem Verwaltungszwang verschärft. Dennoch findet sich im CIC/1983 für keine der verschiedenen Formen der Beitragsleistung eine Sanktionierung für den Fall des Verstoßes gegen diese Verpflichtung. Dies war bereits im Rahmen der Kodexrevision diskutiert worden, wobei sich die Forderung nach Sicherstellung der finanziellen Unterstützung der Kirche und die Ablehnung einer Erzwingung finanzieller Beiträge gegenüberstanden, sodass schließlich die konkrete Ausgestaltung entsprechend c. 1262 CIC den Bischofskonferenzen überlassen wurde (vgl. Comm 5 [1973], 94f.).
Mit Dekret vom 15. März 2011 hat die Deutsche Bischofskonferenz (vgl. DBK, Allgemeines Dekret zum Kirchenaustritt) als Folge des vor einer staatlichen Behörde erklärten Kirchenaustritts eine Reihe von Sanktionen aufgestellt, die in ihrer Summe der im CIC/1983 vorgesehen Exkommunikation als Spruchstrafe (vgl. c. 1331 § 2 CIC n.F.) gleichkommen. Zu betonen ist: Gemeint ist hier der Austritt aus der röm.-kath. Kirche in ihrer durch den Staat anerkannten Verfasstheit, sodass der bzw. die ausgetretene Gläubige staatlicherseits nicht mehr als Mitglied der Religionsgemeinschaft gilt, was auch die Streichung aus den staatlichen Steuerlisten und damit den Ausschluss von der Kirchensteuerveranlagung zu Folge hat; die Eingliederung in die kirchliche Gemeinschaft qua Taufe bleibt nach c. 849 i.V.m. c. 845 CIC unverlierbar. Begründet werden diese Sanktionen unter anderem damit, dass der bzw. die ausgetretene Gläubige seiner bzw. ihrer Beitragspflicht nach c. 222 § 1 CIC nicht mehr nachkommt. Die rechtsbeschränkenden Folgen des Kirchenaustritts treten automatisch mit der öffentlichen Erklärung und Weiterleitung an die entsprechende kirchliche Autorität ein und werden keiner Einzelfalluntersuchung bezüglich der tatsächlichen Motive des bzw. der Ausgetretenen unterzogen. An dieser Stelle wird in der Diskussion zumeist folgendes oder ein vergleichbares Beispiel angeführt, welches auf die aus dieser Praxis resultierende Problemlage hinweist: Was ist mit der gut katholischen Juraprofessorin Kriemhild Wagner, welche ihren monatlichen Kirchensteueranteil nicht mehr anonym für irgendwelche kirchlichen Zwecke oder für die in ihrer Diözese laufenden Projekte verwendet wissen möchte, sondern die direkt in die pastorale Arbeit in ihrer Pfarrei vor Ort, die Renovierung des Kirchturms und den an die Pfarrei angeschlossenen Kindergarten investieren möchte und (nur!) deswegen staatlich den Kirchenaustritt erklärt. Die Beantwortung dieser Frage hängt nun ganz davon ab, wer richtiger Weise über die konkrete Form der Beitragsleistung entscheiden darf – der bzw. die jeweilige Gläubige selbst; dann scheint die Sanktionierung des Kirchenaustritts im geschilderten Fall wohl doch zumindest als absolut unverhältnismäßig, wenn nicht gar daraufhin die Rückfrage zu stellen ist, ob in diesem Fall das Dekret der deutschen Bischöfe in seiner derzeitigen Form rechtmäßig ist. Aufgrund der Korrespondenz von c. 222 § 1 CIC mit c. 1260 CIC, demnach die Kirche das Recht hat, für Ihre Zwecke entsprechende Unterstützung zu fordern, sowie aus der Eigenart der Steuer, welche entsprechend der Vorgaben des Steuergläubigers zu leisten und nicht in anderer Form durch Leistung an Dritte ersetzt werden kann, kann aber auch der Ansicht gefolgt werden, dass die Festlegung der Form der Pflichterfüllung auf Seiten der Kirche liegt, wie insbesondere Noach Heckel in seiner Bearbeitung des ganzen Dekrets herausarbeitet (vgl. N. Heckel, Das Allgemeine Dekret der Deutschen Bischofskonferenz zum Kirchenaustritt vom 15. März 2011, St. Ottilien 2018, S. 234–251 zu c. 222 § 1 CIC i.V.m. dem Dekret der DBK; hier insb. S. 246f.). Dann ist – trotz bleibender Anfragen an die Verhältnismäßigkeit im geschilderten Fall – festzustellen, dass jeder und jede Kirchensteuerpflichtige durch den gegenüber dem Staat erklärten Kirchenaustritt eine Pflichtverletzung begeht.
„Die Kirche und das liebe Geld.“ – Ob nun „alte“ und dennoch immer wieder notwendige Grundsatzdiskussionen über Sinn, Zweck, rechtliche Ausgestaltung und politische Rechtfertigung bestimmter Finanzierungsmodelle oder die einmal wieder aktuelle Konfrontation mit Misswirtschaft und Zweckentfremdung kirchlichen Vermögens (vgl. ausschnittweise Presseberichte hier und hier zur neuerlichen Überprüfung der vatikanischen Finanzaufsicht) – Geld und Kirche ist kein erbauliches, aber ein notwendiges Thema. Es verdeutlicht auf seine Weise, dass die Kirche eine komplexe Wirklichkeit ist, die Sichtbares und Unsichtbares, Menschliches und Göttliches vereint und damit das Geheimnis der Inkarnation in sich aufnimmt und abbildet (vgl. LG 8,1). Diese daraus entstehende Spannung im kirchlichen Leben anzunehmen, auszuhalten und darin immer wieder neue Wege zu beschreiten, ist Aufgabe und Herausforderung aller Gläubigen. Und mit diesem Impuls vermag der eine oder die andere Leser*in vielleicht sogar dem Kirchengebot der materiellen Beitragspflicht eine weihnachtliche Tiefendimension abzugewinnen.
cc. 1042 Nr. 1; 1047 § 2 Nr. 3 CIC
c. 1042: „Sunt a recipiendis ordinibus simpliciter impediti:
1° vir uxorem habens, nisi ad diaconatum permanentem legitime destinetur; […]”
„Am Empfang der Weihe einfach gehindert ist:
1° ein verheirateter Mann, sofern er nicht rechtmäßig für den ständigen Diakonat ausersehen ist; […]“
c. 1047 § 2: „Eidem [sc.: Apostolicae Sedi] etiam reservatur dispensatio […]
3° ab impedimento, de quo in can. 1042, n. 1.”
„Ebenfalls dem Apostolischen Stuhl vorbehalten ist die Dispens […]
3° von dem Hindernis nach can. 1042, n. 1.“
von Martin Rehak
Am 27.10.2019 ist die Spezialversammlung der Bischofssynode für Amazonien (auch: „Amazonas-Synode“) zu Ende gegangen. Zu den Einzelfragen, zu denen die Antwort der Synode mit größter Spannung erwartet wurde, zählte gewiss ihre Positionierung zum Zölibat der Priester. Denn bekanntlich sind gemäß c. 277 § 1 CIC die Kleriker „gehalten, vollkommene und immerwährende Enthaltsamkeit um des Himmelreiches willen zu wahren“, weswegen das Kirchenrecht gemäß c. 1037 CIC von unverheirateten Weihekandidaten verlangt, den Zölibat, d.h. ein Leben in Ehelosigkeit zu versprechen. Eine Debatte hierüber hatte das Instrumentum Laboris „Amazonien: Neue Wege für die Kirche und eine ganzheitliche Ökologie“, welches die Diskussionsgrundlage für die weiteren Beratungen der Synode bildete, in Nr. 129 angestoßen:
„In der Überzeugung, dass der Zölibat ein Geschenk für die Kirche ist, wird darum gebeten, im Blick auf die entlegensten Gebiete der Region die Möglichkeit zu prüfen, ältere Menschen zu Priestern zu weihen. Diese Menschen sollten vorzugsweise Indigene sein, die von ihrer Gemeinde respektiert und akzeptiert werden. Sie sollten geweiht werden, obwohl sie schon eine konstituierte und stabile Familie haben, mit dem Ziel, die Spendung der Sakramente zu sichern, die das Leben der Christen*innen [sic] begleiten und stützen.“
Die besondere Brisanz dieser Thematik rührt nun daher, dass unter katholischen Theologinnen und Theologen keine Einmütigkeit über die genauen Entstehungsgründe der zölibatären priesterlichen Lebensweise herrscht. Während nach vorzugswürdiger Auffassung eine allmähliche Entwicklung stattgefunden hat, wird bisweilen auch die pia opinio vertreten (vgl. etwa Stefan Heid, Zölibat in der frühen Kirche; oder in redaktioneller Zuspitzung einer so tatsächlich nicht geäußerten Interviewaussage Gerhard Ludwig Müller, Nemmeno il Papa può abolire il celibato dei preti), der Zölibat sei bereits die Lebensweise der Apostel gewesen. Nämlich in der Spielart eines (in der Diktion von Heid) „Enthaltsamkeitszölibats“, bei dem die verheirateten Apostel bzw. später die Kleriker nicht mehr geschlechtlich mit ihren Frauen verkehrten, und der später weiterentwickelt worden sei zu einem „Ehelosigkeitszölibat“ oder „Jungfräulichkeitszölibat“, gemäß welchem die Kirche nur noch Unverheiratete weihte. Träfe diese fromme Meinung zu, dann wäre der Zölibat in der Tat für die Kirche besonders identitätsstiftend und sakrosankt. Zu der geringen Belastbarkeit der hierfür vorgetragenen Argumente kann aber nicht zuletzt auf die vierteilige Analyse „Der Zölibat – eine apostolische Tradition?“ des Münchener Neutestamentlers Gerd Häfner verwiesen werden (siehe hier, hier, hier und hier). Ergänzend dazu wäre vielleicht auch auf die (exegetisch dunkle) Schriftstelle Phil 4,3 aufmerksam zu machen, wo Paulus den oder die γνήσιε σύζυγε (dt.: treuer Jochgenosse bzw. treue Jochgenossin) erwähnt. Die alexandrinischen Theologen Clemens Alexandrinus, Stromata III,6,53 (ed. Ludwig Früchtel, GCS 52, S. 220) und Origenes, Comm. in Rom I,1 (ed. Theresia Heither, FC 2/1, S. 80), haben hierunter niemand Geringeren als die Ehefrau des Paulus verstanden, von der sich Paulus dann offenbar einvernehmlich in Philippi getrennt hätte, um sich danach effektiver seiner Missionstätigkeit widmen zu können (womit sogleich 1 Kor 7,7.8.29 in ein neues Licht gerückt wäre). Für die Zölibatsdebatte ist die besagte Paulusstelle und ihre patristische Interpretation zugegebenermaßen etwas ambivalent, wird doch Paulus dadurch (nach Philippi) zum apostolischen Muster eines „Enthaltsamkeitszölibats“. Zugleich jedoch macht es diese Deutung (noch) unwahrscheinlich(er), dass es sich bei den getauften Frauen in 1 Kor 9,5 lediglich um ihrerseits zölibatär lebende Missionshelferinnen (so in etwa Heid), nicht aber um die Ehefrauen der erwähnten urchristlichen Persönlichkeiten (Apostel, Herrenbrüder, Kephas) handelte. Dass Clemens und Origenes überhaupt eine Deutung auf die Ehefrau des Paulus vornehmen, also aus heutiger Sicht eine lectio difficilior wählen, stellt dabei meines Erachtens insgesamt ein Argument gegen die Deutung des Zölibats als kirchliches Traditionsgut aus apostolischer Zeit dar. Soweit es Paulus betrifft, läge erkennbar eine individuelle, die Zustimmung der Ehefrau voraussetzende Einzelfallentscheidung vor, aus der alleine sich noch keine allgemeine urchristliche Gepflogenheit und kirchliche Disziplin ableiten lässt.
Auch für die Bischofssynode war die Zölibatsfrage offenbar ein (vergleichsweise) kontrovers diskutiertes Thema, wie sich an der Abstimmung über den einschlägigen Passus des Schlussdokuments der Synode zeigt. Nach Mitteilung des Vatikanischen Pressesaals (siehe hier) hat die einschlägige Nr. 111 des Schlussdokuments mit 41 Non placet-Stimmen bei 128 Placet-Stimmen die höchste Zahl an Gegenstimmen auf sich vereint, insgesamt fast ein Viertel aller abgegebenen Stimmen. Damit wurde folgender Text gebilligt, der teilweise mit dem Text des Instrumentum Laboris korrespondiert, teilweise aber auch hiervon abweicht:
„[…] proponemos establecer criterios y disposiciones de parte de la autoridad competente, en el marco de la Lumen Gentium 26, de ordenar sacerdotes a hombres idóneos y reconocidos de la comunidad, que tengan un diaconado permanente fecundo y reciban una formación adecuada para el presbiterado, pudiendo tener familia legítimamente constituída y estable, para sostener la vida de la comunidad cristiana mediante la predicación de la Palabra y la celebración de los Sacramentos en las zonas más remotas de la región amazónica.
(dt.: […] wir schlagen vor, seitens der – im Rahmen von Lumen Gentium 26 – zuständigen Autorität Kriterien und Vorkehrungen zu etablieren, um geeignete und in der Gemeinde anerkannte Männer, die den Ständigen Diakonat in fruchtbarer Weise ausüben und eine dem Presbyterat angemessene Ausbildung erhalten, und die eine stabile und rechtmäßig konstituierte Familie haben können, zu Priestern zu weihen, um so das Leben der christlichen Gemeinschaft durch Predigt des Wortes und Feier der Sakramente in den entlegensten Gebieten der Amazonas-Region zu erhalten.)“
Nun ist Papst Franziskus zwar (rein kirchenrechtlich betrachtet) völlig frei darin, ob und wie er diesen Vorschlag der ihn beratenden Bischofssynode aufgreift und umsetzt. Jedoch kann man bereits jetzt analysieren, ob und wie sich dieser Vorschlag in das derzeitige (kodikarische) Kirchenrecht der lateinischen Kirche einfügt.
Dem Vorschlag zufolge soll künftig die Ausübung des Priestertums dann mit einem Familienleben des zum priesterlichen Dienst Geweihten vereinbar sein, wenn sich dieser zuvor als ständiger Diakon (vgl. dazu insbes. cc. 236, 276 § 2 Nr. 3, 281 § 3, 288, 1031 § 2 und 1032 § 3 CIC) bewährt hat. Damit erfährt das Schlagwort der „viri probati“ insofern eine Neuinterpretation, als es nunmehr nicht nur auf die Bewährung in (Zivil-)Beruf und Familie, sondern auch auf die Bewährung im diakonalen geistlichen Dienst ankommt. Sehr zu begrüßen ist, dass der Vorschlag ausdrücklich eine „angemessene Ausbildung“ jener künftigen Priesteramtskandidaten verlangt, die also der künftigen sozialen und ekklesiologischen Rolle des Priesters in der katholischen Kirche „angemessen“ ist und somit in Breite und Tiefe deutlich über die theologisch-pastorale Ausbildung der Kandidaten zur Vorbereitung auf die Diakonenweihe hinausgehen dürfte (vgl. dazu auch cc. 248–258 und 1032 § 1 CIC).
Dadurch erinnert der Vorschlag der Bischofssynode an die Anregungen von Philipp Müller, Helmut Hoping, Viri probati zur Priesterweihe zulassen, in: HK 71 (2017) 13–16, die Philipp Müller in seinem Vortrag auf dem Studientag zur Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz im März diesen Jahres nochmals dem deutschen Episkopat nahe gebracht hatte. Im Gespräch hat Helmut Hoping selbst diesen Vorschlag zutreffend als „strukturkonservativ“ bezeichnet und dieses Urteil mit der Erwägung begründet, dass – wenn auch gewissermaßen aufschiebend bedingt – auch der verheiratete ständige Diakon im Lichte der geltenden kirchlichen Rechtsordnung insofern nach dem etwaigen Tod seiner Ehefrau zölibatspflichtig wird, als auch für ihn aus seiner Diakonenweihe das Ehehindernis der Weihe gemäß c. 1087 CIC resultiert. (Für ein vollständiges und realistisches Gesamtbild ist an dieser Stelle freilich zu sehen, dass c. 1087 CIC eine dispensable Norm darstellt, so dass einem verwitweten ständigen Diakon Dispens von diesem Ehehindernis gewährt werden kann und in typischen Fallkonstellationen auch tatsächlich gerne gewährt wird.)
Die Anregungen von Müller und Hoping stehen insofern auch in einer langen kirchenrechtlichen Tradition. Denn wie Stefan Heid, Zölibat in der frühen Kirche, passim, zeigen konnte, hat die alte Kirche die Aufforderung des Apostels: „Jeder bleibe in dem Stand, in dem ihn Gottes Ruf erreicht hat“ (1 Kor 7,20) alsbald als eine weiherechtliche Vorschrift interpretiert, die unbedingt zu beachten war. Wer also als Lediger geweiht wurde, hatte ledig zu bleiben (bzw. durfte im cursus honorum auf gar keinen Fall zu den höheren Weiheämtern aufsteigen); wer hingegen als Verheirateter geweiht wurde, führte seine Ehe fort. Das geltende kodikarische Recht behält diese Linie bei, indem c. 1037 CIC die Übernahme der Zölibatsverpflichtung als eine der Voraussetzungen für die Diakonenweihe von Priesteramtskandidaten sowie von unverheirateten Weihebewerbern für den Ständigen Diakonat vorschreibt.
Zugleich erweist sich der Vorschlag der Bischofssynode in Bezug auf die „viri probati“ aber auch als prinzipiell mit dem geltenden kodikarischen Recht vereinbar. Richtig ist zwar, dass eine bestehende Ehe eines Weihekandidaten gemäß c. 1042 Nr. 1 CIC ein einfaches Weihehindernis darstellt. Von diesem Hindernis kann jedoch dispensiert werden, wie sich zwingend aus c. 1047 § 2 Nr. 3 CIC ergibt.
Aus kanonistischer Sicht ist damit übrigens auch Bestrebungen eine Grenze aufgezeigt, den Zölibat in unangemessener Weise zu überhöhen. Zwar ist er, wie beispielsweise das Zweite Vatikanische Konzil im Dekret Presbyterorum ordinis über Dienst und Leben der Priester, dort Nr. 16, lehrt, eine „kostbare Gabe“ bzw. ein „Geschenk“ Gottes an seine Kirche und vor allem aus theologischen Gründen „in vielfacher Hinsicht dem Priestertum angemessen“. Ungeachtet dessen kann jedoch der Zölibat im Lichte der Möglichkeit, hiervon zu dispensieren, weder als dem ius divinum (arg. e c. 85 CIC) zugehörig, noch als Wesenselement des katholischen Priestertums (arg. e c. 86 CIC) verstanden werden.
Weniger verständlich ist in diesem Zusammenhang dann die Kritik von Giuseppe Nardi, dem zufolge die Zulassung verheirateter Männer zum Priestertum „keine genuin organische Entwicklung bestätigt und kodifiziert, sondern am grünen Tisch ex novo erzeugt“. Dazu sei zunächst bemerkt, dass Nardi den Begriff der Entwicklung vermutlich mehr auf die Entwicklung der Rechtslage und weniger auf die Entwicklung der Bereitschaft im gläubigen Volk, nichtzölibatäre Priester zu akzeptieren, bezogen wissen möchte. Was diesen empirischen Gesichtspunkt anbelangt, so bieten beispielsweise Medienberichte (vgl. statt anderswo hier und hier), wonach Gemeinden die Ankündigung von Priestern mit Beifall quittieren, wegen einer Frau auf ihr Priestertum zu verzichten, ein schwer zu übersehendes Indiz dafür, dass das Bedürfnis nach zölibatären Priestern zumindest in Teilen des gläubigen Volkes geschwunden und gegenüber früheren Jahrhunderten ein beachtlicher Mentalitätswechsel eingetreten ist. Was aber das Rechtliche, also die Idealgestalt der Kirche anbelangt, sei hier die grundsätzliche Problematik ausgeblendet, ob und wie in einer kirchenrechtlich engmaschig geregelten Frage – und hierzu wäre, zumal angesichts der (zumindest in bestimmten Fällen, insbesondere jenen der [versuchten] Eheschließung) strafrechtlichen Sanktionierung von Verstößen, wohl auch der Zölibat zu zählen – eine organische Entwicklung überhaupt funktionieren kann. Vielmehr sei auf folgendes hingewiesen: Es entspricht seit langem der kirchlichen Praxis, jene Konvertiten zur katholischen Kirche, die in ihrer bisherigen Kirche oder kirchlichen Gemeinschaft als Religionsdiener fungierten, (sofern sie darum bitten) unter Dispens vom Zölibat zum Priester zu weihen. Dabei entsprach es zwar lange Zeit der kirchlichen Disziplin, dass solche nicht an den Zölibat gebundene Priester nicht in der normalen Pfarrseelsorge eingesetzt wurden. (Als sich im Jahre 1973 der Limburger Bischof Wilhelm Kempf über diese Disziplin hinwegsetzte, ließ es der damalige Bonner Nuntius Corrado Bafile zu einem Eklat kommen, vgl. dazu etwa hier und hier.) Inzwischen jedoch hat sich Rom mit einer gewissen Lockerung dieser Disziplin einverstanden erklärt, wie aus einem Schreiben (Prot. N. 66/77–53108) der Kongregation für die Glaubenslehre vom 23.11.2015 an den Vorsitzenden der US-amerikanischen Bischofskonferenz hervorgeht. Die Glaubenskongregation hat demnach entschieden, von ihrer bisherigen Politik in Bezug auf eine ordentliche Seelsorge durch verheiratete, ehemals protestantische Priester Abstand zu nehmen und es fortan dem klugen Urteil des jeweiligen Ordinarius eines solchen Priesters zu überlassen, wo und wie er eingesetzt wird und ob ihm insbesondere das Amt eines Pfarrers übertragen werden kann. Ebenso hatte Rom zwischen 1890 und 1930 als innerkirchliche Disziplin etabliert, dass der Klerus der unierten Kirchen in der Diaspora (sprich im Territorium der lateinischen Kirche) nicht verheiratet sein dürfe. Von dieser Linie ist nunmehr die Kongregation für die Ostkirchen, Pontificia Praecepta de Clero Uxorato Orientali vom 14.06.2014, in: AAS 106 (2014) 496–499, mit päpstlicher Approbation abgewichen, indem den orientalischen Hierarchen in der Diaspora (und ebenso jenen Ordinarien, die ein lateinisches Ordinariat für Gläubige orientalischer Riten leiten,) die Vollmacht gewährt wurde, verheiratete Kleriker in der Pastoral einzusetzen bzw. verheiratete Priester für die jeweilige Diasporazirkumskription zu weihen. Insgesamt erweist sich damit die im Vorschlag der Bischofssynode thematisierte Möglichkeit, bereits verheiratete Männer unter Dispens vom Zölibat nicht nur zu ständigen Diakonen (was ohne Dispens möglich wäre), sondern gegebenenfalls auch zu Priestern zu weihen, keineswegs als eine creatio ex nihilo.
Dies führt uns zurück zu der Frage, ob und wie sich der Vorschlag der Bischofssynode mit dem geltenden Kirchenrecht vereinbaren lässt. Die Aufgabe, „Kriterien und Vorkehrungen zu etablieren“, um verheiratete Männer zu Priestern zu weihen, soll bei der zuständigen Autorität liegen – und zwar spezifisch bei der gemäß Nr. 26 der Kirchenkonstitution Lumen Gentium zuständigen Autorität.
Dies lässt aufhorchen. Denn am angegebenen Ort spricht das Konzil in höchsten Tönen von den Bischöfen, die „mit der Fülle des Weihesakramentes ausgezeichnet“ zumindest virtuell „jede rechtmäßige Eucharistiefeier“ in ihrem jeweiligen Bistum leiten. Und beschreibt in leuchtendsten Farben die bischöfliche Aufgabe, „durch die Sakramente, deren geregelte und fruchtbare Verwaltung sie mit ihrer Autorität ordnen“, die Gläubigen zu heiligen und dazu „die heiligen Weihen [zu erteilen]“. Geht der Vorschlag der Bischofssynode also dahin, in der Frage der „viri probati“ das Weiherecht zu dezentralisieren und es der Partikulargesetzgebung eines jeden Diözesanbischofs anheimzustellen, welche Kriterien und Vorkehrungen er für die Weihe von „viri probati“ für erforderlich hält? Und soll sich dies nur auf allgemeine Eignungskriterien und Vorschriften zur Ausbildung künftiger verheirateter Priester beziehen, oder auch die eigenständige Einzelfallentscheidung miteinschließen, Verheiratete zu Priestern zu weihen? Und weiter: Muss, um Konformität mit dem (dann) geltenden Kirchenrecht zu erzielen, somit an eine Änderung des geltenden c. 1042 Nr. 1 CIC oder des geltenden c. 1047 § 2 Nr. 3 CIC oder womöglich sogar beider Kanones gedacht werden?
Würde die Norm des c. 1047 § 2 Nr. 3 CIC gestrichen, so wäre die Dispens von c. 1042 Nr. 1 CIC nicht mehr dem Apostolischen Stuhl reserviert, sondern läge gemäß c. 87 CIC bei den Diözesanbischöfen; wobei eine schlichte Streichung des c. 1047 § 2 Nr. 3 CIC notwendigerweise zur Folge hätte, dass diese Neuregelung nicht etwa nur die Kirche in Amazonien, sondern die gesamte lateinische Kirche beträfe. Strukturell wäre dies – mea sententia – gleichwohl der maßvollere Eingriff in das geltende Recht, da die Notwendigkeit einer Dispens weiterhin verdeutlichen würde, dass der verheiratete Priester eine Ausnahme von der Regel darstellt. Demgegenüber würde jede Änderung des c. 1042 Nr. 1 CIC – auch wenn in dessen neuer Fassung nur auf partikulares (und vom Apostolischen Stuhl approbiertes?) Sonderrecht (für Amazonien?) verwiesen wird – den verheirateten Priester zum expliziten Thema der kirchlichen Gesetzgebung und nicht nur zum Gegenstand eines Einzelverwaltungsaktes machen.
Es bleibt daher aus Sicht der Kanonistik spannend, welche kirchenrechtlichen Konsequenzen Papst Franziskus aus dem beratenden Votum der Bischofssynode zieht und wie weitreichend diese Konsequenzen sind. Bereits jetzt lässt sich umgekehrt jedoch festhalten, dass die Bischofssynode jenes bereits erwähnte Grunddatum des kirchlichen Weiherechts, wie es sich für die Kirche aus der kanonischen Rezeption von 1 Kor 7,20 ergeben hat, nicht einmal ansatzweise in Frage gestellt hat. Damit wird die Disziplin der katholischen (nicht nur der lateinischen) Kirche also auch künftig von ledigen Weihekandidaten erwarten, dass sie nach ihrer Weihe dem evangelischen Rat (vgl. Mt 19,12) der Keuschheit und Ehelosigkeit folgen. Für verheiratete Weihekandidaten hingegen könnten die Überlegungen der Amazonas-Synode dazu führen, dass diese künftig nicht nur zu ständigen Diakonen, sondern unter näher zu regelnden Voraussetzungen, was insbesondere allgemeine Eignungskriterien und ihre weitere Ausbildung im Blick auf die Herausforderungen des priesterlichen Dienstes anbelangt, auch zu Priestern geweiht werden können.
c. 747 § 2 CIC
„Ecclesiae competit semper et ubique principia moralia etiam de ordine sociali annuntiare, necnon iudicium ferre de quibuslibet rebus humanis, quatenus personae humanae iura fundamentalia aut animarum salus id exigant.“
„Der Kirche kommt es zu, immer und überall die sittlichen Grundsätze auch über die soziale Ordnung zu verkündigen wie auch über menschliche Dinge jedweder Art zu urteilen, insoweit die Grundrechte der menschlichen Person oder das Heil der Seelen dies erfordern.“
von Martin Rehak
Teils mit Freude und Hoffnung, teils mit Unverständnis und Angst verfolgen nicht nur alle interessierten Gläubigen der katholischen Kirche, sondern auch viele nichtkatholische Menschen guten Willens auf der ganzen Welt in diesen Tagen die Bischofssynode, die vom 6.–27. Oktober 2019 in Rom gefeiert wird. Die Bischofssynode tritt in diesem Jahr zum elften Mal als Spezialversammlung zusammen und behandelt als solche per definitionem jene Angelegenheiten, die eine bestimmte Region der Erde unmittelbar betreffen (vgl. dazu c. 345 CIC); zuvor hatte es Spezialversammlungen der Bischofssynode für die Niederlande (1980), Europa (1991, 1999), Afrika (1994, 2009), den Libanon (1995), Amerika (1997), Asien (1998), Ozeanien (1998) und den Nahen Osten (2010) gegeben. Das Instrumentum Laboris, also die Diskussionsgrundlage für die weiteren Beratungen der Teilnehmer an der Synode, trägt den Titel „Amazonien: Neue Wege für die Kirche und eine ganzheitliche Ökologie.“
Dabei ist seit der Veröffentlichung des Instrumentum Laboris – neben anderen Propositionen, etwa zum Offenbarungsbegriff, zum Verständnis von Religion und zum Weiheamt – auch die ausdrückliche Verschränkung von Theologie und Ökologie mehrfach von prominenten konservativen Theologen und Kirchenfürsten kritisiert worden, beispielsweise in dem Internet-Beitrag „Eine Kritik des ‚Instrumentum Laboris‘ für die Amazonas-Synode“ von Walter Kardinal Brandmüller: „Was haben – so fragt man – Ökologie, Ökonomie und Politik mit dem Auftrag der Kirche zu tun? Und vor allem: Welche fachliche Kompetenz legitimiert eine kirchliche Bischofssynode, sich zu solchen Sachgebieten zu äußern?“
Dem Kanonisten kommt angesichts einer solchen Anfrage c. 747 CIC in den Sinn, der programmatisch das dritte, dem Verkündigungsdienst der Kirche gewidmete Buch des Kodex des kanonischen Rechts eröffnet. Während c. 747 § 1 CIC die Kirche als Trägerin und Tradentin des fidei depositum, der von den Aposteln hinterlegten Glaubenslehre proklamiert, nimmt c. 747 § 2 CIC die aus diesem Glauben der Kirche ableitbare Sittenlehre in den Blick. Die Norm dient somit der kirchlichen Selbstvergewisserung darüber, dass sich ihre Lehrkompetenz nicht allein auf das geoffenbarte Glaubensgut, sondern auch auf die hieraus ableitbare gelebte Glaubenspraxis erstreckt.
C. 747 § 2 CIC ist gegenüber dem Kodex von 1917 neu. Wie aus der mit einem Quellenapparat versehenen Ausgabe der Päpstlichen Kommission für die authentische Interpretation des CIC (jetzt: Päpstlicher Rat für die Gesetzestexte) leicht ersichtlich ist, beruht diese Norm vor allem auf dem Lehramt der Päpste Pius XI., Johannes XXIII. (der wiederum an entscheidenden Stellen Pius XII. zitiert) und Paul VI., sowie auf dem Lehramt des Zweiten Vatikanischen Konzils (wobei im einzelnen CD 12, DH 15, GS 76 und GS 86 als Fundstellen genannt werden).
Von besonderem Interesse für die Genese des c. 747 § 2 CIC ist zunächst die Enzyklika Mater et magistra Papst Johannes’ XXIII. aus dem Jahre 1961. Dort ist bereits in der Einleitung davon die Rede, dass die Kirche auch dadurch den Auftrag ihres Gründers verwirklicht, dass sie sich „auch um die Bedürfnisse des menschlichen Alltags [bemüht]“ (MM 3). Mit Blick (ausschließlich) auf die „soziale Frage“ und die Enzykliken Rerum novarum (Leo XIII., 1891) sowie Quadragesimo anno (Pius XI., 1931) wird sodann an das Recht und die Pflicht der Kirche erinnert, „ihren besonderen Beitrag zur Lösung der ernsten sozialen Frage zu leisten, die die ganze Menschheit so sehr bewegt“ (MM 28). In der Pastoralkonstitution Gaudium et spes (1965) des Vaticanum II wird uns der abstrakte Gehalt dieser Erwägung erneut begegnen als die Lehre von den Zeichen der Zeit, die im Lichte des Evangeliums zu deuten sind (vgl. GS 4). Die Enzyklika Mater et magistra erinnert sodann an die Rundfunkbotschaft Papst Pius’ XII. zum Pfingstfest des Jahres 1941, in welcher der Papst erklärt hatte: „È invece inoppugnabile competenza della Chiesa […] il giudicare se le basi di un dato ordinamento sociale siano in accordo con l’ordine immutabile, che Dio Creatore e Redentore ha manifestato per mezzo del diritto naturale e della rivelazione (dt.: Zum unanfechtbaren Geltungsbereich der Kirche gehört es […] darüber zu befinden, ob die Grundlagen der jeweiligen gesellschaftlichen Ordnung mit der ewig gültigen Ordnung übereinstimmen, die Gott, der Schöpfer und Erlöser, durch Naturrecht und Offenbarung kundgetan hat)“ (vgl. MM 42). Dazu führt Johannes XXIII. in einer Collage von Zitaten aus besagter Rundfunkbotschaft seines Amtsvorgängers aus, dass – unter Hintanstellung des Rechts auf Privateigentum! – jene irdischen Güter, „die Gott für die Menschen insgesamt schuf, im Ausmaß der Billigkeit nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit und Liebe allen zuströmen“ (MM 43). Im vierten Teil der Enzyklika erklärt der Papst, dass die Grundprinzipien der kirchlichen Soziallehre dem Schutz der unantastbaren Würde der menschlichen Person dienen (vgl. MM 219 f.), so dass umgekehrt auch „die Soziallehre der katholischen Kirche ein integrierender Bestandteil der christlichen Lehre vom Menschen ist“ (MM 222). Hinsichtlich der Verwirklichung der kirchlichen Soziallehre wird ausdrücklich der Dreischritt „Sehen – Urteilen – Handeln“ empfohlen (vgl. MM 236). Wo einschlägige Weisungen und Vorschriften der kirchlichen Hierarchie fehlen, soll der Katholik im Umgang mit Andersdenkenden einerseits faule Kompromisse ablehnen, zugleich jedoch „andere Auffassungen mit dem gebührenden Wohlwollen prüfen“ (MM 239); wo indes das Lehramt sich geäußert hat, ist ihm zu folgen. Denn „[d]ie Kirche hat ja nicht nur das Recht und die Pflicht, über die Grundsätze des Glaubens und der Sittlichkeit zu wachen, sondern sich auch in verbindlichen Entscheidungen mit Bezug auf die Verwirklichung dieser Grundsätze zu äußern“ (ebd.).
In der Enzyklika Pacem in terris (1963) hat Johannes XXIII. die gesamte Menschheit als eine „Schicksalsgemeinschaft“ verstanden, insofern sie „aus Menschen besteht, die gleichberechtigt an der naturgegebenen Würde teilhaben“, und aus dieser „in der Natur des Menschen gründende[n] Notwendigkeit“ gefolgert, „daß in geziemender Weise jenes umfassende Gemeinwohl angestrebt wird, welches die gesamte Menschheitsfamilie angeht“ (PiT 69). In diesem Zusammenhang hat er auch Skepsis darüber geäußert, ob das bisherige Instrumentarium des Völker- und des Internationalen Rechts hinreicht, um ein wahrhaft universales Gemeinwohl der Menschheitsfamilie zu garantieren (vgl. ebd.). Des Weiteren ist der Papst dem Gedanken nähergetreten, dass der Katholik – die hier stets gebotene Klugheit immer vorausgesetzt – unter Umständen auch Allianzen mit solchen wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Bewegungen eingehen könne, die zwar von „falschen philosophischen Lehrmeinungen über das Wesen, den Ursprung und das Ziel der Welt und des Menschen“ (PiT 84) zu unterscheiden sind, aber ihre Entstehung diesen falschen Meinungen verdanken. Dabei gesteht der Papst den Katholiken, die im fraglichen Lebensbereich aktiv sind, einerseits zu, selbst einzuschätzen, was insoweit möglich und sinnvoll ist; formuliert aber auch folgende Schranken dieser Einschätzungsprärogative:
„Allerdings müssen sie immer auf die Grundsätze des Naturrechts achten, sich nach der Soziallehre der Kirche richten und in Übereinstimmung mit den Richtlinien des kirchlichen Lehramts stehen. In der Tat darf niemand außer acht lassen, daß es Recht und Pflicht der Kirche ist, nicht nur die Reinheit der Glaubens- und Sittenlehre zu schützen, sondern ihre Autorität auch im Bereich diesseitiger Dinge einzusetzen, wenn nämlich die Durchführung der kirchlichen Lehre in konkreten Fällen ein solches Urteil notwendig macht“ (PiT 85).
Wie Hans-Joachim Sander zur Pastoralkonstitution Gaudium et spes erläutert (vgl. Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Bd. 4, hier bes. S. 715–717), ist dieses Konzilsdokument gemäß dem Prinzip „Sehen – Urteilen – Handeln“ strukturiert. Das bedeutet, dass Verkündigung und Pastoral nicht losgelöst von den innerweltlichen Gegebenheiten erfolgen dürfen, sondern sich die Kirche zu diesen Gegebenheiten in Beziehung zu setzen hat, wenn sie ihren Sendungsauftrag erfüllen will. Was das „Sehen“ anbelangt, schreibt GS 4 daher unter der Überschrift „Hoffnung und Angst“ der Kirche ins Stammbuch, „nach den Zeichen der Zeit zu forschen und sie im Licht des Evangeliums zu deuten“. Weil nämlich letzte Fragen sich im Wandel der Verhältnisse in je neuen Formen zeigen können, werden die „Zeichen der Zeit“ zum Erkenntnisort der Theologie, insofern sie „die Berufung der Menschen, Menschen zu werden, die sich vor Gott sehen lassen können“ (Sander, a.a.O., S. 716) ebenso wie die je aktuellen Gefährdungen der Menschlichkeit aufdecken. Dazu sind freilich unter den „Zeichen der Zeit“ nicht etwa bloße Modeerscheinungen zu verstehen, sondern jene Phänomene, die für die jeweilige Generation von globaler Bedeutung sind und „in denen Wohl und Wehe der Menschen von heute sichtbar werden“ (ebd., S. 717). Wer aber könnte leugnen, dass in dieser Perspektive das Thema Ökologie zu den Zeichen der gegenwärtigen Zeit zählt? (Und zwar selbst dann, wenn künftige Generationen zu der Feststellung berechtigt wären, dass nach ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen das späte 20. und das frühe 21. Jahrhundert nicht von einem vom Menschen verursachten Klimawandel, sondern nur von diesbezüglicher Besorgnis oder Hysterie gekennzeichnet gewesen sind.) Schon Papst Benedikt XVI. hat in seiner Ansprache vor dem Deutschen Bundestag (2011) ausgeführt, dass „Materie nicht nur Material für unser Machen ist, sondern daß die Erde selbst ihre Würde in sich trägt und wir ihrer Weisung folgen müssen. […] Wenn in unserem Umgang mit der Wirklichkeit etwas nicht stimmt, dann müssen wir alle ernstlich über das Ganze nachdenken und sind alle auf die Frage nach den Grundlagen unserer Kultur überhaupt verwiesen. […] Die Bedeutung der Ökologie ist inzwischen unbestritten.“ Papst Franziskus hat diese Einsicht in seiner Enzyklika Laudato si’ (2015) vertieft und gelehrt, dass eine ganzheitliche Ökologie integraler Bestandteil einer globalen Gerechtigkeit ist. Es ist daher in jedem Fall die Aufgabe der Kirche, die Menschheit in Sachen Ökologie nicht mit Hoffnung und Angst allein zu lassen, sondern hierauf vom Evangelium Christi her einzugehen und aufzuzeigen, welche neuen Perspektiven sich aus diesem Zeitzeichen für den Glauben an Gott und für eine wahrhaft christliche Lebenspraxis ergeben.
Während GS 4 nur für das Themenspektrum relevant ist, das im Rahmen des c. 747 § 2 CIC gegebenenfalls zur Sprache kommen kann, erweist sich GS 76 als die Quelle, aus welcher der Gesetzgeber bei der Formulierung unserer Norm intensiv geschöpft hat. Anlässlich der dortigen Erwägungen zum Verhältnis von Kirche und Staat erklärt das Konzil nämlich wörtlich folgendes:
„Semper autem et ubique ei [sc.: ecclesia] fas sit cum vera libertate fidem praedicare, socialem suam doctrinam docere, munus suum inter homines expedite exercere necnon iudicium morale ferre, etiam de rebus quae ordinem politicum respiciunt, quando personae iura fundamentalia aut animarum salus id exigant, […]. (dt.: Immer und überall aber nimmt sie [gemeint: die Kirche] das Recht in Anspruch, in wahrer Freiheit den Glauben zu verkünden, die Soziallehre kundzumachen, ihren Auftrag unter den Menschen unbehindert zu erfüllen und auch politische Angelegenheiten einer sittlichen Beurteilung zu unterstellen, wenn die Grundrechte der menschlichen Person oder das Heil der Seelen es verlangen. […].“ (GS 76,5)
In der Erklärung Dignitatis humanae über die Religionsfreiheit (1965) wird die konziliare Lehre von den Zeichen der Zeit auf das Problem der Religionsfreiheit praktisch angewandt (vgl. DH 15).
Gemäß dem Dekret Christus Dominus über die Hirtenaufgabe der Bischöfe (1965) soll der Diözesanbischof neben der Verkündung der Frohbotschaft Christi aufzeigen, dass „die irdischen Dinge und die menschlichen Einrichtungen nach dem Plan des Schöpfergottes auf das Heil der Menschen hingeordnet sind“ (CD 12,2) und „wie sehr nach der Lehre der Kirche die menschliche Person zu achten ist“ (CD 12,3), bis hin zu einer Darlegung jener „Grundsätze […], nach denen die überaus schwierigen Fragen über Besitz, Vermehrung und rechte Verteilung der materiellen Güter […] zu lösen sind“.
Dass ein intaktes globales Ökosystem auch theologisch bedeutsam ist, zeigt nicht zuletzt die Bildsprache der heiligen Schrift, mit der immer wieder abstrakte theologische Konzepte mithilfe von Bildern und Vergleichen veranschaulicht werden, die der natürlichen Umwelt entnommen sind. Aus der Fülle von Beispielen wird man an die Heilsverheißung aus Jer 35,1–10 denken, wie sie am dritten Adventssonntag zur Lesung vorgesehen ist; oder kann an Psalm 84 erinnern, wie er auch von Papst Johannes XXIII. in der Enzyklika Mater et magistra zitiert wird (vgl. MM 262):
„Jubeln werden die Wüste und das trockene Land, jauchzen wird die Steppe und blühen wie die Lilie. Sie wird prächtig blühen und sie wird jauchzen, ja jauchzen und frohlocken. […] Sie werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes. […] Dann springt der Lahme wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen frohlockt, denn in der Wüste sind Wasser hervorgebrochen und Flüsse in der Steppe. Der glühende Sand wird zum Teich und das durstige Land zu sprudelnden Wassern. Auf der Aue, wo sich Schakale lagern, wird das Gras zu Schilfrohr und Papyrus. Dort wird es eine Straße, den Weg geben; man nennt ihn den Heiligen Weg. […] Es wird dort keinen Löwen geben, kein Raubtier zieht auf ihm hinauf, kein einziges ist dort zu finden, sondern Erlöste werden ihn gehen.“
„Lauschen will ich, was Gott der Herr zu mir redet: wahrlich, er redet Frieden, zu seinem Volk und seinen Frommen, denen, die sich von Herzen zu ihm kehren. Sicher, nah ist sein Heil allen, welche ihn fürchten, seine Herrlichkeit wird in unserem Lande wohnen. Begegnen werden sich Gnade und Treue, Recht und Friede einander umarmen. Treue wird aus der Erde sprossen, Gerechtigkeit nieder vom Himmel schauen. Der Herr wird uns seine Güter spenden und unser Land seine Frucht bescheren. Voraufgehen wird ihm Gerechtigkeit und Heil der Spur seiner Füße folgen.“
Was also haben nach alledem Ökologie, Ökonomie und Politik mit dem Auftrag der Kirche zu tun? Auf diese Frage bietet c. 747 § 2 CIC eine erhellende Antwort. Ökologie, Ökonomie und Politik sind aus dem Auftrag einer Kirche, die Gott als den guten Schöpfer der Welt und des Menschen verkünden möchte, jedenfalls dann nicht hinwegzudenken, wenn „die Grundrechte der menschlichen Person oder das Heil der Seelen“ nach einer lehrmäßigen Stellungnahme der Kirche zu den genannten Themenfeldern verlangen. Für die Teilnehmer an der diesjährigen Bischofssynode bedeutet dies konkret, dass sie sich als Theologen, nicht jedoch als Natur-, Wirtschafts- oder Politikwissenschaftler zu den ökologischen, wirtschaftlichen und politischen Fragen zu äußern haben, welche die Kirche in Amazonien beschäftigen. Mögen sie dazu die nötige theologische Kompetenz besitzen und unter dem Beistand des Heiligen Geistes zum Wohl der ganzen Menschheitsfamilie segensreich zur Geltung bringen.
c. 1247 CIC
„Die dominica aliisque diebus festis de praecepto fideles obligatione tenentur Missam participandi; abstineant insuper ab illis operibus et negotiis quae cultum Deo reddendum, laetitiam diei Domini propriam, aut debitam mentis ac corporis relaxationem impediant.“
„Am Sonntag und an anderen gebotenen Feiertagen sind die Gläubigen zur Teilnahme an der Messfeier verpflichtet; sie haben sich darüber hinaus jener Werke und Tätigkeiten zu enthalten, die den Gottesdienst, die dem Sonntag eigene Freude oder die Geist und Körper geschuldete Erholung hindern.“
von Anna Krähe
Der vorliegende Beitrag ist Teil einer Reihe im Rahmen von „Kanon des Monats“, in der in loser Reihenfolge jedes der sogenannten fünf Kirchengebote (vgl. KKK 2041–2043) aus kanonistischer Perspektive betrachtet und bezüglich seiner Verortung und Funktion im geltenden Recht untersucht wird. Bisherige Teile: Teil 1 (c. 1251 CIC; Fasten- und Abstinenzgebot); Teil 2 (c. 920 CIC; Osterkommunion).
Willkommen im Monat September und damit auch – zumindest für die meisten – herzlich willkommen zurück aus Ihrem sommerlichen Jahresurlaub. Langsam nun geht die Sommerzeit zu Ende; die Kindergärten und Schulen öffnen wieder ihre Türen; die Kollegen und Kolleginnen sitzen wieder in ihren Büros. Wenn Sie auf den üblichen Smalltalk über Reiseziele, Erholungsgrad und Sonnenbräune verzichten möchten, dann erkundigen Sie sich doch einmal danach, wie Ihr Gegenüber es in den Urlaubswochen denn mit der Sonntagspflicht gehalten hat. Oder fragen Sie sich selbst: Haben Sie die Chance genutzt, sich einmal anzuschauen, wie an Ihrem Urlaubsort Eucharistie gefeiert wird? Oder sind Sie Gott doch eher bei der sonntäglichen Wanderung durch die Berge oder beim Sonnenuntergang am Meer nähergekommen? Oder war es doch schlicht schöner, einfach einmal auszuschlafen?
Ob in der Urlaubszeit oder im Alltag, in der Diskussion um die Verpflichtung zur Teilnahme an der Sonntags- und Feiertagsmesse spielen all diese persönlichen Aspekte, Bedürfnisse und Interessen eine Rolle. Der Hebräerbrief gibt Zeugnis davon, dass ein Fernbleiben von der Zusammenkunft am Herrentag, der zentralen Gemeinschaftsfeier am ersten Tag der Woche als Tag der Auferstehung Christi, schon unter den ersten Christinnen und Christen für einige zur Gewohnheit geworden war (vgl. Hebr 10,25). Die Versammlung zum Herrenmahl am Tag des Herrn war in den ersten christlichen Jahrhunderten noch nicht rechtlich vorgegeben, sondern eine – neben dem oder zusätzlich zum jüdischen Sabbat, in der Regel wohl an einem Arbeitstag – zu erfüllende Selbstverständlichkeit und ureigener Ausdruck des Lebens innerhalb der christlichen Gemeinschaft (vgl. Didaché 14,1). Erst nachdem Kaiser Konstantin im Jahr 321 den “Tag der Sonne“ als Kult- und Ruhetag eingeführt hatte und das Christentum im Jahr 380 Staatsreligion geworden war, geriet diese innere Selbstverständlichkeit ins Wanken und machte gesetzliche Verpflichtungen notwendig. Als erste Partikularsynode legte die Synode von Elvira zu Beginn des 4. Jahrhunderts in ihrem c. 21 fest, dass ein dreimaliges Fernbleiben von der Sonntagseucharistie zum zeitweisen Ausschluss aus der Gemeinschaft führte. Derartige Disziplinarmaßnahmen und Mahnung fanden sich in der Folge in vielen Partikularsynoden, wobei die erste universalkirchliche Verpflichtung erst mit dem CIC/1917 vorgelegt wurde.
Die besondere Einschärfung der Teilnahme am Herrenmahl sowie die zeitweise Sanktionierung bei Verstoß wurzeln in der ekklesiologischen Bedeutung der Eucharistie und der inneren Verbindung von Christsein und dieser Feier des Sonntags. In der gemeinschaftlichen Feier der Getauften als Volk Gottes wird Christus in seiner Gemeinschaft gegenwärtig und so wird in der Eucharistie „als Sakrament der Güte, als Zeichen der Einheit, als Band der Liebe“ (SC 47) die Identität der Kirche und ihrer Glieder sichtbar. Aus dieser Eucharistiefeier als Quelle und Höhepunkt schöpft das ganze christliche Leben (vgl. LG 11). Die Konzilsväter waren darum bemüht, den eigenen und ursprünglichen österlichen Charakter des Sonntags neu hervorzuheben und griffen hierfür den neutestamentlichen Terminus „Herrentag“ (vgl. Off 1,10) auf. Der Sonntag ist der Tag, an dem die versammelten Christen und Christinnen „das Wort Gottes hören und an der Eucharistie teilnehmen, des Leidens, der Auferstehung und der Herrlichkeit des Herrn Jesu“ gedenken sowie Gott danken (SC 106). Die Eucharistie als Grundlage und Bestätigung des christlichen Lebens sowie die Teilnahme an dieser gemeinschaftlichen Feier am Tag des Herrn selbst als Zeichen der Verbundenheit der christlichen Gemeinschaft begründen das Sonntagsgebot (vgl. KKK 2181f.).
In der Folge dieses Verständnisses formulieren die Konzilsväter in SC 106, dass die Zusammenkunft am Sonntag eine Verpflichtung aller Christinnen und Christen ist. Der Katechismus fasst dies in die kurze Formel: „Du sollst an Sonn- und Feiertagen der heiligen Messe andächtig beiwohnen“ (KKK 2042 bzw. KKK 2180). Dieses erste Kirchengebot steht in Verbindung mit der Pflicht, die gebotenen Feiertage zu halten (vgl. KKK 2043). Um allen Gläubigen in ihren jeweiligen Lebensumständen das Mitfeiern zu ermöglichen, wurde 1965 die Vorabendmesse in Deutschland eingeführt. Zudem wurde mit der Ausweitung der Möglichkeit zur Mehrfachzelebration für Priester, an Sonn- und gebotenen Feiertagen bis zu dreimal (vgl. c. 905 § 2 CIC), eine weitere pastorale Hilfe zur Erfüllung dieser Pflicht gegeben. Die besondere Sorge der Bischöfe um die Heiligkeit der Gläubigen (vgl. c. 387 CIC) hat auch bezüglich des Sonntagsgebots ihren unterschiedlichen Lebenssituationen Rechnung zu tragen und Möglichkeiten zur Teilnahme zu schaffen (vgl. Johannes Paul II., Ap. Schreiben “Dies Domini“ v. 31.3.1998: AAS 90 [1998], 713–766; dt.: VApSt 133, Nr. 49; Direktorium über den Hirtendienst der Bischöfe v. 22.2.2004 (VApSt 173), Nr. 148).
Die eigentliche Normierung dieses Kirchengebots findet sich jedoch erst fast am Ende des vierten Buches über den „Heiligungsdienst der Kirche“, in den cc. 1246–1248 CIC, wo der Gesetzgeber die Feiertage unter dem Titel II „Heilige Zeiten“ behandelt. Der c. 1247 CIC verpflichtet dort in strenger Weise zunächst zur Teilnahme an der Messe an Sonn- und gebotenen Feiertagen, welche die vorrangige Pflicht an diesen Tagen darstellt. In deutlicher Anlehnung an SC 106 qualifiziert zuvor c. 1246 § 1 CIC den Sonntag als den ursprünglichen Feiertag und benennt ebenso einige gebotene Feiertage (vgl. hierzu ergänzend Partikularnorm Nr. 15 der DBK v. 5.10.1995). Im Gegensatz aber zu can. 1248 CIC/1917 wird im geltenden Recht von dies dominica in der Singularform gesprochen. Nicht mehr die Einhaltung der Pflicht an jedem einzelnen Sonntag steht damit im Zentrum der Aussage, sondern die Qualität des Sonntags selbst. Dies kann auch die Diskussion um die Häufigkeit der Teilnahme etwas entschärfen, wobei zu berücksichtigen bleibt, dass nur schwerwiegende Gründe als Entschuldigung anerkannt werden. Die Gläubigen – dies meint Kleriker und Laien, die das siebte Lebensjahr vollendet haben – haben daher grundsätzlich an Sonntagen die Eucharistie zu feiern. Die Teilnahme an der Messe umfasst, das betonten schon die Konzilsväter, die Teilnahme am Tisch des Wortes sowie am Tisch des Brotes (vgl. SC 56), die Formulierung Eucharistiam participantes in SC 106 wurde aber bewusst gewählt, um den Kommunionempfang nicht verpflichtend vorzuschreiben. In diesem Sinne spricht auch c. 1248 § 1 CIC von der Teilnahme an der Messe, sodass hierin kein Widerspruch zur Minimalanforderung der jährlichen Osterkommunion nach c. 920 CIC (vgl. dazu auch den Kanon des Monats Nr. 14, Juni 2019) zu sehen ist. Dennoch geht es um tatsächliche, tätige participatio im Sinne von SC 48 und cc. 835, 898 CIC, wenn auch diese Vorgaben nur auf den inneren, personalen und interpersonalen Vollzug der Feier hinwirken, ihn jedoch nicht mit rechtlichen Mitteln erzwingen können. Zur Erfüllung der Sonntagspflicht ist die Teilnahme an einer katholischen Messe verlangt (vgl. c. 1248 § 1 CIC), wobei die Wahl des liturgischen Ritus (vgl. dazu auch c. 214 CIC) bei den Gläubigen liegt. Ebenso besteht kein Diözesan- oder Pfarrzwang mehr. Andere liturgische Feiern wie beispielsweise Wortgottesdienste genügen der Verpflichtung nicht und sind nur empfohlen, sofern die Teilnahme an einer Eucharistiefeier unmöglich ist (vgl. c. 1248 § 2 CIC; auch das Direktorium zur Ausführung der Prinzipien und Normen über den Ökumenismus v. 25.3.1993 (VApSt 110), Nr. 115 verweist auf die sonntäglich gebotene Eucharistieteilnahme). Der Kodex benennt als einen Entschuldigungsgrund für die Messteilnahme das Fehlen geistlicher Amtsträger; im Katechismus wird ebenso auf gewichtige Gründe zum Fernbleiben verwiesen, wie beispielhaft Krankheit und die Betreuung von Säuglingen (vgl. KKK 2181).
Ein wenig überraschen können in c. 1247 CIC die nachgeordneten Verpflichtungen, die unter dem Stichwort „Arbeitsruhe“ zusammenzufassen sind: Die Enthaltung von Werken und Tätigkeiten, die den Gottesdienst, die dem Sonntag eigene Freude oder die Geist und Körper geschuldete Erholung hindern könnten. Gegenüber can. 1248 CIC/1917, wo noch das Fernhalten von knechtlicher Arbeit, gerichtlichen Akten, ggf. öffentlichen Handelsgeschäften, Märkten und anderen Kaufs- und Verkaufsgeschäften im Vordergrund stand, hat der Gesetzgeber die eher allgemeinen Formulierungen aus SC 106 „Tag der Freude und des Freiseins von Arbeit“ aufgegriffen. Den Kodexvätern war es jedoch, obwohl vermutlich auch die Möglichkeit bestanden hätte hier eine Verknüpfung zum Sabbatgebot vorzunehmen, wichtig herauszustellen, dass die Arbeitsruhe nicht im göttlichen Recht begründet ist und somit Ausnahmen und Dispenserteilungen zulässig sind (vgl. Comm 35 [2003], 122), insbesondere bezüglich drängender oder sogar lebensnotwendiger Aufgaben. Ebenso wurde bewusst von weiteren Präzisierungen oder Hinzufügungen beispielsweise einer Empfehlung zum Stundengebet oder anderen frommen Übungen abgesehen. Vielmehr gibt der jetzige Text einen Rahmen für die Gestaltung und Entfaltung einer eigenen „Sonntagsspiritualität“. Die daraus resultierenden Anfragen an die Gestaltung des Sonntags scheinen gerade in dieser schnellen, medialen Zeit dauerhafter Verfügbarkeit notwendig: Schreibe, lese, beantworte ich Arbeits-E-Mails auch am Sonntag? Sitze ich sonntags an meiner Hausarbeit, Dissertation, einem Artikel oder bereite ich die Vorlesung in der kommenden Woche vor? Im Apostolischen Schreiben “Dies Domini“ macht Johannes Paul II. deutlich, dass der Sonntag „als ganzer vom dankbaren und aktiven Gedächtnis der Werke Gottes geprägt“ (Nr. 52) sein soll und entfaltet die verschiedenen Dimensionen dieses Tages: Er ist geprägt von der Gottesverehrung, die auch in Gebetsinitiativen, Katechese oder Wallfahrten mit der Familie ihren Ausdruck finden kann (vgl. ebd.); er ist ein notwendiger Tag der Ruhe von jeglicher Form von Arbeit, des miteinander Ausruhens, des bewussten Anschauens der eigenen Sorgen und Bedürfnisse, der Gespräche mit Menschen; der Wahrnehmung der Nächsten und der Schöpfung (vgl. Nrn. 64–68); und es ist ein Tag der Solidarität in der Gemeinschaft und darüber hinaus (vgl. Nrn. 69–73). Die Freude der Auferstehung soll den ganzen Sonntag und die ganze Woche prägen und erschöpft sich nicht in oberflächlichem und flüchtigem Vergnügen, sondern sie soll vielmehr trostreich und dauerhaft sein (Nr. 57).
Eine wohltuende und erfüllende Perspektive, die Johannes Paul II. hier der Gestaltung des Sonntags gibt. Vielleicht konnten Sie in Ihrer Urlaubszeit gerade diesen Dimensionen Ihres Lebens Raum geben. Und dennoch bleibt die Frage: Was sind denn nun die Konsequenzen einer Nichtbeachtung insbesondere der vordringlichen Sonntagspflicht, die Messe zu besuchen? Nach dem Katechismus der katholischen Kirche stellt ein absichtliches Pflichtversäumnis eine schwere Sünde dar (vgl. KKK 2181). Hierin wird deutlich, dass diese Pflicht vor Gott und im eigenen Gewissen besteht. Auch die rechtliche Normierung ist in diesem Sinne als Appell an das Gewissen eines jeden Gläubigen zu verstehen, zugleich sieht aber weder c. 1247 noch das kirchliche Strafrecht eine Sanktionierung bei einem Normverstoß vor. Die Intention des Gesetzgebers scheint es eher zu sein, mit diesem Gebot das eigentlich im inneren, persönlichen Bereich der Gläubigen liegende, aus der Taufe kommende, christliche Bedürfnis in Gemeinschaft Eucharistie zu feiern, eben mit diesem inneren Verpflichtungsgrad zu artikulieren. Eine Missachtung dieser Pflicht ist zwar ein Gesetzesverstoß, doch der Gesetzgeber belässt es beim Gewissensappell, verzichtet auf die Festlegung einer Rechtsfolge und gibt somit der verantwortlichen Autonomie sowie der freien Entscheidung des und der Einzelnen Raum. Zudem ist der vorgegebene Rahmen zur Gestaltung des Sonntags sowie zum Fernbleiben von der Messe aus bestimmten Gründen auch im geltenden Recht umfangreich und die fehlende Sanktion verhindert einen maßregelnden Eingriff von außen. Die rechtliche Regelung kann zum einen ein Bewusstwerden der Verpflichtung sowie eine Motivation zu ihrer Erfüllung leisten; zum anderen qualifiziert sie moralische Werte als auch rechtlich relevante und zu schützende Güter. Dies kann überall dort wichtig werden, wo der Gesetzgeber aufgrund der besonderen Aufgabe innerhalb der kirchlichen Gemeinschaft beispielsweise auch die Forderung eines christlichen Lebens als Voraussetzung zur Übernahme von Aufgaben und Ämtern stellt. Zugleich resultiert aus dem rechtlichen Schutz aber jene Verpflichtung aller Verantwortlichen, den Gläubigen die Teilnahme und Mitfeier der Eucharistie auch zu ermöglichen, ihre jeweiligen Lebens- und Arbeitssituation ernst zu nehmen und ihnen in Verkündigung, Katechese sowie im seelsorglichen Handeln den Inhalt und die Bedeutung der sonntäglichen Eucharistiefeier näher zu bringen.
“Loci Ordinarius, itemque Superior competens, facultatem ad confessiones excipiendas habitualiter concessat ne revocet nisi gravem ob causam.”
„Der Ortsordinarius und ebenso der zuständige Obere dürfen die auf Dauer verliehene Befugnis zur Entgegennahme von Beichten nur aus schwerwiegendem Grund widerrufen.“
von Martin Rehak
„Verkünde das Wort, tritt auf, ob gelegen oder ungelegen …“ (2 Tim 4,2).
„‚Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Sieben Mal?‘ Jesus sagte zu ihm: ‚Nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal‘“ (Mt 18,21f.).
Der tragische Fall des Münsteraner Ruhestandsgeistlichen Ulrich Zurkuhlen (Z.), dessen Predigt am 30.06.2019 über das Thema „Vergebung“ dazu geführt hat, dass der Bischof von Münster, Felix Genn, ihm am 10.07.2019 die Predigtbefugnis sowie die Beichtbefugnis entzog, ihm öffentliche Zelebrationen der Messfeier verbot, und seine Ruhestandsbezüge kürzte, bietet reichlich Stoff für theologische und kirchenrechtliche Nachbetrachtungen.
Der Sachverhalt
Der disziplinären Entscheidung des Münsteraner Oberhirten lag – soweit sich dies aus elektronischen Medien leicht rekonstruieren lässt (vgl. insbesondere hier, hier, hier, hier, hier, hier und hier) – in etwa folgender Sachverhalt zugrunde:
Just zu einem Zeitpunkt, in dem die Aufdeckung eines länger zurückliegenden Missbrauchsfalls in Bocholt-Barlo bzw. Recklinghausen das Bistum Münster in Aufregung versetzte (vgl. hier, hier und hier), hatte Z. in einer frei gehaltenen Predigt zunächst – ausgehend von Lästereien zweier Frauen über ihre Ex-Männer, deren Ohrenzeuge er geworden war – allgemein das Thema Vergebung behandelt und dann im Blick auf einen befreundeten, des sexuellen Missbrauchs beschuldigten Priester sinngemäß angemerkt, dass es an der Zeit sei, „dass unsere kirchlichen Hierarchen doch auch den Missbrauchs-Tätern irgendwann vergeben würden.“ Daraufhin soll sich lautstarker Protest erhoben haben („Es wurde laut und hektisch im Altarbereich – das ging überhaupt nicht mehr“, vgl. hier), der Pfarrer Z. nach eigenen Angaben zum Abbruch der Predigt nötigte, während ungefähr 30 oder 70 Personen das Gotteshaus verließen und auf dem Kirchplatz über die Predigt diskutierten. Berichtet wird ferner, dass auch von Missbrauch Betroffene am Gottesdienst teilgenommen haben, ohne dass Pfarrer Z. um deren Vorgeschichte wusste. Im Nachgang zu diesem Vorfall nahm Pfarrer Z. eine zunehmend hartnäckige Haltung ein. Zunächst beklagte er sich über den „Mob“, der kollektives Losbrüllen einer sachlichen Diskussion vorgezogen habe, und hielt an seiner Kritik an jenen Bischöfen fest, die straffällig gewordene Priester nur noch als „Verbrecher“ ansähen, ohne ihr sonstiges seelsorgliches Wirken zu würdigen, und die jenen Priestern gegenüber nicht zur Vergebung bereit wären. Am 05.07.2019 kam es daraufhin zu einem ersten Gespräch zwischen Z. und Bischof Genn, in welchem der Bischof den Z. darum bat, freiwillig von weiterer Predigttätigkeit Abstand zu nehmen. Am 08.07.2019 wurde in der Pfarrei, in der Z. tätig war, ein Gesprächsabend abgehalten, an dem etwa 120 Personen teilnahmen, die in der Reflexion der umstrittenen Predigt fehlende Sensibilität und Opfernähe beklagten. Am selben Tag verteidigte Z. auf seiner Homepage die umstrittene Predigt (vgl. hier) und gab am 09.07.2019 u.a. dem WDR ein Interview, das am selben Tag ausgestrahlt wurde, und in welchen er sinngemäß erklärte: Es wundere ihn, dass Opfer Jahre und Jahrzehnte damit gewartet haben, ihre Missbrauchserfahrungen zu offenbaren. Und es sei verwunderlich, dass betroffene Kinder keine räumliche Distanz zu missbrauchenden Priestern geschaffen hätten, sondern immer wieder zu ihnen gegangen seien. Möglicherweise seien also die fraglichen Erfahrungen tatsächlich nicht so tragisch gewesen. Spätestens jetzt wandte sich der Pfarreirat der örtlichen Kirchengemeinde von Z. ab und forderte dessen Ablösung als mitwirkender Priester. Hieraus zog Bischof Genn, fassungslos über die offenbare Ignoranz von Z. in Bezug auf Täterstrategien und Opferleid sowie über Äußerungen, die von Betroffenen nur als Verhöhnung aufgefasst werden könnten, die kirchenrechtlichen Konsequenzen: „Es geht jetzt nicht um Vergebung für die Täter, sondern um Gerechtigkeit – soweit das überhaupt und ansatzweise möglich ist – für die Opfer. Nulltoleranz gegenüber dem Verbrechen sexuellen Missbrauchs heißt für mich auch Nulltoleranz gegenüber solchen unsäglichen Äußerungen, wie sie der Priester getätigt hat“ (vgl. hier).
Theologisches
Der am Rande dieser Eskalation u.a. zwischen Z. und dem leitenden Pfarrer Stefan Rau geführte theologische Disput, ob im Verhältnis zwischen Opfer und Täter die fünfte Bitte des Vaterunser-Gebets Geltung beansprucht; oder ob umgekehrt „niemand […] ein Recht auf Vergebung habe oder […] sie von Gott oder auch von den Opfern verlangen [könne]“ (vgl. hier), ist hier nicht zu vertiefen. Gestattet sei allerdings der Hinweis auf c. 980 CIC, wonach ein Beichtvater – der insoweit an der Stelle Gottes handelt – kirchenrechtlich verpflichtet ist, einem recht disponierten, sprich insbesondere einem reuigen Sünder die Absolution zu erteilen und so die Vergebung der Sündenschuld vor Gott zuzusprechen.
Die bischöfliche Disziplinarentscheidung
Stattdessen sei die Frage beleuchtet, wie die Entscheidungen des Bischofs – Entzug der Predigtbefugnis, Verbot öffentlicher Zelebrationen und Kürzung der Bezüge, Widerruf der Beichtfakultas – kirchenrechtlich zu würdigen sind: Aufgrund welcher rechtlichen Grundlagen konnte Bischof Genn in der geschilderten Weise gegen Z. vorgehen?
Gemäß c. 764 CIC haben Priester die Befugnis, überall zu predigen. Diese Befugnis kann jedoch, ebenfalls gemäß c. 764 CIC, vom zuständigen Ordinarius eingeschränkt oder entzogen werden. Dass Bischof Genn im vorliegenden Fall ein zuständiger Ordinarius ist (vgl. dazu c. 134 CIC), kann nicht zweifelhaft sein. Ein besonderer Grund für den Entzug oder die Beschränkung der Predigtbefugnis ist im kodikarischen Verkündigungsrecht nicht verlangt. Lediglich aus c. 51 CIC ergibt sich für alle Verwaltungsbefehle, die dem Adressaten ein bestimmtes Tun oder Unterlassen auferlegen (vgl. dazu c. 49 CIC), eine summarische Begründungspflicht. Dieser Begründungspflicht dürfte der Bischof bereits in nachvollziehbarer und hinreichender Weise mit seiner Erklärung aus der Pressekonferenz vom 10.07.2019 genügt haben, er wolle verhindern, dass Z. „weiterhin die Betroffenen mit seinen unsäglichen Thesen belästigt“.
Problematischer ist es, eine kodikarische Rechtsgrundlage für das Verbot öffentlicher Zelebrationen sowie eine Kürzung der Ruhestandsbezüge zu finden. Zwar würden sich derartige Rechtsfolgen etwa aus der Verhängung der Beugestrafe der Suspension (vgl. c. 1333 § 1 Nr. 2 CIC: Verbot der Ausübung der Weihegewalt) und der Sühnestrafe des Entzugs von Rechten (vgl. c. 1336 § 1 Nr. 2 CIC) ergeben. Ferner kann gemäß c. 1722 auch bereits während eines anhängigen Strafprozesses der Ordinarius einem angeklagten Priester u.a. die öffentliche Teilnahme an der Eucharistiefeier untersagen. Es ist jedoch weder ersichtlich, dass Z. eine Straftat im Sinne des kanonischen Rechts begangenen hätte, was Voraussetzung für den Eintritt einer Beugestrafe wäre; noch dass ein Strafverfahren gegen ihn durchgeführt worden wäre, was Voraussetzung für die Verhängung einer Sühnestrafe wäre; noch dass ein Strafverfahren gegen Z. eröffnet worden wäre. Endlich würde zwar die Norm des c. 1741 Nr. 3 CIC im vorliegenden Fall eine Absetzung des Z. als Pfarrer rechtfertigen. Zu bedenken ist jedoch zum einen, dass Z. als mitwirkender Priester zwar offenbar den persönlichen Titel „Pfarrer“ führte, ohne freilich dadurch bereits Pfarrer im Sinne der cc. 519–534 CIC zu sein; und zum anderen, dass eine Absetzung als Pfarrer und ein Verbot öffentlicher Zelebrationen zwei sehr verschiedene Maßnahmen sind.
Eine Rechtsgrundlage für die Kürzung der Bezüge findet sich jedoch in der einschlägigen Priesterbesoldungs- und -versorgungsordnung (PrBVO) des Bistums Münster vom 15.03.2019 (Abl Münster CLIII [2019] 71–78). Gemäß § 11 PrBVO erlischt ein Besoldungsanspruch der Priester im aktiven Dienst bei Eintritt in den Ruhestand, bei eigenmächtiger Aufgabe der übertragenen Dienste ohne Zustimmung des Bischofs, sowie immer dann, wenn dem Priester die weitere Ausübung seines Dienstes untersagt wird. Gemäß § 18 Ziff. 2 PrBVO erlischt „ein Anspruch auf Ruhegehalt […], wenn Umstände eintreten, die gemäß § 11 zum Erlöschen des Anspruchs auf Besoldung führen würden“. Die sich hier anschließende Frage, unter welchen Umständen der Bischof einem Priester zu Recht die weitere Ausübung seines Dienstes untersagt, liegt verständlicher Weise jenseits der Thematik einer Priesterbesoldungsordnung. Die Regelung des c. 900 § 2 CIC legt insoweit allerdings nahe, dass sich ein Zelebrationsverbot stets auf eine gesetzliche Grundlage im Kirchenrecht stützen muss. Auch wenn deutlich geworden ist, dass der Bischof den Z. für ungeeignet zum seelsorglichen Dienst erachtet, bleibt die (rechtliche) Begründung des Zelebrationsverbots letztlich eher unklar und man könnte den Eindruck gewinnen, die Maßnahme sei vor allem deshalb getroffen worden, weil sie die conditio sine qua non für die Kürzung der Ruhestandsbezüge ist.
Was nun den „Entzug“ der Beichtbefugnis anbelangt, so sei zunächst darauf hingewiesen, dass das kodikarische Recht begrifflich zwischen der „Verwehrung der Ausübung“ der Beichtbefugnis im Einzelfall (vgl. dazu c. 967 § 2 CIC) und dem „Widerruf“ der Beichtbefugnis unterscheidet, wobei die Maßnahme des Bischofs erkennbar auf letzteres abzielt; sedes materiae ist damit die Norm des c. 974 CIC. Das geltende Recht ist – im Bruch mit der seit jeher bis ins 20. Jh. hinein üblichen, streng territorialen Begrenzung (vgl. dazu cann. 873 § 1, 874 § 1 CIC/1917) – so konzipiert, dass von der einmal von einem Ordinarius verliehenen Beichtbefugnis grundsätzlich weltweit Gebrauch gemacht werden kann. Von daher differenziert c. 974 § 2 CIC danach, ob der Widerruf einer Beichtbefugnis durch den ursprünglich verleihenden Ortsordinarius (bzw. dessen Amtsnachfolger) oder durch einen anderen Ortsordinarius erfolgt. Im ersten Fall erlischt die Beichtbefugnis weltweit, im zweiten Fall nur im Gebiet des anderen Ortsordinarius. Vorliegend wird man wohl davon ausgehen können, dass Z. seine Beichtvollmacht einst von einem Amtsvorgänger des jetzigen Bischofs von Münster erhalten hatte; der nunmehrige Widerruf („Entzug“) führt somit zum Totalverlust dieser Vollmacht. Sofern – wovon ebenfalls auszugehen ist – die einstige Verleihung der Beichtbefugnis an Z. auf unbestimmte Zeit, also dauerhaft erfolgte, kann diese Befugnis gemäß c. 974 § 1 allerdings nicht ohne weiteres widerrufen werden. Das Gesetz verlangt vielmehr das Vorliegen eines „schwerwiegenden Grundes“. Diese Regelung „soll sowohl Priester wie auch Gläubige vor Willkür schützen“ (MKCIC-Althaus, c. 974, Rz. 3). Der „schwerwiegende Grund“ ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der sich als solcher jeder endgültigen Festlegung entzieht. Hilfreich für eine praktische Handhabung mag oftmals das Bild von einer Waage mit zwei Waagschalen sein: Schwerwiegend wäre demnach jedenfalls ein solcher Grund, der jene Gründe, die für eine Belassung der Beichtbefugnis streiten, überwiegt. Zu Recht merkt daher Rüdiger Althaus an: „Der für den Widerruf vorgetragene Grund mag unterschiedlich beurteilt und ggf. im Wege des hierarchischen Rekurses geprüft werden“ (ebd.). Auch deshalb ist jedoch das objektive Vorliegen eines schwerwiegenden Grundes keine Voraussetzung für die (einstweilige) Rechtswirksamkeit des Widerrufs (bis zur eventuellen Kassation durch die Entscheidung im hierarchischen Rekurs gem. cc. 1737–1739 CIC).
Soweit ersichtlich, hat der Bischof in seiner Pressekonferenz vom 10.07.2019 nicht explizit dargelegt, aus welchem, seines Erachtens schwerwiegenden Grund er vorliegend die Beichtfakultas des Z. widerrufen hat. Zwei durchaus gewichtige Begründungsansätze liegen jedoch auf der Hand: Zum einen eine gewisse Besorgnis mangelnder Sensibilität im Beichtgespräch, insbesondere gegenüber Gläubigen, die leidvolle Erfahrungen aller Art schildern. (Ob man mit diesem Begründungsansatz einem bewährten Geistlichen wie Ruhestandspfarrer Z. gerecht wird, sei dahingestellt.) Zum anderen – was im Lichte einer erklärten Null-Toleranz-Politik durchaus von Gewicht sein dürfte – die Besorgnis eines ungerechtfertigten Laxismus gegenüber Tätern, die ihre Schuld bei Z. beichten und von ihm die Absolution erhalten möchten.
Kanonistisches
Der Fall Zurkuhlen bietet über eine Diskussion der bischöflichen Disziplinarentscheidung hinaus allerdings noch weiteren kirchenrechtlichen Gesprächsstoff.
Zwar sind dem Z. vor allem seine nachfolgenden Interviews und weniger die ursprüngliche Predigt zum Verhängnis geworden. Die Angelegenheit macht jedoch darauf aufmerksam, dass das Thema der Qualitätssicherung beim Predigen von höchster Aktualität und Wichtigkeit ist. Auf eine kürzliche Publikation hierzu von kirchenrechtlicher Warte sei hingewiesen: Heribert Hallermann, Die Qualitätssicherung der Predigt als Aufgabe des Kirchenrechts, in: Thomas Meckel, Matthias Pulte (Hg.), Ius semper reformandum. Reformvorschläge aus der Kirchenrechtswissenschaft, Paderborn 2018, 167–195.
Der Bischof hat in Bezug auf die Ruhestandsbezüge in seiner Entscheidung den allgemeinen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit offenbar insofern gewahrt, als die Bezüge nur gekürzt, aber nicht vollständig gestrichen wurden. Letzteres wäre im Übrigen mit dem bestehenden Inkardinationsverhältnis zwischen Bischof und Priester, durch das eine auch in Konfliktfällen wie dem vorliegenden fortdauernde Fürsorgepflicht des Bischofs begründet ist, unvereinbar (vgl. dazu auch c. 1350 § 2 CIC, wonach ein Ordinarius sogar dazu verpflichtet ist, für das Existenzminimum eines aus dem Klerikerstand Entlassenen, in welchem Falle also das Inkardinationsverhältnis aufgelöst ist, Sorge zu tragen).
Für die Kirche war die Herausbildung des monarchischen Episkopats, durch welchen (in heutiger Sichtweise) gesetzgeberische, verwaltende und richterliche Befugnisse in der Hand des einen und einzigen Bischofs konzentriert wurden, ein Akt der Professionalisierung der kirchlichen Leitung gewesen. Es war seither jahrhundertelang das Privileg und die Bürde des Diözesanbischofs, schwere Entscheidungen in der Verwaltung seines Bistums zur treffen (während die Rechtsprechung schon seit dem Mittelalter kaum noch persönlich, sondern regelmäßig durch Gerichtsvikare ausgeübt wurde). Unter dem Einfluss moderner, auf der Gewaltenteilung basierender Staatskonzepte erscheint gegenwärtig die Einführung einer dezentralen kirchlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit vielen als Gebot der Stunde und Mittel für eine heutige Professionalisierung der kirchlichen Leitung. Auch wenn eine Debatte über die genauen Zuständigkeiten und Kompetenzen einer dezentralen, auf der Ebene der Bistümer oder der Bischofskonferenz angesiedelten Verwaltungsgerichtsbarkeit noch nicht geführt ist, steht doch zu erwarten, dass im Falle ihrer Einführung über Entscheidungen wie die vorliegende dann nicht mehr erstinstanzlich vor dem fachlich zuständigen Dikasterium der Römischen Kurie (hier: Kleruskongregation), sondern eben einem Verwaltungsgericht des Bistums oder der Bischofskonferenz geurteilt wird. Ob sich indes die Kirche mit einer weiteren Verrechtlichung, die mit der Möglichkeit dezentraler gerichtlicher Überprüfung kirchlicher Verwaltungsentscheide einhergehen dürfte, einen Gefallen tut, kann danach nur die Zukunft zeigen. Es ist bemerkenswert, dass sich gerade Bischof Genn im Nachgang zum Fall Zurkuhlen sehr wohlwollend zu dieser Thematik geäußert hat; aus einem Brief an Pfarreiräte und Kirchenvorstände wird er mit den Worten zitiert: „Als Bischof bin ich dazu bereit, auch meinerseits Macht abzugeben und mich beispielsweise auch einer kirchlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit unterzuordnen“ (siehe hier). Vielleicht spricht aus diesen Worten das Selbstvertrauen jenes Bischofs, der – kirchenrechtlich gut beraten – die gerichtliche Überprüfung seiner Entscheidungen nicht zu fürchten braucht.
Epilog
Kann eigentlich nach alledem Pfarrer Zurkuhlen von Bischof Genn Vergebung erwarten?
In seiner Pressekonferenz vom 10.07.2019 erklärte der Bischof, er erwarte von seinem Priester „eine glaubhafte schriftliche Entschuldigung gegenüber den Betroffenen, gegenüber der Gemeinde, den Kolleginnen und Kollegen, gegenüber all den Menschen, die er verletzt hat“. Für den Verfasser dieses Beitrags klingt das nach jener „goldenen Brücke“, die bei demütiger Erbringung der so geforderten Vorleistung auf eine Versöhnung der Konfliktparteien hoffen lässt.
c. 29 CIC
„Decreta generalia, quibus a legislatore competenti pro communitate legis recipiendae capaci communia feruntur praescripta, proprie sunt leges et reguntur praescriptis canonum de legibus.“
„Allgemeine Dekrete, durch die von dem zuständigen Gesetzgeber für eine passiv gesetzesfähige Gemeinschaft gemeinsame Vorschriften erlassen werden, sind im eigentlichen Sinn Gesetze und unterliegen den Vorschriften der Canones über die Gesetze.“
von Martin Rehak
Am 31. Mai diesen Jahres verlautbarte der Vatikanische Pressesaal eine nicht gerade alltägliche Meldung, nämlich den Erlass des Allgemeinen Dekrets Visto il Chirografo vom 22.05.2019 durch den Kardinalstaatssekretär, welches sich mit der Rechtsstellung der Caritas Internationalis befasst.
Der Vorgang bietet Gelegenheit, folgenden zwei Fragen nachzugehen: Was sind Allgemeine Dekrete? Und was ist die Caritas Internationalis bzw. worum geht es in dem besagten Dekret konkret?
Um auf die erste Frage einzugehen, sei zunächst die Typologie der kanonischen Rechtsordnung in Erinnerung gerufen, wie sie sich insbesondere aus dem Aufbau des ersten Buchs des Kodex, das mit „Allgemeine Normen“ überschrieben ist, ergibt. Dieses Buch ist in insgesamt elf Titel gegliedert, von denen hier im Wesentlichen nur die ersten fünf Titel interessieren. Denn dort werden fünf Arten des kirchlichen Rechts in den Blick genommen: 1. Gesetzesrecht (cc. 7–22 CIC); 2. Gewohnheitsrecht (cc. 23–28 CIC); 3. Allgemeine Dekrete und Instruktionen (cc. 29–34 CIC); 4. Verwaltungsakte für Einzelfälle (cc. 35–93 CIC); sowie 5. Statuten und Ordnungen (cc. 94–95 CIC).
Dabei sind nach Aymans-Mörsdorf, KanR I, 213, Statuten oder Satzungen „jene rechtlich verbindlichen Ordnungen, die die innere Organisation von personalen oder sächlichen Gesamtheiten […] sowie deren Wirksamkeit nach außen regeln.“ (vgl. dazu auch c. 94 § 1 CIC). Ordnungen sind gemäß c. 95 § 1 CIC solche Regeln und Normen, die bei der Zusammenkunft von bestimmten Personen oder der Durchführung von bestimmten Veranstaltungen hinsichtlich der Verfassung, Leitung und Vorgehensweise einzuhalten sind. Satzungen und Ordnungen können dabei entweder hoheitlich, d.h. vom Gesetzgeber, oder autonom, d.h. von den Normadressaten selbst, erlassen werden. Für Verwaltungsakte ist kennzeichnend, dass sie von jenen erlassen werden können, die wenigstens (ordentliche oder delegierte) ausführende Gewalt (vgl. dazu besonders cc. 134–137 CIC) besitzen. Dabei ist die Verwaltung an die Gesetze gebunden, d.h. der Verwaltungsakt muss gesetzmäßig sein (vgl. Aymans-Mörsdorf, KanR I, 227). Instruktionen dienen dazu, bestehende Gesetze näher zu erläutern (vgl. c. 34 CIC). Daneben können zur näheren Regelung der Anwendung von Gesetzen sogenannte Allgemeine Ausführungsdekrete ergehen (vgl. cc. 31–33 CIC). Gewohnheitsrecht entsteht, wenn eine Gewohnheit vom zuständigen Gesetzgeber gebilligt wird oder wenn eine Gewohnheit, die auch außer- oder widergesetzlich sein kann, mindestens 30 Jahre lang unbeanstandet von der kirchlichen Autorität von einer passiv gesetzesfähigen Gemeinschaft, die also Normadressat eines entsprechenden Gesetzes sein könnte, geübt wurde (vgl. besonders cc. 23, 25 u. 26 CIC). Gesetze sind allgemeine Regelungen, erlassen von mit Gesetzgebungskompetenz ausgestatteten Autoritäten.
Eine Sonderform des Gesetzes sind die sogenannten General- oder Allgemeinen Dekrete (cc. 29–30 CIC). Ihre momentane systematische Einordnung in die Struktur des ersten Buches des Kodex ist daher problematisch; denn da sie ausdrücklich den Gesetzen gleichgestellt sind, hätten die jetzigen cc. 29–30 CIC wohl besser einen Platz im ersten Titel über die Gesetze gefunden. Ein Unterschied zwischen Gesetz und Allgemeinem Dekret kann nicht darin gesehen werden, dass Gesetzen ein höherer Grad an Stabilität oder ein höherer Grad an Verbindlichkeit zukäme als Allgemeinen Dekreten (vgl. MKCIC–Socha, c. 29, Rz. 9–10). Vielmehr kann auch durch ein Generaldekret bestehendes Gesetzesrecht abgeändert oder aufgehoben werden. Der Begriff „decretum generale“ ist gegenüber dem CIC/1917 neu (vgl. MKCIC–Socha, c. 29, Rz. 1). Allerdings hatte Benedikt XV. schon im Jahre 1917 zugestanden, dass die römischen Kongregationen aus dringendem Anlass ausnahmsweise „decreta generalia“ erlassen können (vgl. ebd.; AAS [1917] 484). Im Zuge der Reform des CIC scheint ein starkes Argument für die Übernahme dieser Kategorie in den neuen Kodex gewesen zu sein, dass die Gesetzgebung seitens Ökumenischer Konzile traditionell durch „Dekrete“ erfolge (vgl. MKCIC–Socha, c. 29, Rz. 1).
Damit lässt sich zusammenfassend festhalten, dass das Generaldekret Visto il Chirografo ein Gesetz ist, das aus Gründen, die letztlich dahinstehen können, als General- oder Allgemeines Dekret firmiert.
Damit zum zweiten Fragenkomplex: Caritas Internationalis ist der Dachverband, unter dem sich aktuell 164 nationale Caritasverbände zusammengeschlossen haben. Wie dem Generaldekret im narrativen Teil (Arenga) zu entnehmen ist, handelt es sich dabei rechtlich um eine juristische Person des Kirchenrechts, der Papst Johannes Paul II. im Jahre 2004 ausdrücklich die Rechtspersönlichkeit verliehen hat, sowie – gemäß einem Dekret aus dem Jahre 1976 – offenbar zugleich um eine juristische Person nach dem Recht des Staates der Vatikanstadt. Zur Frage, ob es sich gemäß der Typologie des kanonischen Rechts näherhin um einen Verein handelt (was nahe liegt), äußert sich die Arenga nicht ausdrücklich, erklärt aber „im Wege der Analogie“ die Normen der cc. 312–316, 317 § 4, 318–320 CIC, also wesentliche Teile des Rechts der öffentlichen Vereine von Gläubigen, für auf Caritas Internationalis anwendbar.
Der normative Teil des Generaldekrets Visto il Chirografo ist in acht Artikel untergliedert.
Gemäß Art. 1 § 1 Visto il Chirografo (im Folgenden: ViC) wird Caritas Internationalis innerhalb der Römischen Kurie ausdrücklich dem Dikasterium für den Dienst zugunsten der ganzheitlichen Entwicklung des Menschen zugeordnet. Dieses Dikasterium war vor drei Jahren von Papst Franziskus, Motu Proprio Humanam progressionem vom 17.08.2016, mit Wirkung vom 01.01.2017 gegründet worden, wobei in dem neuen Dikasterium die Aufgaben von vier zeitgleich aufgelösten bisherigen Päpstlichen Räten – darunter der Päpstliche Rat Cor Unum, dem Caritas Internationalis zu diesem Zeitpunkt unterstand – gebündelt wurden. Von daher hat das Generaldekret in erster Linie die Aufgabe, etwaige Zweifel an den Zuständigkeiten und dem Organigramm der Römischen Kurie (in Bezug auf Caritas Internationalis) zu beseitigen. Zugleich verschärft sich damit die Aufsplitterung des Organisationsrechts der Römischen Kurie auf eine Vielzahl von Rechtsquellen und wird damit die Notwendigkeit einer umfassenden Novellierung des derzeitigen Organisationsgesetzes, nämlich der Apostolischen Konstitution Pastor Bonus vom 28.06.1988, welche durch diverse Änderungen unter Papst Benedikt XVI. und Papst Franziskus in etlichen Teilen überholt ist, deutlich.
Art. 1 § 2 ViC erinnert daran, dass die Position von Caritas Internationalis in Fragen der Lehre und der Moral mit der Position des Apostolischen Stuhls übereinstimmen müsse. Im Anschluss enthalten die §§ 3–7 weitere Ausführungen zu den Befugnissen, die das Dikasterium gegenüber Caritas Internationalis hat.
Art. 2 und Art. 3 ViC befassen sich mit den Kompetenzen, die dem Staatssekretariat in Bezug auf Caritas Internationalis zukommen, wobei innerhalb des Staatssekretariats zwischen der Sektion für die Allgemeinen Angelegenheiten und der Sektion für die Beziehungen mit den Staaten differenziert wird. Art. 4 § 1 ViC erklärt für die Ordnung der Arbeitsbeziehungen zwischen den Beteiligten das Regolamento del Personale del Segretariato Generale di Caritas Internationalis sowie weitere anwendbare Gesetze für maßgeblich; bei letzteren dürfte wohl vor allem an das Regolamento Generale della Curia Romana gedacht sein. Gemäß Art. 4 § 2 ViC ist für die gerichtliche Entscheidung etwaiger Streitigkeiten, unbeschadet der Kompetenzen der Römischen Rota, das Gericht des Staates der Vatikanstadt zuständig.
Art. 5 ViC verpflichtet den Präsidenten, den Generalsekretär sowie den Schatzmeister von Caritas Internationalis, bei ihrem Amtsantritt gegenüber dem Präfekten des Dikasteriums für den Dienst zugunsten der ganzheitlichen Entwicklung des Menschen ein Versprechen abzulegen, dessen genauer Wortlaut in einem Anhang zum besagten Generaldekret fixiert ist (und der vom Vatikanischen Pressesaal nicht publiziert wurde). Allerdings ist der Präsident dann vom Ablegen dieses Versprechens befreit, wenn er Kardinal oder Diözesanbischof ist.
Art. 6 ViC fordert Caritas Internationalis zu guter Zusammenarbeit insbesondere mit dem Dikasterium für den Dienst zugunsten der ganzheitlichen Entwicklung des Menschen und mit dem Staatssekretariat, aber auch mit den Ständigen Gesandtschaften, die der Apostolische Stuhl insbesondere bei den Vereinten Nationen und deren Unterorganisationen unterhält, auf. Für den Fall einer Verletzung der vorstehend geregelten Obliegenheiten droht Art. 7 ViC die Sanktionen der Suspendierung oder Amtsenthebung an.
Abschließend widmet sich Art. 8 formalen Fragen. Caritas Internationalis wird aufgefordert, ihr internes Recht dem neuen Generaldekret anzupassen. Die Regelung zum Inkrafttreten ist wohl so zu verstehen, dass Visto il Chirografo nach der gemäß c. 8 CIC vorgesehenen Gesetzesschwebe von drei Monaten in Kraft tritt, wobei diese Frist jedoch nicht mit der Veröffentlichung des Generaldekrets in den Acta Apostolicae Sedis, sondern im L’Osservatore Romano anläuft. Diese Veröffentlichung ist am 31.05.2019 erfolgt (vgl. OR 159 [2019] Nr. 124 v. 31.5.2019, S. 6).
Kommen wir abschließend nochmal auf das Recht der Generaldekrete im Allgemeinen und hier auf die Frage zurück, ob eigentlich der Kardinalstaatssekretär überhaupt befugt war, das Dekret Visto il Chirografo zu erlassen. Ausgehend vom Recht der Apostolischen Konstitution Pastor Bonus (im Folgenden: PB) könnte dem die Regelung aus Art. 18 Abs. 2 PB entgegenstehen, wonach Dikasterien (einschließlich des Staatssekretariats) ohne Sondervollmachten weder Gesetze noch allgemeine Dekrete mit Gesetzeskraft, also Generaldekrete im Sinne der cc. 29–30 CIC, erlassen können. Demgegenüber ist jedoch zu berücksichtigen, dass dem Kardinalstaatssekretär wohl eine Sondervollmacht nach Art. 18 Abs. 2 PB zur Seite stand, die sich aus einem so genannten Rescriptum ex audientia Sanctissimi vom 17.01.2011 (vgl. AAS 103 [2011] 127) – also aus einer zunächst vom Papst anlässlich einer Audienz mündlich zugestandenen Vollmacht, die anschließend vom Bevollmächtigten verschriftlicht wurde – ergibt, wonach also der Kardinalstaatssekretär bevollmächtigt ist, Fragen zur Rechtsstellung der Caritas Internationalis zu klären und dazu erforderlichenfalls Normen zu erlassen. Außerdem hat, wie ebenfalls in Art. 8 ViC eigens vermerkt ist, sich Papst Franziskus das Allgemeine Dekret seines Kardinalstaatssekretärs durch eine „approbatio in forma specifica“ (vgl. dazu Art. 18 Abs. 2 PB; Art. 126 Regolamento Generale della Curia Romana) zu eigen gemacht.
c. 920 CIC
㤠1. Omnis fidelis, postquam ad sanctissimam Eucharistiam initiatus sit, obligatione tenetur semel saltem in anno, sacram communionem recipiendi.
§ 2. Hoc praeceptum impleri debet tempore paschali, nisi iusta de causa alio tempore intra annum adimpleatur.“
„§ 1. Jeder Gläubige ist, nachdem er zur heiligsten Eucharistie geführt worden ist, verpflichtet, wenigstens einmal im Jahr die heilige Kommunion zu empfangen.
§ 2. Dieses Gebot muss in der österlichen Zeit erfüllt werden, wenn ihm nicht aus gerechtem Grund zu einer anderen Zeit innerhalb des Jahres Genüge getan wird.“
von Anna Krähe
Der vorliegende Beitrag ist Teil einer Reihe im Rahmen von „Kanon des Monats“, in der in loser Reihenfolge jedes der sogenannten fünf Kirchengebote (vgl. KKK 2041–2043) aus kanonistischer Perspektive betrachtet und bezüglich seiner Verortung und Funktion im geltenden Recht untersucht wird. Bisherige Teile: Teil 1 (c. 1251 CIC; Fasten- und Abstinenzgebot).
Zum Ende des Marienmonats Mai sind mit dem Christi-Himmelfahrts-Fest die letzten Fest- und Freudentage der Osterzeit angebrochen. Auch wenn sich schon das ein oder andere Pfingst-Novenliche Heilig-Geist-Lied in den österlichen Hallelujajubel mischt, darf noch ein paar Tage aus der vollen Auferstehungsfreude geschöpft werden. Bevor es nach dem Pfingstfest dann zurück in den Jahreskreis geht, stellt sich aus kanonistischer Perspektive noch eine wichtige Frage: Haben Sie in dieser Osterzeit eigentlich schon die Kommunion empfangen?
Diese Frage mag für die meisten Leserinnen und Leser dieser Reihe seltsam anmuten, ist doch der Kommunionempfang – richtigerweise – für viele katholische Gläubige ein konstitutiver Bestandteil (nicht nur) der sonntäglichen Eucharistiefeier. Dennoch zeigen sowohl der Katechismus in seinem dritten Kirchengebot (vgl. KKK 2042; ähnlich auch KKK 1389) als auch der Kodex in c. 920 CIC diesbezüglich erstaunliche Zurückhaltung und schreiben lediglich den Mindeststandard des Kommunionempfangs, einmal jährlich, nach Möglichkeit in der Osterzeit, fest.
Bezüglich des Gebots der sogenannten „Osterkommunion“ mag zunächst schon fraglich sein, warum der Gesetzgeber die Häufigkeit des Kommuniongangs überhaupt als regelungsbedürftig ansieht. Für die Christinnen und Christen der Alten Kirche war das gemeinsame eucharistische Mahl ein Konstitutivum ihres Christseins. Ab dem 4. Jahrhundert, teilweise geprägt durch den Arianismus sowie eine zunehmende Ehrfurcht gegenüber den eucharistischen Gestalten, nahm der regelmäßige Kommunionempfang zunehmend ab, sodass dessen Notwendigkeit und Wichtigkeit den Gläubigen immer wieder eingeschärft werden mussten. Das IV. Laterankonzil (1215; vgl. DH 812) verpflichtete alle Gläubigen zum Kommunionempfang wenigstens einmal im Jahr an Ostern; eine Mahnung, die das Konzil von Trient, entgegen der hochmittelalterlichen Praxis der geistlichen Kommunion, nochmals bekräftigte (1545–1563; vgl. DH 1659 sowie DH 1747). Mit detaillierten Regelungen war diese Forderung auch in die cann. 859–861 CIC/1917 eingegangen.
Der c. 920 § 1 CIC verpflichtet nun alle Gläubigen, und somit alle in der katholischen Kirche Getauften oder in sie Aufgenommenen (vgl. c. 11 CIC), die Kommunion einmal im Jahr (vgl. c. 202 CIC) zu empfangen. Neben der Taufe wird hierbei auch vorausgesetzt, dass die Gläubigen schon zur Eucharistie hingeführt worden sind, also eine entsprechende Vorbereitung im Sinne der cc. 913, 914 CIC erfahren haben. Damit ist in der Linie des c. 843 § 2 CIC die entsprechende katechetische Unterweisung gefordert sowie der erstmalige Empfang der Eucharistie vorausgesetzt und nicht mehr, wie noch im CIC/1917, lediglich das Erreichen des Unterscheidungsalters (vgl. zu dieser Änderung in der CIC-Reform: Com 13 [1981], 417f.). Nach c. 920 § 2 CIC muss dieser Kommunionempfang in der österlichen Zeit erfüllt werden, es sei denn, dass ein gerechter Grund vorliegt und die Kommunion zu einer anderen Zeit des Jahres empfangen wird. Mit der österlichen Zeit, die im Kodex nicht definiert wird, aber durch liturgisches Recht geregelt ist, sind die 50 Tage vom Ostersonntag bis zum Pfingstsonntag gemeint (vgl. Calendarium Romanum, Nr. 22). Die österliche Bußzeit ist ausgeschlossen, nicht hingegen die Feier des österlichen Triduums von der Abendmahlsmesse am Gründonnerstag an bis zur Osternacht (vgl. Calendarium Romanum, Nr. 18), da sich das österliche Geheimnis gerade in diesen Tagen entfaltet und insbesondere am Gründonnerstag der Kommunionempfang ein zentraler Bestandteil der Erinnerung an das letzte Abendmahl Jesu ist. In diesem Sinn ist die Verbindung des Kommunionempfangs „mit den Festen der Osterzeit, dem Ursprung und Zentrum der christlichen Liturgie“ (KKK 2042), von besonderer Wichtigkeit.
Auch wenn der Pfarrer nach c. 530 n. 7 CIC regelmäßig die Eucharistie in seiner Pfarrei feiern soll und damit den Gläubigen auch an jedem Sonntag die Möglichkeit zum Kommunionempfang gegeben ist, sind die Gläubigen nicht verpflichtet die Kommunion in ihrer Pfarrei zu empfangen (vgl. zu dieser Änderung: Com 31 [1999], 145). Ebenso müssen die Gläubigen die Kommunion nicht notwendigerweise in ihrem eigenen Ritus empfangen (vgl. c. 923 CIC bezüglich der katholischen Kirchen eigenen Rechts und c. 844 § 2 CIC zum Empfang der Eucharistie in anderen christlichen Kirchen), sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. Eine Verpflichtung zum vorherigen Empfang des Bußsakraments besteht nicht, wobei die Verpflichtung zu dessen einmal jährlichem Empfang dennoch Eingang in den Kodex gefunden hat, c. 989 CIC (vgl. Zweites Kirchengebot, KKK 2042).
Mit c. 920 CIC formuliert der Gesetzgeber eine Mindestanforderung bezüglich des Kommunionempfangs, welche im Katechismus jedoch zugleich mit der nachdrücklichen Empfehlung, „die heilige Eucharistie an den Sonn- und Feiertagen oder noch öfter, ja täglich zu empfangen“ (KKK 1389), verbunden wird. Im Hintergrund steht SC 55,1, wonach mit dem Empfang des gleichen Herrenleibes nach der Kommunion des Priesters eine „vollkommenere Teilnahme an der Messe“ verwirklicht wird. Dies bedeutet zum einen, dass Priester und Gläubige Leib und Blut aus der gleichen Feier zu sich nehmen, es meint zum anderen aber auch, dass die Kommunion in der Messfeier selbst empfangen werden soll (vgl. heute c. 918 CIC, wobei eine bettlägerige Erkrankung hier einen Ausnahmetatbestand bilden kann). Was die Konzilsväter in allgemeiner und eher klarstellender Form nochmals betont haben, entspringt den genannten Regelungen früherer Konzilien sowie der Vorarbeit Pius‘ XII. in seiner Enzyklika Mediator Dei vom 20. November 1947 (vgl. AAS 39 [1947], 521–595, Nrn. 118f.), welche den Gläubigen die Notwendigkeit des Kommunionempfangs einschärft. Daher wird die Empfehlung des häufigen Kommunionempfangs auch in c. 528 § 2 CIC sowie in c. 898 CIC betont, wo er im letztgenannten Fall zur tätigen Anteilhabe sowie zur tiefen Andacht und höchsten Anbetung des Sakramentes hinzutritt. Es geht um die Eucharistiefeier als „Sakrament der Güte, […] Zeichen der Einheit, […] Band der Liebe“ (SC 47) sowie um das „eucharistisch[e] Opfer [als] Quelle und […] Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens“ (LG 11,1; vgl. auch c. 897 CIC), welches in seiner Fülle – weder beschränkt auf den Kommunionempfang noch einfachhin ohne ihn – seine ganze Wirksamkeit und Fruchtbarkeit für den und die einzelne*n Gläubige*n und die ganze Kirche entfalten soll. Die Vorschrift des c. 920 CIC könnte ob dieses Anliegens als kontraproduktiv und zu wenig fordernd gelesen werden. Letztlich liegt ihr aber das gleiche Anliegen zugrunde wie den Empfehlungen zum häufigen Kommunionempfang. Es handelt sich daher weniger um sich widersprechende Regelungen als vielmehr um unterschiedliche Verpflichtungsgrade. Mit der Verpflichtung des einmal jährlichen Empfangs soll den Gläubigen ein Mindestmaß an voller eucharistischer Partizipation auferlegt sein, weil sie ihr Leben und das Leben der ganzen Kirche nicht nur aus der Eucharistie heraus gestalten können, sondern dies auch sollen. Dass dies umso intensiver und voller geschehen kann, je häufiger die Kommunion empfangen wird, spiegeln die Empfehlungen wider.
Wie auch die anderen Kirchengebote zieht die Verpflichtung zum einmal jährlichen Kommunionempfang allerdings keine Sanktionen nach sich. Die Gläubigen sollen sich durch diese Norm ihrer Gewissenspflicht bewusst werden und diesen grundlegenden Ausdruck christlichen Lebens nicht aus dem Blick verlieren. Der gut fränkischen Katholikin bzw. dem gut fränkischen Katholiken stellt sich diese Frage zumeist nicht wirklich, gehört der Kommunionempfang doch zentral zur sonntäglichen Eucharistiefeier; für viele andere wird ein Verstoß gegen die Vorschrift des c. 920 CIC ihr Gewissen wohl kaum nachhaltig belasten. Dennoch verbleibt das Thema der Häufigkeit des Kommunionempfangs nicht nur an der Peripherie des kirchlichen Alltagsgeschehens. Wieviel Eucharistiefeier, wieviel Kommunionempfang die Gläubigen, wieviel eine Pfarrei benötigt und wie diese daher strukturiert sein muss, ist eine zentrale Frage vieler heutiger Pfarr- und Gemeindestrukturprozesse in den deutschen Diözesen. Natürlich ist hier die Sonntagspflicht nach c. 1247 CIC (vgl. Erstes Kirchengebot, KKK 2042) weitaus relevanter; trotzdem kann der abstrakte Blick des Gesetzgebers bezüglich notwendiger Mindeststandards und weitergehender Empfehlung vielleicht die ein oder andere Diskussion um jahrzehntelange lokale und regionale Gewohnheiten auf eine andere Ebene heben. Als zweiter Aspekt kann diese Mindestanforderung an die Kommunionempfänger*innen auch als Fingerzeig gegen die Gewohnheit eines automatisierten Kommuniongangs gelesen werden. Auch wenn der Gesetzgeber den häufigen Kommunionempfang empfiehlt – wie dargestellt mit guten Gründen – sollte dabei nicht übersehen werden, dass dieser dennoch immer an die entsprechenden Voraussetzungen gebunden bleibt. Das Wissen um den Inhalt der Eucharistie, der Wille und die Fähigkeit diese wirken zu lassen, sind gefordert; ebenso die tatsächlich tätige Teilnahme an der Feier und damit weder rein technisches Mitbeten noch ein Kommuniongang, der lediglich aus Gründen der sozialen Adäquanz erfolgt. Das dritte Kirchengebot kann auch ein Hinweis darauf sein, dass wir nicht jeden Sonntag bereit sind oder sein müssen, die Kommunion zu empfangen und die Eucharistie in ihrer Fülle zu feiern. Es kann auch einmal angezeigt sein, sitzen zu bleiben, um vielleicht beim nächsten Mal besser bereitet zu sein, Christus im eigenen Leib und somit im eigenen Leben Raum zu geben.
c. 694 CIC n.F.
„§ 1 Ipso facto dimissus ab instituto habendus est sodalis qui: […]
3° a domo religiosa illegitime absens fuerit, secundum can. 665 § 2, duodecim continuos menses, prae oculis habita eiusdem sodalis irreperibilitate.”
„§ 3 In casu de quo in § 1 n. 3, talis declaratio ut iuridice constet, a Sancta Sede confirmari debet; quod ad instituta iuris dioecesani attinet, confirmatio ad principis Sedis Episcopum spectat.”
„§ 1 Ein Mitglied gilt als ohne Weiteres aus dem Institut entlassen, das: […]
3° von der Ordensniederlassung in Ansehung der Unauffindbarkeit dieses Ordensmitglieds für zwölf ununterbrochene Monate im Sinne von can. 665, § 2 unrechtmäßig abwesend war.“
„§ 3 In dem in § 1, n. 3 genannten Fall muss diese Erklärung, damit sie rechtlich feststeht, vom Heiligen Stuhl bestätigt werden; soweit es sich um Institute diözesanen Rechts handelt, kommt die Bestätigung dem Bischof des Hauptsitzes zu.“
von Martin Rehak
Papst Franziskus ist ein eifriger Gesetzgeber, der dabei auch vor Änderungen des kodikarischen Rechts nicht zurückschreckt. Die jüngste Novellierung des Codex Iuris Canonici durch das Motu Proprio Communis vita vom 19.03.2019 betrifft das Ordensrecht, näherhin im Recht der Religioseninstitute (vgl. cc. 607–709 CIC) den Kanon 694 und im Recht der Säkularinstitute (vgl. cc. 710–739CIC) den Kanon 729.
C. 694 § 1 CIC regelt die unverzügliche Entlassung von Rechts wegen aus einem Religioseninstitut. Bislang galten Ordensleute in folgenden zwei Fällen als entlassen: Zum einen im Falle eines offenkundigen Abfalls vom katholischen Glauben (c. 694 § 1 Nr. 1 CIC), zum anderen im Falle einer (versuchten) kirchlichen oder zivilen Eheschließung (c. 694 § 1 Nr. 2 CIC). Die Logik hinter dieser Regelung dürfte darin zu sehen sein, dass ein solches Verhalten im ersten Fall nicht mit der besonderen Bindung der Ordensleute an die Kirche und im zweiten Fall praktisch nicht mit ihrer Verpflichtung auf die evangelischen Räte (vgl. cc. 207 § 2; 573; 599–601 CIC u.ö.), hier namentlich der Rat der Keuschheit, vereinbar ist.
Zu diesen beiden Fallgruppen treten nunmehr mit c. 694 § 1 Nr. 3 CIC jene Fälle hinzu, in denen sich Ordensleute seit mindestens zwölf Monaten unrechtmäßig von ihrer Ordensniederlassung entfernt haben und für den zuständigen Ordensoberen unauffindbar sind.
Es gibt, dem Vernehmen nach, weltweit nicht wenige Fälle, in denen Ordensleute für sich beschließen, ein neues Leben zu beginnen, und daher anlässlich von Dienstreisen, Familienbesuchen, Urlauben oder bei sonstigen Gelegenheiten nicht mehr in ihre Ordensniederlassung zurückkehren, sondern auf Nimmerwiedersehen spurlos verschwinden. In solchen Fällen ist der zuständige Ordensobere zwar gehalten, Nachforschungen über den Verbleib anzustellen, um dem Betreffenden gemäß c. 665 § 2 CIC dahingehend ins Gewissen zu reden, dass er nicht unerlaubt abwesend sein darf und in der ihm von Gott geschenkten Berufung zum Ordensleben ausharren möge. Im Falle eines erfolgreichen Untertauchens müssen diese Bemühungen der Oberen jedoch fruchtlos bleiben.
Die neue Norm sanktioniert damit zum einen den Verstoß der fraglichen Ordensleute gegen den evangelischen Rat des Gehorsams (vgl. dazu c. 601 CIC). Im Geiste des Gehorsams nämlich wäre ein Ordensmitglied, das sich vom Ordensleben lösen will, gehalten, den vom Recht vorgesehenen Weg des Austritts (vgl. cc. 686–693 CIC) zu beschreiten. Zugleich ermöglicht die neue Norm es nunmehr den Ordensoberen, sich in diesen Fällen auf der rechtlichen Ebene von „Karteileichen“ zu trennen. Zwar ist bereits in c. 696 § 1 CIC ein förmliches Entlassungsverfahren u.a. für den Fall vorgesehen, dass ein Mitglied sich mindestens sechs Monate unrechtmäßig entfernt; ein solches Entlassungsverfahren wäre aber nur dann ordnungsgemäß durchführbar, wenn die ladungsfähige Anschrift des zu Entlassenden bekannt wäre und er somit gemäß c. 697 Nrn. 2–3 CIC verwarnt werden könnte.
Anders als in den Fällen des c. 694 § 1 Nrn. 1–2 CIC ist im Fall des neuen c. 694 § 1 Nr. 3 CIC allerdings keine automatische Entlassung allein aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten (Zeitablauf, Unauffindbarkeit) vorgesehen. Vielmehr bestimmt der ebenfalls neu in den Kodex eingefügte c. 694 § 3 CIC, dass die Entlassung nur dann rechtskräftig ist, wenn zunächst der zuständige Obere die Tatsachen feststellt (vgl. c. 694 § 2 CIC) und sodann eine hierarchische Instanz diese Feststellung bestätigt. Welche hierarchische Instanz zuständig ist, bestimmt sich dabei danach, ob es sich um eine Ordensgemeinschaft päpstlichen oder bischöflichen Rechts handelt (vgl. zur Unterscheidung c. 589 CIC). Im einen Fall ist der Apostolische Stuhl, dort funktional die Kongregation für die Institute geweihten Lebens und für die Gesellschaften apostolischen Lebens, zuständig, im anderen Fall jener Bischof, in dessen Bistum die Ordensgemeinschaft ihren Hauptsitz hat.
Von der Neuregelung sind nur die Orden im engen Sinn, d.h. die Religioseninstitute betroffen. Eine Ausweitung auf das Recht der Säkularinstitute erfolgt ausdrücklich nicht, wie sich aus einer redaktionellen Anpassung des c. 729 CIC ergibt: dort wird nun nicht mehr pauschal auf c. 694 CIC verwiesen, sondern spezifisch auf c. 694 § 1 Nrn. 1–2 CIC.
In der Vergangenheit musste seitens der Kirchenrechtswissenschaft wiederholt kritisiert werden, dass aufgrund des verspäteten Erscheinens der monatlichen Faszikel der Acta Apostolicae Sedis, die derzeit mehr als ein Jahr hinter dem jeweiligen Berichtszeitraum hinterherhinken, die Bestimmungen der cc. 7–8 CIC über die Promulgation (in den Acta), die vacatio legis, und den Zeitpunkt des Inkrafttretens praktisch unanwendbar wurden. Das Motu Proprio Communis vita löst dieses Problem dadurch, dass die Veröffentlichung im L’Osservatore Romano ausdrücklich zum Promulgationsakt erklärt und der 10.04.2019 als Datum des Inkrafttretens festgesetzt wurde.
Wie fügt sich die Neuregelung in das Kirchenrecht in seiner Gesamtheit ein?
Zunächst sei bemerkt, dass Tatbestände, die zur Entlassung von Ordensleuten führen können, nicht nur in c. 694 CIC normiert sind. In c. 695 CIC ist die Entlassung von Ordensmitgliedern, die Straftaten gemäß cc. 1397, 1398 oder 1395 CIC [a.F.] begangen haben, zwar als Regelstrafe vorgesehen, setzt aber ein (summarisches) Strafverfahren voraus und ist bei Vorliegen besonderer Umstände ausnahmsweise in das Ermessen des Oberen gestellt. C. 696 CIC listet eine Reihe von Tatbeständen auf, deren Vorliegen den Oberen zur Einleitung eines Entlassungsprozesses berechtigt. Daraus wird umgekehrt deutlich, dass die unverzügliche Entlassung von Rechts wegen – also ohne förmlichen Prozess nebst dem Recht des zu entlassenden Mitglieds auf Verteidigung – gravierenden und offensichtlichen Entlassungstatbeständen vorzubehalten ist.
Die nunmehrige Neuregelung des c. 694 CIC erinnert entfernt an die Fallgruppe „Amtsflucht“ aus den Sondervollmachten, die Papst Benedikt XVI. im Jahre 2009 der Kongregation für den Klerus gewährt hatte (vgl. dazu AfkKR 178 [2009] 181–190, hier 188 f.; Stephan Haering, Verlust des klerikalen Standes. Neue Rechtsentwicklungen durch päpstliche Sondervollmachten der Kongregation für den Klerus, in: ebd., 369–395). Gemäß dieser nicht in das kodikarische Recht integrierten Vollmachten kann die Kongregation für den Klerus solche Priester auf dem Verwaltungsweg aus dem Klerikerstand entlassen und zugleich vom Zölibat dispensieren, die seit mindestens fünf Jahren den priesterlichen Dienst aufgegeben haben und unerlaubt fernbleiben, ohne von sich aus eine Laisierung zu beantragen. Es fällt insoweit auf, dass dort im Vergleich zu den 12 Monaten aus c. 694 CIC eine deutlich längere Zeit zugewartet werden muss, ehe Konsequenzen aus einer vorsätzlichen Vernachlässigung der Berufung zum Priestertum gezogen werden.
Im Februar diesen Jahres war einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden, dass es in der Kongregation für den Klerus Richtlinien dazu gibt, wie mit Priestern des lateinischen Ritus zu verfahren sei, die ein (oder mehrere) Kind(er) gezeugt haben. Näheren Aufschluss über Sinn und Inhalt dieser Richtlinien ist einem Interview zu entnehmen, welches daraufhin der Kardinalpräfekt der Kongregation, Beniamino Stella, dem L’Osservatore Romano gab (vgl. OR vom 28.02.2019; ORdt. vom 15.03.2019, S. 6). Laut Kardinal Stella sei das leitende Prinzip das Wohl des Kindes. Daher würden einschlägige Laisierungsgesuche vorrangig behandelt und möglichst binnen zweier Monate dem Papst zur Entscheidung vorgelegt (vgl. dazu cc. 290 Nr. 3; 291 CIC). Grundsätzlich erfolge in solchen Fällen immer eine Entlassung des Priesters aus dem Klerikerstand; und zwar auch dann, wenn der Priester nicht mehr an einer Beziehung zur Mutter seines Kindes interessiert ist und/oder wenn der Priester bzw. sein Bischof möchte, dass der Betreffende weiterhin den priesterlichen Dienst ausübt. Ausnahmen von diesem Grundsatz seien nur dann möglich, wenn das Kind bereits erwachsen ist und der Priester seine „früheren affektiven Schwächen überwunden“ hat; oder wenn es im Leben der Mutter des Kindes noch einen anderen Mann gibt, der die Vaterrolle übernimmt.
Man könnte sich nun fragen, ob unter dem Aspekt der Gleichbehandlung auch die Vaterschaft oder Mutterschaft von Ordensleuten – im Lichte des Kindeswohls – einen Entlassungsgrund darstellen. Eine klare Handhabe für solche Fälle ist jedenfalls nicht aus c. 696 CIC gegeben – es sei denn, das Eigenrecht der jeweiligen Ordensgemeinschaft sähe dies vor –, da dort nur „ständige“, „wiederholte“, „hartnäckige“ Verfehlungen Anlass zur Entlassung geben können, nicht jedoch einmalige „Ausrutscher“. Dass eine diesbezügliche Regelung bei der Neufassung des c. 694 CIC unterblieben ist, kann man entweder so deuten, dass derartige Fälle so selten sind, dass (noch) kein allgemeiner Regelungsbedarf besteht; oder dass derartige Fälle so peinlich sind, dass ihr Vorkommen nicht durch eine entsprechende Normierung indirekt eingestanden werden soll.
Mit Blick auf das Ideal einer konsistenten, von Wertungswidersprüchen freien Rechtsordnung erhebt sich dann aber doch die Frage, warum für Ordensleute, die nicht zum Priester geweiht sind, zwar der Versuch einer Eheschließung massive rechtliche Sanktionen nach sich zieht, nicht jedoch (bei fehlender Heiratsabsicht) die faktische Gründung einer Familie.
* * *
Papst Franziskus hat mit dem Motu Proprio Recognitum Librum VI vom 26.04.2022 zwischenzeitlich eine neue Textfassung des hier erwähnten c. 695 § 1 CIC festgelegt, vgl. dazu auch hier.
„Difficile lectu mihi mars.“
(KV 559, W. A. Mozart, dreistimmiger Kanon in F-Dur, Wien, 02.09.1788)
von Katharina Leniger
Während kaum einer anderen Zeit im Jahr nötigt es auch dem größten Miesepetrich die größte Widerstandskraft ab, dem Erblühen der Landschaft, dem lebenslustigen Vogelgezwitscher und ausgelassen tobenden Kindern nicht wenigstens ein müdes Lächeln zu schenken. Selbst wenn, und dies sage ich mir der vollen Tragweite dieser Aussage bewusst, besagter Miesepetrich einE AkademikerIn sein sollte. Ich bitte dies nicht als Spitze gegen meine eigenen wissenschaftlichen Zünfte zu verstehen. Nein, weder will ich hier alle Theologie Treibenden, schon gar nicht die eines bestimmten Fachbereichs, oder alle MusikwissenschaftlerInnen pauschal als spaßbefreit oder humorlos darstellen. Im Prinzip wollte ich nur mit dem Holzhammer darauf hinaus, dass der 1. April mit seinem Schalk nicht umsonst den endgültigen Durchbruch des Warmen und Geselligen gegen die Kälte und Einsamkeit des Winters markiert.
In Anbetracht der durchaus sehr ernst zu nehmenden Aufgabe, am 1. April einen Eintrag unter der Rubrik „Kanon des Monats“ auf der Homepage eines ordentlichen Lehrstuhls für Kirchenrecht zu verfassen, kann einem als musikliebhabende und gleichzeitig kirchenrechtlich interessierte Person schon allerlei Unfug in den Kopf kommen. Mit einiger Sicherheit befinde ich mich in bester Gesellschaft. Ob wir vom oben zitierten Wolfgang Amadeus Mozart sprechen oder von Brahms, Haydn, Bach, Zarlino, Machaut etc. pp., der Kanon inspirierte sie alle und trieb sie zu wahrhaften Höhenflügen der kompositorischen Kunst.
Beginnen muss ich nun jedoch – und auch hier kommt mir meine wissenschaftliche Tradition offensichtlich in die Quere – beim Wort Kanon selbst. Auch wenn ich an dieser Stelle weder eine einwandfreie etymologische Herleitung leisten kann noch will, als Wort semitischen Ursprungs, später mit einer langen griechisch-lateinischen begrifflichen Tradition, bezeichnet das Urwort zunächst einen Stab aus (Schilf-)Rohr. Dieser ist in seiner Funktion als Maßeinheit wiederum selbst zum Wort für Maßstab geworden. Nicht weit ist es von dort zur Wortbedeutung der Regel, der Vorschrift oder zum Mustergültigen an sich. Wie sich die christlichen Kirchen (zum Teil) nun einmal verstehen, verwundert es nicht, dass man hier bis heute mit der Versubstantivierung der Regel viel anfangen kann. Denn Ordnung ist bekanntlich (manchmal sogar mehr als) das halbe Leben.
Aber ein weiteres Mal in der langen und verwinkelten Kirchengeschichte steht die Kirche in guter antiker Tradition. Sich der arithmetischen Wissenschaft verschrieben habend, bezeichneten frühe Musiktheoretiker zunächst das Monochord als Kanon. Es handelt sich um ein Instrument, mit dem anhand einer Saite verschiedenste Intervalle ausgemessen werden können. Auch wenn es die Stiftsherren wenig erfreuen wird, die wohl früheren ϰανωνιϰοί, also „Kanoniker“, waren die so genannten Pythagoreer und hatten mit christlichen Regeln wenig bis gar nichts zu tun.[1] Man kann sich lebhaft vorstellen, dass eine im 6. vorchristlichen Jahrhundert von einer schillernden Führerfigur, namentlich des Pythagoras, gegründete Schule, die in ihrer Lebensform eher einer Sekte glich, davon ausging, über eine Art elitäres Geheimwissen zu verfügen. Auch diese Haltung sollte wohl – unabhängig von diesen geistigen Vätern – über eine gewisse Zeit eine nicht unerhebliche Tradition ausbilden.
Um hier nicht selbst in eine Sprache und Welt einzudringen, die nur noch Eingeweihten verständlich ist, mache ich einen kleinen Zeitsprung von ca. 2.000 Jahren. Wir haben gelernt, canones sind inzwischen Regeln: So weit, so gut. Bei Musikstücken bezeichnen sie die regula, mit deren Hilfe auf Lateinisch deutlich gemacht wird, wie eine Melodie bei der Interpretation nachgeahmt werden soll. Das betrifft beispielsweise den zeitlichen und tonalen Abstand vom zweiten zum ersten Einsatz. Auch zu dieser Zeit scheinen jedoch die Musici, gelangweilt von den strengen Regularien, Schlupflöcher gesucht zu haben und bauten kurzerhand Rätsel in diese canones ein. Dabei handelt es sich keinesfalls nur um musikalische Rätsel, nein, es wurden durchaus auch Wortspiele eingebaut. Der Interpret musste um die Ecke denken, um zum Schlüssel des Rätsels zu gelangen. Ramos de Pareja (Ende des 15. Jahrhunderts) spricht von einer „Vorschrift, die den Willen des Komponisten mit einer gewissen Doppeldeutigkeit, dunkel und in einem Rätselspruch offenbart“. Auch bei Tinctoris ist die Rede von einer „Aura des Geheimnisvollen“. Man kann sich denken, dass es mit diesen Vorlagen keineswegs weniger rätselhaft in der Geschichte weiterging, wenn auch nicht ohne Widerstand.
So reagierte bspw. Johann Mattheson (1681-1764) auf die umfassende Kompositionstätigkeit Johann Sebastian Bachs (1685-1750) im Feld des Kanons mit lautstarkem Protest. So sei sowohl der Nutzen des Kanons gering als auch die Aura der Geheimlehre aus aufklärerischen Motiven aufs Schärfste anzuklagen. Bach schwieg wohl zu diesen Vorwürfen und widmete, wie könnte es auch anders sein, einem Hamburger Rechtsgelehrten daraufhin, ja genau, einen Rätselkanon.
(Musik-)Geschichtlich bewanderte Lesende können sich denken, nun sind wir endlich bei dem Komponisten angelangt, dem wir den heute zu besprechenden Kanon verdanken: Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Und gleichzeitig kann man über seine kompositorische Tätigkeit nicht sprechen, ohne auch einen Blick auf die wissenschaftliche Rezeption seiner Kanons (laut Duden der korrekte Plural, es sträuben sich die Haare der Kanonisten) zu werfen. So haben die textlichen Grundlagen schon aus technischen Gründen eine bestimmte Länge nicht zu überschreiten, will man sie irgendwann wiederholen oder gar miteinander kombinieren. So eignen sich zur Vertonung besonders gut Auszüge aus den Ordinariumstexten, Gedichte, Epigraphe, Epitaphe und kurze Sinnsprüche. Nur kurz ist gerade bei Letzteren der Weg zu moralisch weniger einwandfreien Inhalten. Alleine durch das leichte Nachsingen eines Kanons eignen sich volkstümlich-gesellige, spöttische, ja gar derbe Texte besonders gut. Mozart, dem in der wissenschaftlichen Forschung neben einem Tourettesyndrom und anderen manifesten psychischen Erkrankungen auch die dagegen scheinbar harmlos daherkommende schlechte Erziehung attestiert wurde, hatte sie alle.[2]
Besonders frech zeigte er sich bei der Platzierung seiner Kanons: „Difficile lectu mihi Mars“ reihte er in eine Kanonsammlung ein, die u.a. religiöse Werke und den wohl bekanntesten Kanon seiner Feder, „Bona nox! bist a rechta Ox“ (KV 561) beinhaltet. Ganz deutlich merkt man, er hatte wohl ein Gespür für die gezielte Provokation. Doch, was ist an dem pseudolateinischen Text überhaupt das Problem, schließlich ist eine Bedeutung anhand einer Übersetzung schlecht herauszufinden.[3] Der Clou liegt in der Textverteilung und in einer gewissen Neigung, zweideutige Dinge sehen und hören zu wollen. Trennt man folgendermaßen: „Di-ffic-i, le-lec-tu-mih-im-ars“ und betont es etwas bayerisch oder österreichisch, braucht man nicht viel Fantasie, um den Stein des Anstoßes plötzlich auf den eigenen gefallenen Groschen niederrauschen zu hören. Man kann sich lebhaft vorstellen, dass sich alle Moralisten und prüden MusikwissenschaftlerInnen im Moment dieser Erkenntnis am liebsten gleichzeitig Augen, Ohren und den eigenen Mund zugehalten hätten. Zur gleichen Zeit müssen sie wohl aber auch Tränen der Rührung über die Genialität der musikalischen Anlage und Schönheit der Melodik vergossen haben.
Was schon anhand der verschiedensten, oben vorgebrachten (pseudo-)medizinischen Diagnosen abzulesen ist und an Textumschreibungen noch deutlicher wird: Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Mozart, der die Kunst der Kanonkomposition tatsächlich auf die kaum mehr erreichte musikalische Spitze trieb, nein, dieser Mozart konnte, er durfte sich nicht mit derart primitiven Texten abgeben, sich anhand tabuisierter Themen auch noch einen Spaß erlauben. Die einzige Erklärung muss wohl sein, dass er nicht anders konnte. Der Ärmste.
Ob er nun krank war, werde ich nicht sagen können. Traurig nur, dass ihm durch eine solche Unterstellung posthum jeglicher Humor aberkannt wird. Vermutlich würde er es wie Bach halten und über diese absurde Begebenheit einfach einen Kanon schreiben.
Nun, was bleibt dem geneigten Kanonisten von einem solchen Ausflug in die (Un-)Tiefen der seichten Musikwissenschaft? Vielleicht kann man durch die historisch sehr ausgewählten Stationen doch eine gewisse Neigung des Menschen erkennen, die Notwendigkeit der Auslegung der Regeln bis ins kleinste Detail hinein auszureizen, wenn nicht überzustrapazieren. Die besonders verständigen Geister nutzten dies selbstverständlich zu allen Zeiten zu ihrem Vorteil. Und jene, die noch intelligenter waren als diese, machten sich einen Spaß daraus, sie so zu verkomplizieren, dass sie nur noch einem eingeweihten Kreis überhaupt zugänglich waren. Was diese Analogien für die Kirchenrechtswissenschaft oder – vielleicht allgemeiner – die Theologie bedeuten, möchte ich hier nicht letztgültig bestimmen. Ich für meinen Teil erfreue mich an den Rätseln, wenn nicht Mysterien, die uns diese hellsten und humorvollsten der kompositorischen Köpfe in Kanons hinterlassen haben. Genauso jedoch erfreuen mich die Mysterien und Rätsel der akademischen Theologie und der Canones. Mögen sie alle nie zu Ende gehen.
[1] Vielleicht ist es Glück (oder besser Fügung), dass diese Benennung mit dem Berufsstand der Kanonisten nicht viel gemein hat und dieser somit über jeglichen Namensirrtum erhaben ist.
[2] Gemeint sind die Textgattungen, die den Kanons zugrunde liegen.
[3] „Difficile“ kann in Kombination mit „lectu“ als so genanntes Supin etwa heißen: „Schwer aufzusammeln/zu lesen“. „Mihi“ bedeutet schlicht „mir“ und Mars kann mit Kampf übersetzt werden, personifiziert im römischen Kriegsgott Mars. Zusammengefasst könnte man von pseudolateinischem Nonsens sprechen.
-
KdM_12_Mozartkanon 71 KB
c. 1251 CIC
„Abstinentia a carnis comestione vel ab alio cibo iuxta conferentiae Episcoporum praescripta, servetur singulis anni sextis feriis, nisi cum aliquo die inter sollemnitates recensito occurrant; abstinentia vero et ieiunium, feria quarta Cinerum et feria sexta in Passione et Morte Domini Nostri Iesu Christi.“
„Abstinenz von Fleischspeisen oder von einer anderen Speise entsprechend den Vorschriften der Bischofskonferenz ist zu halten an allen Freitagen des Jahres, wenn nicht auf einen Freitag ein Hochfest fällt; Abstinenz aber und Fasten ist zu halten an Aschermittwoch und Karfreitag.“
von Anna Krähe
Der vorliegende Beitrag ist Teil einer Reihe im Rahmen von „Kanon des Monats“, in der in loser Reihenfolge jedes der sogenannten fünf Kirchengebote (vgl. KKK 2041–2043) aus kanonistischer Perspektive betrachtet und bezüglich seiner Verortung und Funktion im geltenden Recht untersucht wird.
Mit heiterer Ausgelassenheit und Frohsinn werden Narren und Närrinnen in den nächsten Tagen in den unterschiedlichsten Formen Karnevals- und Faschingsbräuche pflegen, sich Ess- und Trinkgelagen hingeben und (noch einmal) bunt, fröhlich und euphorisch feiern, bevor am Aschermittwoch alles vorbei ist. Nicht nur als notwendig (er)nüchtern(d)e Pause nach durchfeierten Tagen setzt der Aschermittwoch als traditioneller Fast- und Abstinenztag einen Schnitt – vielmehr öffnen Abstinenz und Fasten an diesem Tag eine Tür hinein in die österliche Bußzeit. Vergleichbar dem Beginn eines neuen Kalenderjahres sind diese Tage auch eine Blütezeit der Fastenvorsätze, deren Vielfältigkeit mit jedem Jahr zuzunehmen scheint: Neben dem klassischen Verzicht auf Speisen und jede denkbare Art von Genussmitteln „trenden“ auch CO2- oder Plastik-Fasten; statt dem Verzicht „auf etwas“ soll der Fokus mehr auf „Zeit für“ beispielsweise Gebet, Freunde und Familie, Spaziergänge oder Ähnliches gelegt werden. Nicht nur diese Breite der „Fastenangebote“ und die Vielfältigkeit der Fastenvorsätze mag den einen oder die andere teilweise irritieren, auch eine ganz konkrete Frage stellt sich mit Blick auf den Klassiker unter den Fastenvorhaben: Wie halten Veganer*innen bzw. Vegetarier*innen eigentlich das Fasten- und Abstinenzgebot? Können Sie überhaupt fasten oder sind sie vielleicht sogar ein Vorbild für Fasteneinsteiger*innen? Welch willkommener Anlass, die Begriffe Buße, Fasten und Abstinenz auch einmal aus einer kirchenrechtlichen Perspektive zu beleuchten.
Die Regelung zu Fast- und Abstinenztagen hat im geltenden Kodex ihren Platz in c. 1251 CIC gefunden. Mit dem Begriff abstinentia, einem Sich-Enthalten bzw. -Fernhalten, meint der kirchliche Gesetzgeber primär den Verzicht auf Fleischspeisen. In der Apostolischen Konstitution Paenitemini vom 17. Februar 1966 (vgl. AAS 58 [1966], 177–198; engl. Übersetzung; dt. Übersetzung) hatte Papst Paul VI. eine Neuordnung der kirchlichen Bußordnung vorgenommen und die Bestimmungen der cann. 1250–1252 CIC/1917 damit aufgehoben. Die vom Papst grundgelegten Normen wurden teilweise wortwörtlich in den Kodex von 1983 übernommen und bilden noch immer den Interpretationshintergrund für das heute geltende Recht. Im 3. Kapitel unter III. § 1 definiert Paul VI., dass das Abstinenzgebot „den Genuss von Fleisch [verbietet], nicht aber von Eiern, Laktizinien und Speisegewürzen, und zwar auch dann nicht, wenn sie aus Tierfett bereitet werden.“ In einer etwas moderneren Terminologie ist hier demnach eine vegetarische, jedoch keine vegane Ernährung gemeint, wobei die Abstinenz von Fisch, Meeresfrüchten und wohl auch wirbellosen Tieren (z.B. Schnecken) nicht verlangt wird. Das Abstinenzgebot gilt nach c. 1252 CIC für alle Gläubigen ab der Vollendung des 14. Lebensjahres.
Zur Abstinenz von Fleischspeisen, die grundsätzlich an allen Freitagen des Jahres zu halten ist, auf die kein Hochfest fällt, tritt am Aschermittwoch und am Karfreitag das Fastengebot hinzu. Das geltende kirchliche Recht kennt darüber hinaus keine reinen Fasttage mehr. Die Liturgiekonstitution Sacrosanctum concilium (= SC; dt. Übersetzung) hatte sich in Art. 110 auf das Pascha-Fasten am Karfreitag beschränkt, welches je nach Region auch auf den Karsamstag ausgeweitet werden sollte. Paul VI. erklärte im 3. Kapitel von Paenitemini unter II. § 3 auch den Aschermittwoch zum Fasttag und legte dabei fest, dass an solchen Tagen nur eine volle Mahlzeit sowie am Abend und am Morgen eine kleinere Speise zu konsumieren sei, wobei Art und Menge den örtlichen Gewohnheiten zu entsprechen hätten (vgl. ebd., III. § 2). Damit ist der kirchenrechtliche Begriff des Fastens deutlich enger als der heute gemeinhin verwendete und beschränkt sich auf den Verzicht auf mehr als eine sättigende Mahlzeit. Zugleich liegt ihm aber ein bestimmtes leib-seelisches Verständnis zugrunde, das über rein medizinische Erwägungen hinaus geht. Paul VI. betont in Anlehnung an die Präfation für die Fastenzeit IV des Römischen Messbuchs, dass das körperliche Fasten befreiend und stärkend wirken solle (vgl. ebd., II.). Das Fasten in diesem Sinne ermöglicht dem Menschen demnach eine Begegnung mit sich selbst und damit auch mit Gott. Der Hinweis auf die örtlichen Gegebenheiten öffnet nicht nur den Raum für die Berücksichtigung der weltweit unterschiedlichen Essgewohnheiten, sondern weist auch darauf hin, dass Fasten eine bewusste, freiwillige Beschränkung der Mahlzeiten meint und sich auf die Enthaltung von Speisen bezieht, die potentiell zur Verfügung stünden. Hierin ist das Fasten auch vom Hungern aufgrund von Not oder Mangel abzugrenzen. Nach c. 1252 CIC sind zur Einhaltung des Fastengebots alle Gläubigen von der Vollendung des 18. Lebensjahres bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres verpflichtet.
Abstinenz und Fasten bilden am Aschermittwoch und am Karfreitag eine Einheit, die diese Tage in besonderer Weise prägt. Nach Paul VI. ragen das Fasten und die Abstinenz unter den „nach uralter Tradition drei besonders ausgezeichnete[n] Weisen“ (vgl. Paul VI., ApK Paenitemini, III.) zur Erfüllung des Bußgebots heraus. In diesem Sinne zählt das Halten der gebotenen Fasttage traditionell auch zu den fünf Kirchengeboten (vgl. KKK 2043). Dieser besondere Charakter wird auch in c. 1249 CIC herausgestellt, der einleitend zum kodikarischen Abschnitt über die Bußtage den Charakter und die Formen der Buße beschreibt. Dabei liegt hier ein religiöses Verständnis der Buße zugrunde, wonach durch sie „eine tiefgreifende Wandlung des ganzen Menschen“ ermöglicht wird, durch die er „neu zu denken, zu urteilen und sein Leben zu gestalten beginnt, ergriffen von der Heiligkeit und Liebe Gottes“ (vgl. Paul VI., ApK Paenitemini, I.). Abstinenz und Fasten als Ausdrucksformen der Buße dienen der Vertiefung in das Glaubensgeheimnis und der Vorbereitung der Begegnung mit Gott. Über diese beiden Bußopfer hinaus hatte schon SC Art. 110 den Weg zu neuen, zeitgemäßen und den jeweiligen Verhältnissen entsprechenden Formen der Buße gebahnt. Als solche benennt c. 1249 CIC Gebet, Werke der Frömmigkeit und der Caritas sowie Selbstverleugnung durch getreue Pflichterfüllung, womit vor allem Demut mit Blick auf den Dienst am Nächsten gemeint ist. Innerhalb der in c. 1251 CIC festgelegten Bußtage und -zeiten nehmen der Aschermittwoch und der Karfreitag als kirchlich gebotene Abstinenz- und Fasttage einen eigenen Platz ein, indem sie die österliche Bußzeit als eine besondere Zeit der Umkehr und Ausrichtung rahmen. Sie dienen noch verstärkter als die übrigen Bußtage dazu, dass „die Gläubigen in ihrer Gesamtheit […] miteinander verbunden bleiben“ und dazu, „das österliche Geheimnis stärker hervortreten [zu] lassen“ (Paul VI., ApK Paenitemini, III.) Im Zentrum steht hier insbesondere auch das gemeinsame und verbindende dieser Tage.
Die Forderung einer dezentralen Regelung der Bußpraxis, die dementsprechend auch auf regionale und gesellschaftliche Gegebenheiten Rücksicht nimmt, betonte bereits SC Art. 110 und sie wurde von Paul VI. im 3. Kapitel VI. der Konstitution konkretisiert. Auf dieser Grundlage geben die cc. 1251, 1253 CIC den Bischofskonferenzen weitreichende Regelungskompetenzen bezüglich der Ausgestaltung einer eigenen Bußordnung. Mit der Partikularnorm Nr. 16 der Deutschen Bischofskonferenz zu cc. 1251, 1253 CIC vom 5. Oktober 1995 ist dies für Deutschland geschehen. Unter Nr. 1 bestätigt die DBK die Aussage des Kodex, dass der Aschermittwoch und der Karfreitag strenge Fast- und Abstinenztage sind; wobei Abstinenz den Verzicht auf Fleischspeisen bezeichnet und mit Fasten eine einmalige Sättigung gemeint ist – was weitere Mahlzeiten, die keinen sättigenden Effekt haben aber nicht ausschließt. Das eigens eingeführte Fastenopfer nach Nr. 2 soll ein „spürbares Geldopfer für die Hungernden und Notleidenden“ sein, das jede*r Gläubige seiner wirtschaftlichen Lage entsprechend am Ende der österlichen Bußzeit leisten soll. Als Gedenktage des Leidens und Sterbens Jesu ist nach Nr. 3 an allen Freitagen, auf die kein Hochfest fällt, ein Opfer darzubringen. An dieser Stelle hat die DBK die Möglichkeit genutzt, über die kodikarischen Vorgaben hinaus eigene Bußformen zu umschreiben, sodass das Bußopfer vom „klassischen“ Fleischverzicht über Einschränkungen im Konsum – wobei das Ersparte gespendet werden sollte – bis hin zu Dienstleistungen und Hilfen für die Nächsten sowie Gebet und Frömmigkeitsübungen reicht.
Bezüglich des Abstinenzopfers haben die deutschen Bischöfe hingegen die in c. 1251 CIC eröffnete Möglichkeit nicht genutzt, den Verzicht auf Fleisch auch um andere Speisen zu erweitern. Dies mag in einer Gesellschaft, in der der pro Kopf Verzehr von Fleisch und Fleischerzeugnissen im Jahr 2017 bei insgesamt 88,1 kg lag (vgl. Bundesverband der Deutschen Fleischwarenindustrie e.V.) und in der Fleisch zu einem alltäglichen und für viele Menschen unverzichtbaren Nahrungsmittel gehört, eine nachvollziehbare Festlegung sein. Der steigenden Zahl an vegetarisch und vegan lebenden Menschen in Deutschland trägt diese Norm, zumindest auf den ersten Blick, allerdings ebenso wenig Rechnung wie der Tatsache, dass neben Fleisch inzwischen auch Fisch und sogar bestimmte Gemüsesorten zu den alltäglichen, aber auch teilweise wertvollen und teuren Nahrungsmitteln zählen. Ob der Verzicht auf Fleischspeisen noch zeitgemäß und vermittelbar sei, hatten schon die Kodexväter bezüglich der Kanones zum Bußwesen diskutiert (vgl. Com 35 [2003], 125). Als Ergebnis der Diskussionen wurden die Möglichkeiten zur Anpassung und Abänderung der kodikarischen Regelungen durch die Bischofskonferenzen ausgedehnt. Vor dem Hintergrund der beschriebenen gesellschaftlichen Realität wäre es wünschenswert, würden die deutschen Bischöfe hier bezüglich des Aschermittwochs und des Karfreitags über eine Ausweitung des Abstinenzgebots beispielsweise auf Fisch und Meeresfrüchte nachdenken; selbstverständlich schließt die Partikularnorm einen solchen freiwilligen Verzicht aber nicht aus.
Wie steht es aber nun um die Einhaltung des Fasten- und Abstinenzgebots für Veganer*innen und Vegetarier*innen? Wie so oft erfordert diese Frage eine differenzierte Antwort: Das Fastengebot ist unproblematisch auch von denjenigen zu erfüllen, die bestimmte Nahrungsmittel nicht zu sich nehmen können oder wollen. Mit Blick auf die Abstinenz hingegen muss unterschieden werden. Formal gesehen wird das Abstinenzgebot von vegan und vegetarisch lebenden Menschen selbstverständlich erfüllt. Fraglich ist aber, ob die Bußwirkung, welche dieser bewusste Verzicht hervorrufen soll, ermöglicht wird (oder nicht eher ins Leere geht), wenn letztlich nur das alltägliche Essverhalten fortgeführt wird. Vor diesem Hintergrund wäre es zu empfehlen, dass die Gläubigen für sich andere Formen des Verzichts und der Bußleistung suchen. In SC Art. 110 betont das Konzil, dass zur inneren, individuellen Buße auch eine äußere, soziale Dimension hinzutreten soll; beide Dimensionen bedürfen dabei einander. Durch das Bußopfer, das über den persönlichen Verzicht hinaus auch nachdrücklich den bzw. die Nächste*n und die ganze kirchliche Gemeinschaft in den Blick nimmt, können und sollen die Gläubigen sich Gott in neuer Weise zuwenden. Der bewusste und freiwillige Verzicht auf bzw. die Einschränkung von Nahrung dient hierbei als äußeres Zeichen der Entsagung von den Zwängen und Notwendigkeiten der weltlichen Strukturen, von denjenigen Dingen, die einem christlichen Leben schaden oder dessen Entfaltung hemmen. Die innere Haltung, der im sichtbaren Nicht-Vollzug Ausdruck verliehen wird und die wiederum in den Menschen hinein wirkt, ist entscheidend. Die Normen über die Bußtage und das Abstinenz- und Fastengebot des c. 1251 CIC erscheinen dabei als eines der vielen Beispiele des kirchlichen Gesetzbuches, die durch ein nicht sanktioniertes Gebot auch zur Gewissensbildung eines jeden Gläubigen beitragen wollen und einen verbindlichen, aber vor allem verbindenden Rahmen für die Entfaltung des Glaubenslebens in der kirchlichen Gemeinschaft aufspannen möchten.
c. 452 CIC
„§ 1. Quaelibet Episcoporum conferentia sibi eligat praesidem, […] ad normam statutorum.
§ 2. Praeses conferentiae […] non tantum Episcoporum conferentiae conventibus generalibus, sed etiam consilio permanenti praeest.”
„§ 1. Jede Bischofskonferenz hat nach Maßgabe der Statuten ihren Vorsitzenden zu wählen […].
§ 2. Der Vorsitzende der Konferenz […] steht nicht nur den Vollversammlungen der Bischofskonferenz vor, sondern auch dem Ständigen Rat.“
von Martin Rehak
Einhundertdreizehn (113) Bischofskonferenzen der katholischen Kirche sind in aktuellen Ausgaben des Päpstlichen Jahrbuchs aufgelistet (vgl. etwa AnPont [2016] 1069–1087). Wie sich den ergänzenden Hinweisen dort entnehmen lässt, ist beim Apostolischen Stuhl für 52 Konferenzen in Europa sowie in Nord-, Mittel- und Südamerika die Kongregation für die Bischöfe zuständig; für 53 Konferenzen in Afrika, Asien und Ozeanien die Kongregation für die Evangelisierung der Völker; und für die restlichen acht Konferenzen die Kongregation für die katholischen Ostkirchen bzw. mehrere Kongregationen in gemeinsamer Zuständigkeit.
Der CIC/1983 ordnet die Bischofskonferenzen systematisch dem Recht der Teilkirchenverbände zu und bietet in cc. 447–459 CIC einige grundlegende Regelungen, die auf eine Ergänzung durch die Statuten der jeweiligen Bischofskonferenz hin angelegt sind (vgl. c. 451 CIC).
Über Amt und Rolle des Vorsitzenden einer Bischofskonferenz äußert sich vor allem c. 452 CIC. Der Vorsitzende wird von der Bischofskonferenz gewählt (c. 452 § 1 CIC). Der Vorsitzende der Konferenz steht von Rechts wegen zugleich dem Ständigen Rat vor (c. 452 § 2 CIC), der von den Diözesanbischöfen im Konferenzgebiet gebildet wird. Aufgabe des Vorsitzenden ist es außerdem, nach Abschluss der Vollversammlungen über die Verhandlungen und etwaige Dekrete dem Apostolischen Stuhl zu berichten, der sodann allfällige Rekognoszierungen vornehmen wird (vgl. c. 456 CIC).
In der offiziösen lateinisch-deutschen Ausgabe des geltenden Kodex des kanonischen Rechts ist unser Kanon mit einem Asteriskus gekennzeichnet – dies bekanntlich ein Hinweis darauf, dass zu dieser Norm eine authentische Interpretation (vgl. dazu c. 16 CIC) ergangen ist. Der Päpstliche Rat für die Interpretation von Gesetzestexten war mit der Frage befasst worden, ob das Amt des Konferenzvorsitzenden in einer Bischofskonferenz bzw. das Amt im Konvent der Bischöfe einer Kirchenregion (vgl. c. 434 CIC) auch von einem Auxiliarbischof („Weihbischof“, vgl. cc. 403–411 CIC) wahrgenommen werden könne. Der Rat entschied diese Frage negativ (vgl. PCI, Responsio ad dubium vom 23.05.1988, in: AAS 81 [1989] 388).
Soweit es die Deutsche Bischofskonferenz anbelangt, enthalten zum einen das Statut der Deutschen Bischofskonferenz vom 24.09.2002, daneben aber auch die Geschäftsordnung der Deutschen Bischofskonferenz vom 26.09.2001 eine Ausgestaltung der kodikarischen Regelungen über den Vorsitzenden.
Gemäß Art. 3 lit. c) des Statuts ist der Vorsitzende neben Vollversammlung, Ständigem Rat und Bischöflichen Kommissionen eines der Organe der Bischofskonferenz. Art. 28 Abs. 1 des Statuts bestimmt in Anlehnung an c. 452 CIC, dass der Vorsitzende „aus dem Kreis der Diözesanbischöfe für eine Amtszeit von sechs Jahren gewählt“ wird, wobei eine (auch mehrfache) Wiederwahl möglich ist. Sollte der Vorsitzende aus seinem Amt als Diözesanbischof ausscheiden, endet auch der Vorsitz in der Bischofskonferenz (Art. 29 Abs. 3). Gemäß Art. 29 Abs. 1 des Statuts bestehen die wichtigsten Aufgaben des Vorsitzenden darin, die Vollversammlungen sowie die Sitzungen des Ständigen Rats zu leiten und die Bischofskonferenz nach außen zu vertreten. Bei dieser Außenvertretung ist der Vorsitzende an die Beschlüsse der Vollversammlung und des Ständigen Rats gebunden (vgl. ebd.).
Weitere Einzelheiten hierzu ergeben sich aus der Geschäftsordnung. Dabei enthält § 1 der Geschäftsordnung näheres zur Einberufung und Leitung der Vollversammlung durch den Vorsitzenden. Demnach findet jährlich mindestens eine ordentliche Vollversammlung statt (üblich sind allerdings zwei, nämlich eine im Frühjahr und eine im Herbst). Mindestens eine der ordentlichen Vollversammlungen eines Jahres hat in Fulda stattzufinden; hinsichtlich der weiteren bestimmt der Vorsitzende den Versammlungsort (§ 1 Abs. 3). Die Termine werden regelmäßig in der Herbst-Vollversammlung des Vorjahres festgelegt (§ 1 Abs. 2). Bei dringenden Gründen bzw. auf Antrag von einem Drittel der Mitglieder kann bzw. muss der Vorsitzende eine außerordentliche Vollversammlung einberufen (vgl. § 1 Abs. 1), wobei die Ladungsfrist mindestens eine Woche betragen muss (vgl. § 1 Abs. 2). Sache des Vorsitzenden ist es sodann, die Tagesordnung der Vollversammlung festzulegen und sich hierüber im Vorfeld mit den Kommissionen und Mitgliedern über Vorschläge und Anträge zu verständigen (vgl. § 3 Abs. 1). Die fertige Tagesordnung ist drei Wochen vor Beginn der Vollversammlung zusammen mit der Einladung den Teilnehmern zu übersenden (vgl. § 3 Abs. 2). Am Ende der Vollversammlung obliegt es dem Vorsitzenden, zusammen mit dem Sekretär das von den Mitgliedern genehmigte Protokoll zu unterzeichnen (vgl. § 5). Analoge Vorschriften über die Rolle des Vorsitzenden bei der Vorbereitung, Einberufung und Protokollierung der Sitzungen des Ständigen Rats sind den §§ 6, 8 und 10 der Geschäftsordnung zu entnehmen. Insoweit sind freilich die Fristen für Vorlage des ersten Entwurfs der Tagesordnung und Versand der abgestimmten Tagesordnung von sechs bzw. drei Wochen vor Beginn der Vollversammlung für die Tagesordnungen des Ständigen Rats auf vier bzw. zwei Wochen vor Sitzungsbeginn verkürzt. Von der Vertretung der Bischofskonferenz nach außen handelt schließlich auch § 11 der Geschäftsordnung, der insoweit nicht nur die entsprechende Festlegung des Statuts wiederholt, sondern darüber hinaus die Thematik der Bindung des Vorsitzenden an die Beschlusslage in der Vollversammlung bzw. im Ständigen Rat näher beleuchtet: Für den Fall, dass es zu einer bestimmten Sachfrage keine Beschlüsse geben sollte, ist „der Vorsitzende gehalten, einen entsprechenden Beschluss herbeizuführen“, hilfsweise zumindest mit dem Vorsitzenden der zuständigen Fachkommission Einvernehmen herzustellen (vgl. § 11 Abs. 1). Nur in „dringenden Fällen kann der Vorsitzende der Bischofskonferenz von sich aus Erklärungen abgeben“ (§ 11 Abs. 2), und hat darüber sodann die Konferenzmitglieder zu unterrichten.
Eine bislang nicht zum spezifischen Amtsprofil der Vorsitzenden einer Bischofskonferenz gehörige Aufgabe kommt vom 21.–24.02.2019 auf sie zu. Papst Franziskus hat – wie bereits in einem Pressebriefing des Vatikanischen Pressesaals und aus einem Kommuniqué des so genannten Kardinalrats jeweils vom 12.09.2018 bekannt wurde – anlässlich der Missbrauchskrise in der katholischen Kirche alle Konferenzvorsitzenden zu einer internationalen Tagung über den Schutz von Minderjährigen in der Kirche nach Rom eingeladen, an der außerdem auch alle Ersthierarchen (Patriarchen, Großerzbischöfe) der katholischen Ostkirchen, die Präfekten mehrerer Dikasterien der Römischen Kurie sowie Generaloberinnen und -obere verschiedener Orden teilnehmen werden. Ein derartiges Tagungsformat hat anders als das Ökumenische Konzil (vgl. dazu cc. 337–341 CIC) und die Bischofssynode (vgl. dazu cc. 342–348 CIC) keine im kodikarischen Recht skizzierte rechtliche Gestalt. Einem Interview, das kürzlich P. Hans Zollner SJ, ein Mitglied des Vorbereitungskomitees, gegeben hat, ist zu entnehmen, dass in der inhaltlichen Arbeit drei Leitthemen jeweils aus den drei Perspektiven des einzelnen Bischofs, des Bischofskollegiums und des Volkes Gottes erschlossen werden sollen. Die drei Leitthemen lauten: Verantwortung; Rechenschaftspflicht; Transparenz. Die Befassung mit der Opferperspektive ist in die dezentrale Vorbereitung der Tagung ausgelagert worden. Die Mitglieder des Vorbereitungskomitees hatten dazu in einem Rundschreiben, dessen Text am 18.12.2018 vom Vatikanischen Pressesaal bekannt gemacht wurde, die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen nachdrücklich gebeten, sich mit Missbrauchsopfern zu treffen und deren Leid aus erster Hand kennenzulernen. Zudem wurden sie mittels eines Fragebogens gebeten, konstruktive Kritik zu üben und Reformbedarf anzumelden.
Soweit es den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz anbelangt, konnte dieser bei seinen Rückmeldungen nach Rom auf einschlägige Beratungen im Ständigen Rat vom November 2018 zurückgreifen. Der Ständige Rat hat dort Überlegungen aus der vorangegangenen Vollversammlung zu Konsequenzen aus der so genannten MHG-Studie konkretisiert. Wie der einschlägigen Pressemeldung zu entnehmen ist, sollen unter Federführung des Beauftragten für Fragen des sexuellen Missbrauchs im kirchlichen Bereich, Bischof Stefan Ackermann, Trier, fünf Teilprojekte realisiert werden. Diese umfassen
- eine Standardisierung der Führung der Personalakten von Klerikern;
- die Einrichtung externer, von der Kirche unabhängiger Anlaufstellen für Opfer;
- die Aufarbeitung der Frage einer institutionellen Verantwortung neben der individuellen Verantwortlichkeit der einzelnen Täter;
- eine Weiterentwicklung des 2011 etablierten Verfahrens materieller kirchlicher Leistungen in Anerkennung des Leids, das Opfern sexuellen Missbrauchs zugefügt wurde; sowie
- ein überdiözesanes Monitoring der kirchlichen Maßnahmen für Intervention und Prävention.
Darüber hinaus soll in längerfristiger Perspektive untersucht werden, ob und ggf. wie der Zölibat der Priester und verschiedene Aspekte der katholischen Sexualmoral sexuellen Missbrauch durch Kleriker begünstigen. Schließlich erachtet der Ständige Rat auch das materielle und prozessuale kirchliche Recht angesichts der Missbrauchskrise für reform- bzw. entwicklungsbedürftig: „Der Ständige Rat unterstützt außerdem den Vorschlag, interdiözesane Strafgerichtskammern für Strafverfahren nach sexuellem Missbrauch auf dem Gebiet der Deutschen Bischofskonferenz zu errichten. Dafür wird sich der Ständige Rat mit den entsprechenden Stellen in Rom in Verbindung setzen. Außerdem sieht er Reformerfordernisse im Bereich des kirchlichen Rechts und des Prozessrechts. Die deutschen Bischöfe sind bereit, auf weltkirchlicher Ebene mitzuhelfen, das Kirchenrecht in dieser Hinsicht weiterzuentwickeln.“
Es bleibt abzuwarten, inwieweit diese Überlegungen auf gesamtkirchlicher Ebene Schule machen werden und ob es dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz gelingt, anlässlich der kommenden Internationalen Tagung konkrete Vorschläge zu etablieren. Umgekehrt darf man gespannt sein, ob am Ende jener Tagung vielleicht neue (und andere als vom Ständigen Rat angedachte?) kirchenrechtliche Normen zum Umgang mit Straftätern sowie zum Umgang mit dem nachgelagerten Skandal der Vertuschung von Straftaten bekannt gemacht werden. In jedem Fall wird der Bericht des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz über seine Dienstreise nach Rom von größtem Interesse für das Kirchenrecht sein.
c. 252 § 3 CIC
„Lectiones habeantur theologiae dogmaticae, verbo Dei scripto una cum sacra Traditione semper innixae, quarum ope alumni mysteria salutis, s. Thoma praesertim magistro, intimius penetrare addiscant, itemque lectiones theologiae moralis et pastoralis, iuris canonici, liturgiae, historiae ecclesiasticae, necnon aliarum disciplinarum, auxiliarum atque specialium, ad normam praescriptorum institutionis sacerdotalis Rationis.
„Es sind Vorlesungen in dogmatischer Theologie zu halten, die sich immer auf das geschriebene Wort Gottes zusammen mit der heiligen Tradition stützen; mit deren Hilfe sollen die Alumnen die Heilsgeheimnisse, vor allem unter Anleitung des hl. Thomas als Lehrer, tiefer zu durchdringen lernen; ebenso muss es gemäß den Vorschriften der Ordnung für die Priesterausbildung Vorlesungen geben in Moraltheologie, Pastoraltheologie, Kirchenrecht, Liturgiewissenschaft, Kirchengeschichte und in Hilfs- und Spezialwissenschaften.“
von Martin Rehak
Abgesehen von allem Anderen, das sonst noch in c. 252 § 3 CIC an Lesenswertem und theologisch Gehaltvollem steht, ist diese Norm des kodikarischen Rechts auch deshalb eine nähere Betrachtung wert, weil es sich um den einzigen Kanon des geltenden Kodex handelt, in dem mit Thomas von Aquin (um 1225–1274) eine Persönlichkeit der Kirchengeschichte namentlich erwähnt wird. Der geltende Kodex unterscheidet sich in diesem Punkt von seinem Vorgänger aus dem Jahre 1917, insofern dort noch etliche weitere Personen namentliche Erwähnung gefunden haben.
Die Erwähnung eines scholastischen Theologen in c. 252 § 3 CIC verdankt sich letztlich der Begeisterung Papst Leos XIII. (1878–1903) für den „Doctor angelicus“ (Thomas Aquinas) und der deshalb von ihm am 4. August 1879 veröffentlichten Enzyklika Aeterni patris, in ASS 12 (1879) 97–115, die auch als „Thomas-Enzyklika“ bekannt wurde. Darin rühmte der Papst zunächst die gedankliche Schärfe der scholastischen Theologie im Allgemeinen; hob dann Thomas mit seiner unübertroffenen Unterscheidung und Synthese von Glaube und Vernunft hervor; erinnerte an die beeindruckende Wirkungsgeschichte des dominikanischen Kirchenlehrers; und schwor die zeitgenössische Theologie auf Thomas als ihren nach wie vor maßgeblichen Lehrmeister ein. Die Bischöfe wurden aufgefordert, die „auream sancti Thomae sapientiam“ (a.a.O., 114), also die goldene Weisheit des hl. Thomas, wiederherzustellen. Dabei impliziert – wie der Papst ausdrücklich betonte – der Terminus „Weisheit“, dass sich die heutige (1879), progressiv-fortschrittsoffene Theologie gerade nicht mit einer schlichten Wiederholung von 600 Jahre alten Erklärungen begnügen könne, sondern die Methode und das theologische Know-How des Aquinaten für die Gegenwart fruchtbar zu machen sei; während zugleich all das auszusondern ist, was in den damaligen (13. Jh.) Lehrmeinungen allzu spitzfindig, heute überholt, oder vielleicht sogar irrtümlich war.
Der pio-benediktinische Kodex von 1917 hat diesen Impuls aufgegriffen und sowohl in can. 589 CIC/1917 bezüglich des theologischen Studiums in klerikalen Ordensgemeinschaften als auch in can. 1366 § 2 CIC/1917 bezüglich des wissenschaftlichen Theologiestudium an Priesterseminaren ebenfalls Thomas von Aquin ausdrücklich erwähnt. Dabei ist vor allem in can. 1366 § 2 CIC/1917 die Intention Leos XIII. gut erfasst: Forschung und Lehre sind „ad Angelici Doctoris rationem, doctrinam et principia“, also nach der Methodik, der Lehre und den Prinzipien des Aquinaten zu betreiben.
Auch jüngere Verlautbarungen des Lehramts haben an dieser Linie festgehalten und Thomas als den theologischen Lehrmeister par excellence ausgerufen (vgl. Vat. II., Dekret Optatam totius über die Neuordnung der Priesterausbildung, Nr. 16,3; Deutsche Bischofskonferenz, Rahmenordnung für die Priesterbildung [2003], Nr. 77 = Die deutschen Bischöfe 73, 53). Von daher erweist sich c. 252 § 3 CIC als inhaltlich in der Tradition von can. 1366 § 2 CIC/1917 stehend, in der Formulierung jedoch mit erkennbaren Anleihen aus Optatam totius.
Wer aber waren die weiteren Personen, die es namentlich in den Kodex von 1917 geschafft haben? Summarisch gesagt, handelte es sich durch die Bank um diverse Päpste als universalkirchliche Gesetzgeber, die zusammen mit den von ihnen erlassenen und in Bezug genommenen Rechtsdokumenten genannt wurden.
Im Einzelnen handelte es sich um folgende Päpste bzw. Kanones:
Am häufigsten wurde Pius X. (1903–1914) genannt, der das Kirchenrecht nicht nur durch seine Initiative für den Kodex von 1917, sondern auch durch eine vielfältige Gesetzgebungstätigkeit modernisiert hatte. Sein Name begegnet insgesamt vier Mal, und zwar stets im Zusammenhang mit der von ihm am 25. Dezember 1904 erlassenen Papstwahl-Konstitution Vacante Sede Apostolica, vgl. dazu im Einzelnen can. 160 CIC/1917 (Wahl des Papstes); can. 241 CIC/1917 (Vollmachten des Kardinalskollegiums im Falle der Vakanz des Apostolischen Stuhls); can. 262 CIC/1917 (Verwaltung der zeitlichen Güter des Apostolischen Stuhls bei Sedisvakanz); can. 2330 CIC/1917 (Straftaten anlässlich einer Papstwahl und deren Bestrafung). In allen vier Fällen wurde auf die besagte Konstitution verwiesen, wo die jeweilige Thematik abschließend geregelt war. Auch in der Ära des CIC/1983 ist das Papstwahlrecht außerhalb des Kodex normiert, derzeit durch Johannes Paul II., Apostolische Konstitution Universi dominici gregis vom 22. Februar 1996 (AAS 88 [1996] 305–343).
Benedikt XIV. (1740–1758) – der vermutlich fähigste Kanonist seiner Generation, der nahezu sein gesamtes Berufsleben vor seiner Papstwahl im Dienste der Kurie (u.a. Sekretär der Konzilskongregation, Postulator bei der Ritenkongregation) verbracht und als Papst eine intensive, in einem eigenen Bullarium gesammelte Gesetzgebungsaktivität entfaltet hatte – war im Kodex von 1917 zweimal namentlich vertreten. Die beiden einschlägigen Kanones betrafen formal das Recht des Bußsakraments; materiell betrafen sie besondere Fallkonstellationen sexuellen Fehlverhaltens, darunter insbesondere die Fälle des sexuellen und Gewissensmissbrauchs durch den Beichtvater. Benedikt XIV. wird jeweils im Zusammenhang mit seiner Konstitution Sacramentum Poenitentiae vom 1. Juni 1741 genannt. Die erste Erwähnung erfolgte in can. 884 CIC/1917, wo die so genannte absolutio complicis für ungültig erklärt wurde, den Fall der Todesgefahr des Beichtkinds ausgenommen. Insoweit ist can. 884 CIC/1917 nahezu wörtlich (unter Ersetzung von „in peccato turpi“ durch „in peccato contra sextum Decalogi“) in c. 977 CIC/1983 übernommen worden. Während jedoch can. 884 CIC/1917 darüber hinaus die Absolution durch den (mit)schuldigen Beichtvater, soweit es diesen anbelangt, auch im Falle der Todesgefahr des Beichtkinds für unerlaubt erklärte, wurde dieser Aspekt der Norm im Zuge der Kodexreform ersatzlos gestrichen. Can. 904 CIC/1917 verpflichtete Beichtkinder dazu, bei der zuständigen Autorität (Ortsordinarius oder S. Congregatio S. Officii) Anzeige gegen ihren Beichtvater zu erstatten, falls dieser sie anlässlich der Beichte zu einer Sünde gegen das sechste Gebot des Dekalogs zu verführen versuchte bzw. tatsächlich verführte. Inwieweit diese Norm sich allgemeiner Bekanntheit im gläubigen Volk erfreute und von daher im Ansatz geeignet war, die zuständigen Autoritäten auf Verbrecher in Soutane aufmerksam zu machen, ist ungewiss. Aus der einschlägigen Kommentierung bei Heribert Jone, Gesetzbuch der lateinischen Kirche. Erklärung der Kanones, Bd. 2, Paderborn 1952, 150–155, wird zudem deutlich, dass die Regelung potenziell auch dazu geeignet war, jene Beichtväter an höherer Stelle anzuschwärzen, die in subjektiv wohlmeinender pastoraler Absicht im Beichtgespräch liberale Ansichten zu Fragen der Sexualmoral äußerten. Im Zuge der Kodexreform wurde die Norm des can. 904 CIC/1917 ersatzlos aus dem kodikarischen Recht gestrichen. Eine Anzeigepflicht wird auch nicht von der einschlägigen außerkodikarischen Gesetzgebung, wie insbesondere den Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis vom 21. Mai 2010 (vgl. AAS 102 [2010] 419–430), statuiert. Allerdings wurde can. 904 CIC/1917 seinerzeit von der Strafnorm des can. 2368 § 1 CIC/1917 flankiert; das dort unter Strafe gestellte Fehlverhalten ist gemäß c. 1387 CIC a.F. = c. 1385 CIC n.F. nach wie vor strafbar.
Die eherechtliche Norm des can. 1125 CIC/1917 erwähnte gleich drei verschiedene Päpste namentlich: Paul III. (1534–1549) mit der Konstitution Altitudo vom 1. Juni 1537; Pius V. (1566–1572) mit der Konstitution Pontifices vom 2. August 1571; und Gregor XIII. (1572–1585) mit der Konstitution Populis vom 25. Januar 1585). Alle drei Konstitutionen hatten einen – gemäß der zeitgenössischen Geographie – genau beschriebenen territorialen Geltungsbereich (India occidentalis et meridionalis [Paul III., Pius V.]; Angola, Äthiopien, Brasilien und andere indische [!] Gebiete [Gregor XIII.]) und befassten sich zum einen mit dem Problem, wie bei Neubekehrten eine bislang polygame Verbindung in eine monogame christliche Ehe zu überführen sei; zum anderen mit der Frage, ob nach Bekehrung des einen Ehegatten eine Naturehe auch dann gemäß dem Privilegium Paulinum gelöst werden könne, wenn eine Befragung des anderen Ehegatten wegen räumlicher Trennung nach Gefangenschaft oder Verfolgung nicht durchführbar sei. Die besagten Regelungen sind im geltenden Kodex weiterhin enthalten (vgl. cc. 1148 § 1; 1149 CIC), freilich ohne jede Bezugnahme auf die ursprünglichen Gesetzgeber und ohne irgendeine territoriale Beschränkung.
Das Verfahren der Selig- und Heiligsprechungen war im Kodex von 1917 als ein Rechtsstreit zwischen dem Postulator der Heiligsprechung und dem advocatus diaboli ausgestaltet und vollständig innerhalb des kodikarischen Prozessrechts geregelt. Dabei enthielt can. 2021 CIC/1917 eine Legaldefinition des Begriffs der „unvordenklichen“ öffentlichen Verehrung eines Dieners Gottes. Unvordenklichkeit lag demnach dann vor, wenn zu der Zeit, als Urban VIII. (1623–1644) mit dem Breve Caelestis Hierusalem vom 5. Juli 1634 eigene Regeln für das Verfahren der Selig- und Heiligsprechung statuierte, eine Verehrung durch mindestens 100 Jahre alte Dokumente bzw. ggf. auch durch jüngere Dokumente, die sich auf die Zeit vor 1534 bezogen, beweisbar war. Diese Regelung ist für die Praxis der Selig- und Heiligsprechungsverfahren nach wie vor relevant, vgl. Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse, Instruktion Sanctorum Mater vom 17. Mai 2007, Art. 33 (AAS 99 [2007] 465–510).
Man wird geteilter Meinung darüber sein können, ob die vorstehend geschilderte Verweistechnik bzw. die namentliche Erinnerung an die ursprünglichen Schöpfer bestimmter kirchlicher Normen in allen einzelnen Fällen die hohe Schule kodikarischer Gesetzgebung darstellt, oder eher als ein Anfängerfehler der Architekten und Redakteure des Kodex von 1917 zu werten ist. Umgekehrt hatten die genannten Kanones des alten Kodex jedoch auf ihre Weise in Erinnerung gehalten, dass das ius mere ecclesiasticum, das rein kirchliche Recht, in konkreten geschichtlichen Kontexten von und für Menschen gemacht worden ist. Diese Erinnerung ist für eine Zeit, in der sich gerade unter Kirchenrechtlern eine anonymisierend-überhöhende Sprechweise von „dem Gesetzgeber“ eingeschliffen hat, bei der die Person gleichsam hinter ihrer Funktion versteckt wird, ein wohltuender Kontrapunkt.
cc. 85; 87 § 1 CIC
c. 85: „Dispensatio, seu legis mere ecclesiasticae in casu particulari relaxatio, […]“
„Eine Dispens, das heißt die Befreiung von einem rein kirchlichen Gesetz in einem Einzelfall, […]“
c. 87 § 1: „Episcopus dioecesanus fideles, quoties id ad eorundem spirituale bonum conferre iudicet, dispensare valet in legibus disciplinaribus […]“
„Der Diözesanbischof kann die Gläubigen, sooft dies nach seinem Urteil zu deren geistlichem Wohl beiträgt, von Disziplinargesetzen dispensieren, […]“
von Martin Rehak
Es ist schon so einiges über die Westernkomödie Two Mules for Sister Sara (Shirley MacLaine, Clint Eastwood, Don Siegel, Universal Pictures 1970; dt.: Ein Fressen für die Geier) geschrieben worden, die im Italo-Stil die Romanze des Söldners Hogan (Eastwood) und der als Ordensfrau verkleideten Rebellin Sara (MacLaine) vor dem Hintergrund der französischen Besatzung Mexikos in den Jahren 1861 bis 1866 erzählt.
Beispielsweise über den süffisanten Filmtitel, durch den Mr. Hogan implizit als Esel bzw. Maultier charakterisiert wird; über die inhaltlichen Parallelen zu The African Queen (Katharine Hepburn, Humphrey Bogart, John Huston, United Artists 1951, dt.: African Queen) und Heaven Knows, Mr. Allison (Deborah Kerr, Robert Mitchum, John Huston, Twentieth Century Fox 1957, dt.: Der Seemann und die Nonne); über die angeblichen Differenzen am Set zwischen den Hauptdarstellern; oder über die legendäre, von Quentin Tarantino in den Soundtrack von Django Unchained (Columbia Pictures 2012) aufgenommene Filmmusik The Braying Mule von Ennio Morricone, die lautmalerisch das „I-Ah“ eines Esels nachahmt und mit der Gesangszeile „et ne nos inducas in tentationem (dt.: und führe uns nicht in Versuchung)“ ein Generalthema des Films benennt.
Aus kirchenrechtlicher Sicht zieht vor allem ein Running Gag des Films die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich. Die gemeinsamen Abenteuer nötigen die Protagonistin mehrfach dazu, unter Verweis auf das Rechtsinstitut der Dispens ihr nicht immer sehr nonnenhaftes Verhalten zu rechtfertigen, und zwar insbesondere in folgenden Situationen:
- Mr. Hogan fasst Sr. Sara am Hintern an, um ihr in (vermeintlicher) Gefahr durch ein Raubtier beim Erklettern eines Baumes zu helfen („In emergencies, the Church grants dispensation [dt.: In Notfällen erteilt die Kirche Dispens]“);
- Sr. Sara reitet mit dem verletzten und betrunkenen Mr. Hogan auf einem Pferd („The Church allows this for your safety [dt.: Wenn es um die Sicherheit geht, erlaubt die Kirche Ausnahmen]“);
- Sr. Sara begleitet Mr. Hogan (als Dolmetscherin) in eine Kneipe („In times like this… …the Church grants dispensation [dt.: In Zeiten wie diesen… …gewährt die Kirche Dispens]“).
Dem aufmerksamen Kanonisten sei dies alles ein hinreichender Anlass, in eine eingehende Sachprüfung einzusteigen: Stimmt das überhaupt, was Sr. Sara über das kirchliche Dispenswesen zu sagen hat? Oder sind hier kirchenrechtliche Filmfehler zu entdecken?
Der im 19. Jh. vorherrschende Dispensbegriff kann aus zeitgenössischen Lehrbüchern erhoben werden. Beispielsweise Isidor Silbernagl und Rudolf Ritter von Scherer bestimmten Dispens übereinstimmend als die Suspension eines Gesetzes für den einzelnen Fall (vgl. Silbernagl, Permaneder’s Handbuch des gemeingiltigen katholischen Kirchenrechtes, Landshut 1865, S. 484; Scherer, Handbuch des Kirchenrechts, Bd. 1, Graz 1886, S. 172).
Der Dispensbegriff des CIC/1983 ergibt sich aus den cc. 85 und 87 § 1, die ihrerseits teils auf die Vorgängernorm des can. 80 CIC/1917 sowie auf die schon aus älterer Zeit bekannten Definitionen, teils auf das Dekret Christus Dominus über die Hirtenaufgabe der Bischöfe des Zweiten Vatikanischen Konzils, dort Nr. 8b, in: AAS 58 (1966) 673–701, 676, und auf Paul VI., Motu Proprio De Episcoporum muneribus vom 15.06.1966, in: AAS 58 (1966) 467–472, zurückzuführen sind. Demnach meint Dispens die Befreiung (durch Verwaltungsakt der zuständigen Autorität) von einem rein kirchlichen Gesetz im Einzelfall (vgl. c. 85 CIC), um dadurch das geistliche Wohl der begünstigten Personen zu fördern (vgl. c. 87 § 1 CIC). (Dass im kodikarischen Prozessrecht des CIC/1983 auch die gnadenweise Auflösung einer nichtvollzogenen Ehe als „Dispens“ bezeichnet wird [vgl. cc. 1697, 1698 CIC] ist als Relikt älteren Sprachgebrauchs und als Redaktionsfehler zu werten.) Dabei verdeutlicht die finale Ausrichtung etwaiger Dispensen auf das geistliche Wohl, dass Dispensen kein Selbstzweck sind, sondern der konkreten Verwirklichung der aus c. 1752 CIC bekannten Maxime dienen, dass in der Kirche das Seelenheil der Gläubigen das oberste Gesetz zu sein hat.
Hinsichtlich der zuständigen Autorität hat mit dem CIC/1983 ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Jahrhundertelang war das so genannte Konzessionssystem praktiziert worden, wonach die Gewährung von Dispensen durch den Diözesanbischof einer Gestattung des Papstes bedurfte, die üblicherweise als „Quinquennalfakultät“ auf je fünf Jahre befristet gewährt wurde. Demgegenüber gilt nunmehr das so genannte Reservationssystem, wonach für Dispensen nur dann der Diözesanbischof nicht zuständig ist, wenn sich der Apostolische Stuhl die Zuständigkeit vorbehalten hat. Für diesen Paradigmenwechsel hatte sich auch die Generalversammlung der Bischofssynode ausgesprochen, als sie im Herbst 1967 zehn Prinzipien für die Kodexreform billigte (vgl. Principia quae Codicis Iuris Canonicis recognitionem dirigant, in: Communicationes 1 [1969] 77–85, 80 [Prinzip Nr. 4]). Im Zuge dessen wurde auch geklärt, dass die Gewährung von Dispensen nicht als ein Akt der Gesetzgebung, sondern als einer der Verwaltung anzusehen ist. Der Erwägung, mit welcher das Konzessionssystem rechtssystematisch begründet wurde, nämlich dass nur der Gesetzgeber selbst von seinem Gesetz befreien könne, ist damit der Boden entzogen. Zugleich relativiert diese neue Systematik allerdings auch den genannten Paradigmenwechsel: Insofern die Dispensen nunmehr nur durch Einzelverwaltungsakte zu gewähren sind, ist damit auch ein jahrhundertelang schwelender Streit um die Möglichkeit allgemeiner, faktisch wie Gesetze wirkender Dispensen durch die Diözesanbischöfe beendet worden. Darüber hinaus gilt nach wie vor der Gesetzgeber als der einzige originäre Inhaber von Dispensgewalt, der die Ausübung derselben durch andere Autoritäten abstrakt regeln kann und muss.
Von daher ist zusammenfassend festzustellen, dass der Dispensbegriff der vorgeblichen Nonne in unserem Film letztlich nicht mit dem kanonischen Dispensbegriff übereinstimmt. (Was Sr. Sara als „Dispens“ bezeichnet, wäre wohl besser unter den Begriff „Epikie“ zu fassen; zumal das oben geschilderte Verhalten womöglich zwar gegen Sitte und Moral, aber – abgesehen vom Ausgang einer Nonne ohne Begleitung durch eine Mitschwester, vgl. dazu can. 607 CIC/1917 – letztlich nicht gegen konkrete [zeitgenössische] universalkirchliche Normen verstößt.) Aber eines hat die ebenso clevere wie schlagfertige Dame intuitiv erkannt: Das Kirchenrecht versteht sich selbst keineswegs als ein starres deontologisches System, sondern zeichnet sich durch ein hohes Maß an Flexibilität aus, um – beispielsweise mittels Dispensen – möglichst allen individuellen Einzelfällen gerecht zu werden.
-
KdM_8__85_87_1__Dispens.pdf 406 KB
c. 1342 § 2 CIC [a.F. = n.F.]*
“Per decretum irrogari vel declarari non possunt poenae perpetuae, […].”
„Strafen für immer können nicht durch Dekret verhängt oder festgestellt werden, […].“
* Mit der Apostolischen Konstitution „Pascite gregem Dei“ vom 23. Mai 2021 hat Papst Franziskus Kanones im Buch VI des CIC/1983 „Strafbestimmungen in der Kirche“ promulgiert (Kanones lat.; Kanones dt.). Sie sind am 08.12.2021 in Kraft getreten. Die Bestimmung des c. 1342 § 2 CIC blieb dabei unverändert.
von Martin Rehak
In den Annalen der katholischen Hierarchie – die einschlägigen Nachschlagewerke, etwa Konrad Eubel, Hierarchia catholica; Pius Gams, Series episcoporum, sind ebenso wie Informationen aus dem Annuario Pontificio und dem Bollettino des päpstlichen Pressesaals recht zuverlässig in der Datenbank catholic-hierarchy.org zusammengeführt – war das Phänomen eines laisierten katholischen Bischofs bis vor wenigen Jahren eine kaum denkbare Rarität. Einen gesondert gelagerten Präzedenzfall stellte der berühmte Staatsmann und Diplomat Charles-Maurice de Talleyrand (1754–1838) dar, der vor seiner politischen Karriere von 1788 bis 1791 Bischof von Autun (Frankreich) war. Danach vergingen über 200 Jahre, ehe 2008 der schon 2005 von seinem kirchlichen Amt zurückgetretene Bischof von San Pedro (Paraguay), Fernando Lugo SVD, auf eigenen Wunsch laisiert wurde: Nach offizieller Darstellung, um ihm als dem gewählten paraguayischen Staatspräsidenten, im Einklang mit der Verfassung Paraguays, die geistliche Amtsträger von höchsten Staatsämtern ausschließt, den Antritt dieses politischen Amtes zu ermöglichen. Dass Lugo zu diesem Zeitpunkt wohl schon seit mehreren Jahren eine intime Beziehung zu einer blutjungen Frau hatte und 2007 Vater geworden war, mag dem Vatikan diese Entscheidung erleichtert haben (falls er schon damals davon wusste). Im Mai 2012 gab die kanadische Bischofskonferenz bekannt, dass der vormalige Bischof von Antigonish (Kanada), Raymond Lahey, aus dem Klerikerstand entlassen worden sei, nachdem er sich zuvor vor einem staatlichen Gericht des Besitzes kinderpornographischen Materials für schuldig bekannt hatte. Ihm folgte ein Jahr später der Titularbischof von Usula (Nordafrika) und Weihbischof in Ayacucho (Peru), Gabino Miranda. Im Mai 2013 erklärte er seinen Amtsverzicht, ehe er wenige Monate später laisiert wurde. Allerdings erhoben alsbald sowohl Miranda wie auch der Kardinalerzbischof von Lima (Peru), Juan Cipriani, schwere Vorwürfe gegen diese Entscheidung: Miranda sei Opfer eines ungerechten Verfahrens; er habe sich nicht angemessen verteidigen können; die verhängte Sanktion sei völlig unverhältnismäßig. Wieder ein Jahr später hatte sich der vatikanische Diplomat und Titularerzbischof von Slebte (Irland), Józef Wesołowski, wegen des Vorwurfs des sexuellen Kindesmissbrauchs vor der Kongregation für die Glaubenslehre zu verantworten. Das erstinstanzliche Urteil gegen ihn datierte vom 27.06.2014 und lautete auf strafweise Entlassung aus dem Klerikerstand.
Die Kongregation für die Glaubenslehre, die ebenso wie die übrigen Kongregationen der Römischen Kurie in erster Linie als eine Verwaltungsbehörde des Apostolischen Stuhls konzipiert ist, ist in drei Sektionen oder Ämter gegliedert (Lehre, Disziplin, Ehesachen). Das Ufficio Disciplinare ist dabei gemäß Art. 52 der Apostolischen Konstitution Pastor Bonus auch zuständig für die sogenannten schwerwiegenderen Straftaten (graviora delicta) und übernimmt insoweit nicht nur Funktionen der Verwaltung, sondern auch der Rechtsprechung.
Die Entlassung aus dem Klerikerstand („Laisierung“) ist dabei eine (und zugleich die gravierendste) jener typischen Sühnestrafen, die der Kodex des kanonischen Rechts in c. 1336 § 1 Nr. 5 CIC a.F. = c. 1336 § 5 CIC n.F. auflistet. Zugleich ist die strafweise Entlassung – neben der Feststellung der Nichtigkeit der Weihe und der gnadenweisen Entlassung – eine der drei in c. 290 CIC typisierten Weisen, auf die ein Kleriker des klerikalen Standes verlustig gehen kann. Gemäß c. 292 CIC führt der Verlust des klerikalen Standes zum Erlöschen aller Rechte und Pflichten dieses Standes, mit Ausnahme der Zölibatsverpflichtung (vgl. cc. 291, 292 CIC), von der grundsätzlich, d.h. sofern der Papst keine Sondervollmachten erteilt hat, nur aufgrund einer separaten, dem Papst vorbehaltenen Entscheidung befreit werden kann.
Wesołowski legte gegen das Urteil der Kongregation Berufung ein, über die im Oktober 2014 verhandelt werden sollte. Ob es hierzu jemals kam, geht aus den Verlautbarungen des vatikanischen Pressesaals nicht hervor. Denn bereits im September 2014 wurde der frühere Nuntius im Vatikan verhaftet und von den Behörden des Staates der Vatikanstadt erneut strafrechtlich verfolgt, diesmal wegen des Besitzes von kinderpornographischem Material. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde erst im Juli 2015 der Prozess eröffnet, aber wegen Erkrankung des Angeklagten sofort wieder unterbrochen. Ende August 2015 verstarb Wesołowski.
Mit Wirkung vom 11.10.2018, unmittelbar vor einem Besuch des chilenischen Präsidenten am übernächsten Tag im Vatikan, hat Papst Franziskus kürzlich den emeritierten Erzbischof von La Serena (Chile), Francisco Cox, sowie den vormaligen Bischof von Iquique (Chile), Marco Órdenes, aus dem Klerikerstand entlassen.
Wie einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Koblenz vom 08.10.2018 sowie Verlautbarungen der Schönstatt-Bewegung Deutschland vom 06.10.2018 bzw. des Generaloberen der Gemeinschaft der Schönstatt-Patres vom 04.10.2018 zu entnehmen ist, war Cox – nachdem im November 2017 die Anzeige eines Geschädigten bei dem Missbrauchsbeauftragten der Schönstatt-Patres eingegangen und eine interne Untersuchung durchgeführt worden war – offenbar erst Anfang August 2018 bei den staatlichen und kirchlichen Strafverfolgungsbehörden formell angezeigt worden. (Die Vorgehensweise des Missbrauchsbeauftragten, zunächst intern die Angelegenheit zu prüfen, steht im Einklang mit einschlägigen kirchlichen Vorschriften und duldet im Übrigen schon deshalb keine Kritik, weil es dem Geschädigten selbst unbenommen gewesen wäre, sich anstatt an die zuständige kirchliche Stelle sofort unmittelbar an die Staatsanwaltschaft zu wenden und dort Anzeige zu erstatten.)
Anscheinend hat Rom hier also mit dem chilenischen Alterzbischof einen buchstäblichen „kurzen Prozess“ gemacht, bei dem es zu keiner ordentlichen Gerichtsverhandlung gekommen ist. (Dieses Urteil drängt sich einem Außenstehenden schon deshalb auf, weil es in den veröffentlichten Informationen zu diesem Fall nicht den geringsten Hinweis darauf gibt, dass der Beschuldigte nach Rom zitiert worden wäre oder sich ein kuriales Gericht zur Verhandlung des Falles nach Vallendar begeben hätte.)
Ein solches Vorgehen muss vom Standpunkt des kodifizierten kirchlichen Straf(prozess)rechts zunächst einmal irritieren.
Denn c. 1342 § 2 CIC erklärt unmissverständlich, dass Strafen für immer – und hierunter ist nach Lage der Dinge die Entlassung aus dem Klerikerstand zu rechnen – nicht per Dekret verhängt werden können. Die tiefere Bedeutung dieser Festlegung erschließt sich, sobald man sich klar gemacht hat, dass das kirchliche Strafverfahrensrecht traditioneller Weise zwei verschiedene Wege der Strafverhängung kennt (vgl. dazu zunächst c. 1341 CIC a.F. = n.F.); entweder den Gerichtsweg; oder den so genannten außergerichtlichen Weg oder Verwaltungsweg (der im Vergleich mit dem staatlichen deutschen Recht in etwa dem Strafbefehl-Verfahren ähnelt). Ein kirchliches Strafverfahren auf dem Verwaltungsweg endet mit einem Strafdekret (bzw. einer Einstellung des Verfahrens per Dekret), wobei nach dem eben Gesagten ein solches Strafdekret allenfalls zeitlich befristete Strafen aussprechen darf. Ein kirchliches Strafverfahren auf dem Gerichtsweg endet mit einem Urteil. Die prozessuale Regelung des Strafverfahrens auf dem Verwaltungsweg erschöpft sich in der Norm des c. 1720 CIC: Der Beschuldigte ist mit der Anklage und den Beweisen zu konfrontieren und ihm ist Gelegenheit zur Verteidigung zu geben. Der Erlass des Strafdekrets fällt dabei in die Zuständigkeit des Ordinarius des Beschuldigten, der aber bereits für die kanonische Voruntersuchung gemäß cc. 1717–1719 CIC zuständig war. Der gerichtliche Strafprozess ist in cc. 1721–1728 CIC skizziert. Hier ist der voruntersuchende Ordinarius nicht weiter beteiligt, sondern wird gegenüber dem kirchlichen Strafgericht von seinem Kirchenanwalt (vgl. dazu cc. 1430–1436 CIC; entspricht im Vergleich mit dem deutschen Recht in etwa einem Staatsanwalt) vertreten. Das kirchliche Recht lässt zwar in c. 1342 § 1 CIC a.F. = n.F. eine klare Präferenz für den Gerichtsweg erkennen, insofern für ein Strafverwaltungsverfahren verlangt wird, dass dem Gerichtsverfahren gerechte Gründe entgegenstehen. In der Praxis wird dies in der Wahl zwischen Verwaltungs- und Gerichtsweg oft auf eine Ermessensentscheidung des zuständigen Ordinarius hinauslaufen, der typischerweise das Interesse an mehr Schnelligkeit und Flexibilität im Verwaltungsverfahren gegen das Interesse an größerer Rechtssicherheit und bestmöglichem Rechtsschutz zugunsten des Beschuldigten im Gerichtsverfahren gegeneinander abwägen wird. Insoweit obliegt dem zuständigen Ordinarius im Lichte des c. 1342 § 2 CIC a.F. = n.F. auch eine Prognoseentscheidung darüber, ob hinsichtlich des (in Relation zur Schwere der Anschuldigungen) angemessenen Strafrahmens eine Sühnestrafe für immer zu erwarten ist bzw. aus Sicht des Ordinarius wünschenswert wäre. In diesem Fall hat er hinsichtlich der beiden vom Gesetz etablierten Wege der Strafverhängung gerade keine Wahl mehr, sondern muss sich für den Gerichtsweg entscheiden, weil – wie bereits gesagt – gemäß c. 1342 § 2 CIC Strafen für immer nur durch ein Urteil auf dem Gerichtsweg ausgesprochen werden dürfen.
Doch wie so oft im Leben gilt auch hier: Keine Regel ohne Ausnahme. Denn der Kongregation für die Glaubenslehre sind kraft des Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela vom 30.04.2001 in Verbindung mit den Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrinda Fidei reservatis in der Fassung vom 21.05.2010 (vgl. AAS 102 [2010] 419–430) diverse Sondervollmachten eingeräumt worden. Zwar betont Art. 21 § 1 der Normae, dass die der Kongregation vorbehaltenen schwerwiegenderen Straftaten – zu denen gemäß Art. 6 § 1 Nr. 1 Normae de gravioribus delictis (= c. 1398 § 1 Nr. 1 CIC n.F.) sexuelle Verfehlungen gegenüber Minderjährigen unter 18 Jahren und gemäß Art. 6 § 1 Nr. 2 Normae de gravioribus delictis (= c. 1398 § 1 Nr. 3 CIC n.F.) der Umgang mit pornographischen Bildern von Minderjährigen unter 14 Jahren zählen – grundsätzlich auf dem Gerichtsweg und in einem kanonischen Strafprozess zu untersuchen sind. Unter Umständen besteht indes für die Kongregation die Möglichkeit, kurzen Prozess zu machen und auf dem Verwaltungsweg eine zügige Entscheidung des Papstes vorzubereiten; dies regelt Art. 21 § 2 Nr. 2 der Normae:
„Es steht der Kongregation für die Glaubenslehre jedoch frei: […] Sehr schwerwiegende Fälle, bei denen die begangene Straftat offenkundig ist und dem Angeklagten die Möglichkeit zur Verteidigung gegeben worden war, direkt dem Papst zur Entscheidung über die Entlassung aus dem Klerikerstand oder über die Absetzung zusammen mit der Dispens von der Zölibatsverpflichtung vorzulegen.“
Wie der einschlägigen Verlautbarung des vatikanischen Pressesaales vom 12.10.2018 zu entnehmen ist, soll der Kongregation in den Fällen Cox und Órdenes dieser Weg deshalb eröffnet gewesen sein, weil die jeweiligen Beweise, die der Kongregation vorgelegt wurden, in offenkundiger Weise bezeugten, dass die Angeklagten strafbare Akte des Missbrauchs von Kindern begangen haben.
Unter welchen genauen tatsächlichen Gegebenheiten die Beweislage in derartigen Verfahren als „offenkundig“ bezeichnet werden kann, muss letztlich wohl immer eine Frage des Einzelfalles bleiben. Sehr einfach gelagert dürften indes jene Fälle sein, in denen ein glaubwürdiges Geständnis des Angeklagten vorliegt (was beispielsweise im Fall Cox angesichts der Einlassungen aus Vallendar, Cox zeige Anzeichen von Demenz, zweifelhaft sein könnte).
Im Vergleich mit dem Fall Wesołowski wird man also aus der Beobachterperspektive sagen können: Entweder war die Schuld des Angeklagten aufgrund der seinerzeitigen Beweise keineswegs offenkundig, so dass damals für die Kongregation an einem ordentlichen Prozess kein Weg vorbei führte. Oder sie hat aus dem prozessualen Drama von 2014/15 gelernt und nunmehr den für eine erfolgreiche Anklage und schnelle Verurteilung zielführenderen Weg gewählt.
Dabei fungiert die Glaubenskongregation bei einer Vorgehensweise gemäß Art. 21 § 2 Nr. 2 der Normae nicht als Gericht, sondern als Verwaltungsbehörde, die ein Strafdekret des Papstes vorbereitet. Die Entscheidung vom 11.10.2018 ist daher schon nach der Logik der Normae keine Entscheidung der Kongregation, sondern eine päpstliche Entscheidung. Sie ist damit aus sich heraus unanfechtbar und nicht berufungsfähig, was vom vatikanischen Pressesaal vorsichtshalber noch einmal ausdrücklich betont wurde.
Welches (kanonistische) Fazit ist aus alldem zu gewinnen? Lässt sich hier vom prozessrechtlichen Standpunkt aus sagen: Ende gut, alles gut?
Wohl kaum. Der Angeklagte Órdenes hatte – mutmaßlicher Weise wegen jener Vorwürfe, die nun zu seiner strafweisen Entlassung aus dem Klerikerstand führten – bereits im Jahre 2012 auf sein Bischofsamt verzichtet. Das Rücktrittsgesuch des Angeklagten Cox wurde bereits 1997 angenommen, so dass man mutmaßen muss: Er war bei dem nunmehr abgestraften Fall, der sich im Jahre 2004 in Vallendar zugetragen haben soll, mitnichten ein Ersttäter.
Auch kurze Prozesse können eine lange Vorgeschichte haben.
c. 838 §§ 2,3 CIC n.F.
㤠2. Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere, aptationes, ad normam iuris a Conferentia Episcoporum approbatas, recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur.
§ 3. Ad Episcoporum Conferentias spectat versiones librorum liturgicorum in linguas vernaculas fideliter et convenienter intra limites definitos accommodatas parare et approbare atque libros liturgicos, pro regionibus ad quas pertinent, post confirmationem Apostolicae Sedis, edere.“
„§ 2. Sache des Apostolischen Stuhles ist es, die heilige Liturgie der ganzen Kirche zu ordnen, die liturgischen Bücher herauszugeben, die von den Bischofskonferenzen nach Maßgabe des Rechts approbierten Anpassungen zu überprüfen sowie darüber zu wachen, dass die liturgischen Ordnungen überall getreu eingehalten werden.
§ 3. Die Bischofskonferenzen haben die innerhalb der festgesetzten Grenzen angepassten Übersetzungen der liturgischen Bücher in die Volkssprachen getreu und angemessen zu besorgen und zu approbieren sowie die liturgischen Bücher für die Regionen, für die sie zuständig sind, nach der Bestätigung durch den Apostolischen Stuhl herauszugeben.“
von Anna Krähe
Mit dem 1. Oktober 2018 jährt sich zum ersten Mal das Inkrafttreten der letzten Änderung des CIC/1983 durch das Motu proprio Magnum principium vom 3. September 2017, mit dem Papst Franziskus die §§ 2 und 3 des c. 838 CIC änderte (vgl. hierzu Letterae Apostolicae Magnum Principium v. 03.09.2017: Com 49 [2017], 255–257; it.: ebd., 258–261; dt. Übersetzung). Das Pontifikat von Franziskus zeichnet sich immer wieder durch rechtliche Akzente aus, die der amtierende Papst gern und inzwischen in fast schon gewohnter Weise durch Gesetzesänderungen vorzugsweise in der „Sommerpause“ setzt. Wie alle derartigen Gesetzesänderungen des amtierenden Papstes rief auch Magnum principium ein größeres mediales Echo hervor, wobei sich die besondere Aufmerksamkeit wohl dem öffentlich ausgetragenen Konflikt des Papstes mit dem Präfekten der Gottesdienstkongregation, Kardinal Robert Sarah, verdankt (vgl. Robert Sarah, Humble contribution pour une meilleure et juste compréhension du Motu Proprio Magnum Principium v. 01.10.2017 [franz.]; dt. Übersetzung: Robert Sarah, Demütiger Beitrag für ein besseres Verständnis des Motu Proprio; vgl. Franziskus, Brief an Kardinal Robert Sarah vom 15.10.2017).
Dabei spiegelt die Änderung des c. 838 CIC aber weit mehr als unterschiedliche Positionen zwischen dem Papst und dem Vorsitzenden der Gottesdienstkongregation. Mit dem Motu proprio rückt Franziskus als magnum principium die Notwendigkeit der Verständlichkeit liturgischer Texte, die sich auch in einem verantwortungsvollen Umgang mit muttersprachlichen Übersetzungen zeigt, in den Vordergrund und hebt ihre wichtige Funktion hervor. Nicht zuletzt liefert der Papst damit zugleich eine klare Umsetzung seines schon in Evangelii gaudium (vgl. Franziskus, Adhortatio Apostolica Evangelii gaudium v. 24.11.2013: AAS 105 [2013], 1019–1137; dt.: VApSt Nr. 194, Bonn 2013) herausgestellten Projekts einer Dezentralisierung (vgl. Nr. 16) und besonders auch rechtlichen Stärkung der Bischofskonferenzen (vgl. Nr. 32).
Wie Franziskus schon in seiner Erläuterung herausstellt, knüpft diese Gesetzesänderung an die Liturgiekonstitution Sacrosanctum concilium (= SC; dt. Übersetzung) an und verdeutlicht somit die lange, auch gesetzgeberische Geschichte, in die sich der c. 838 CIC einreiht. In SC 36 § 2 hatten die Konzilsväter die Tür für muttersprachliche Übersetzungen „vor allem in Lesungen und Hinweisen und in einzelnen Orationen und Gesängen“ geöffnet, mit der Begründung, dass „die Verwendung der Muttersprache beim Volk sehr nützlich sein kann“. Diese noch zurückhaltende Ermöglichung landessprachlicher liturgischer Texte nahm in der Folge des Konzils eine Eigendynamik an, die zu den uns heute vertrauten liturgischen Feiern in den jeweiligen Mutter- bzw. Landessprachen führte. Daraus resultierte die Notwendigkeit der Übersetzung der ursprünglich lateinischen Texte. Franziskus erläutert diesen Schritt als Öffnung, „damit die Übersetzungen als Teil der Riten selbst zusammen mit der lateinischen Sprache zur Stimme der die göttlichen Geheimnisse feiernden Kirche würden.“ Schon die Konzilsväter gaben allgemeine Regelungen zur Zuständigkeit für diese Übersetzungen vor: Nach SC 36 § 3 sollte die zuständige kirchliche Autorität, womit die Bischofsversammlungen (vgl. SC 22 § 2) und nach heutigem Verständnis die Bischofskonferenzen gemeint waren, „Bestimmungen über den Gebrauch und das Maß der Muttersprache“ treffen. Bewusst formulierten die Konzilsväter, dass zuvor ein actus probatus seu confirmatus, also eine Billigung bzw. Bekräftigung durch den Apostolischen Stuhl für diese Beschlüsse zu erfolgen habe. Bezüglich der Übersetzungen selbst wurde in SC 34 § 4 den Bischofskonferenzen das Approbationsrecht zugesprochen. Damit war gemeint, dass sie die Übersetzungen in formaler und inhaltlicher Sicht genehmigen und ihnen so Rechtswirksamkeit verleihen konnten. Mit SC 38 verdeutlichte schon das II. Vatikanische Konzil das Spannungsfeld, in dem auch Franziskus die Übersetzung liturgischer Texte verortet: Es ist zum einen die substantielle Einheit des römischen Ritus zu wahren und zum anderen sind die berechtigten Verschiedenheiten in Kultur und Sprache sowie das Wohl der Gläubigen im Blick zu behalten.
Die im Nachgang des II. Vatikanischen Konzils auf dieser Grundlage aufbauenden liturgischen Gesetze, Instruktionen und Schreiben zeichnen den schwierigen Prozess zu einer tatsächlichen Umsetzung der konziliaren Vorgaben. Die in SC 36 § 4 klare Zuständigkeit der Bischofskonferenzen wurde bereits durch Paul VI. mit dem Motu proprio Sacram liturgiam (vgl. Paul VI., Moto proprio Sacram Liturgiam v. 25.01.1964: AAS 56 [1964], 139–144, Nr. IX) insofern eingeschränkt, als dass die Billigung und Bestätigung im Sinne einer recognitio für alle Übersetzungen liturgischer Texte in die Muttersprachen nun beim Apostolischen Stuhl lag. Die in französischer Sprache – schon das ein deutliches Zeichen zur Stärkung der muttersprachlichen Texte – verfasste Übersetzungsinstruktion Comme le prévoit (vgl. Instruction sur la traduction des textes liturgiques pour la célébration avec la peuple v. 25.01.1969: Notitiae 5 [1969], 3–12) stellte heraus, dass die Übersetzung liturgischer Texte nicht wortwörtlich aus der Originalsprache erfolgen dürfe, sondern darauf bedacht sein müsse, „einem bestimmten Volke in dessen eigenem Sprachgebrauch (langage) das treu zu vermitteln, was die Kirche durch den Originaltext einem anderen Volke und in einer anderen Sprache (langue) vermitteln wollte“ (Nr. 6; Anm.: Übersetzung von Tobias Weyler, Wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft der Universität Würzburg, dem dafür herzlich gedankt sei). Diesem Übersetzungsprinzip, das verschiedene landessprachliche Übersetzungsprojekte der 1970er und 1980er Jahre bestimmte, stellte die Instruktion Liturgiam authenticam im Jahr 2001 (= LA; vgl. Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Instructio de usu linguarum popularium in libris liturgiae romanae edendis Liturgiam authenticam v. 28.03.2001: AAS 93 [2001], 685–726; dt.: VApSt Nr. 154, Bonn 2001) den Vorrang der lateinischen Ursprungssprache gegenüber. Nach LA 20 hatten die Übersetzungen nun „ganz vollständig und ganz genau […], das heißt ohne Auslassungen und Zusätze, was den Inhalt betrifft, und ohne Paraphrasen oder Erklärungen“ zu erfolgen. Dabei ist besonders die getreue, fideliter, und genaue Übertragung des Originaltextes in die jeweilige Landessprache zu beachten. Damit war aber dennoch keine rein wortwörtliche Übersetzung gemeint, denn auch LA 44 nahm die Notwendigkeit der Verständlichkeit des Textes für die Adressat*innen in den Blick.
Mit der Promulgation des CIC/1983 wurde eine Regelung zur Kompetenzverteilung bezüglich der Übersetzung liturgischer Texte in die einleitenden Normen zum Buch IV “De Ecclesiae munere sanctificandi“ aufgenommen. Die Grundstruktur ist auch in der Gesetzesänderung von Papst Franziskus beibehalten worden, demnach c. 838 § 1 CIC – gleichlautend wie bisher – zunächst die entsprechend zuständigen Autoritäten einführt, deren Kompetenzbereiche in den folgenden Paragraphen jeweils ausformuliert werden (§ 2 Zuständigkeit des Apostolischen Stuhls; § 3 Zuständigkeit der Bischofskonferenzen; § 4 Zuständigkeit der Diözesanbischöfe). Mit c. 838 § 3 CIC a.F. wurde SC 36 § 4 nur teilweise aufgegriffen, insofern den Bischofskonferenzen die Kompetenz zur Besorgung der Übersetzungen und zu deren Veröffentlichung gegeben worden war. Zugleich war auch die Anpassung liturgischer Texte im Sinne von SC 39 umfasst. Es bedurfte dazu aber nach c. 838 § 2 CIC a.F. der sogenannten recognitio durch den Apostolischen Stuhl, speziell nach Pastor bonus (dt. Übersetzung) Art. 64 § 3 durch die Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung, bei dem auch die Herausgabe lag (vgl. hierzu auch LA 71 und 79). Ursprünglich war mit der recognitio bewusst ein Begriff gewählt worden, der sich auf eine Rechtmäßigkeits- und Unbedenklichkeitsüberprüfung der Übersetzung bezieht, der aber für die überprüfende, höhere Autorität einen geringeren Ermessensspielraum mit sich bringt als eine Approbation. Dennoch ist hier eine detaillierte Überprüfung eingeschlossen, die auch eine inhaltliche Durchsicht sowie die Anordnung entsprechender Änderungen vor Veröffentlichung ermöglicht (vgl. PCI, Nota explicativa v. 28.04.2006: Com 38 [2006], 16). Damit war der zuständigen Kongregation auch eine eigene Gestaltungsmöglichkeit bezüglich der jeweiligen landessprachlichen Übersetzung gegeben. Die daraus resultierende Kompetenz der Gottesdienstkongregation zur inhaltlichen Überprüfung und Änderung der vorgelegten Übersetzungen wurde mit LA 104 noch dadurch erweitert, dass hier dem Heiligen Stuhl mit Blick auf das Wohl der Gläubigen das Recht gegeben wurde, eigene Übersetzungen zu erstellen und zu approbieren.
Der c. 838 § 2 CIC n.F. spricht nun den Bischofskonferenzen ein eigenes Approbationsrecht für die Anpassungen liturgischer Texte zu. Eine substantielle Änderung liegt darin, dass nicht mehr von versiones, den Übersetzungen der liturgischen Bücher, die Rede ist, sondern nur noch die aptationes, die Anpassungen im Sinne von SC 39 und 40 gemeint sind. Nur diese Anpassungen und nicht mehr die ganze, von einer Bischofskonferenz approbierte Übersetzung liturgischer Bücher bedarf nun der recognitio seitens des Apostolischen Stuhls.
In c. 838 § 3 CIC n.F. wurde bezüglich der versiones der Begriff recognitio nun durch confirmatio ersetzt und somit SC 34 § 3 aufgegriffen. Die confirmatio meint ursprünglich ein Bekräftigen bzw. Bestärken eines Handelns und ist im rechtlichen Sinn als Bestätigung eines vorausgegangenen Rechtsakts oder einer Handlung zu verstehen. In diesem Fall geht es um die Bestätigung der von den Bischofskonferenzen durch Dekret zugelassenen Übersetzungen. Das schon in SC 34 § 4 akzentuierte Approbationsrecht der Bischofskonferenzen wurde nun explizit in den Normtext aufgenommen. Aufgabe der Bischofskonferenzen wird es demnach zukünftig sein, Übersetzungen vorzubereiten, sie zu approbieren, die Übersetzungen der liturgischen Texte dem Apostolischen Stuhl zuzuleiten und nach erfolgter confirmatio die liturgischen Bücher für ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich herauszugeben. In seinem Leseschlüssel zum Motu proprio Magnum principium erklärt Arthur Roche, der Sekretär der Gottesdienstkongregation (vgl. Artur Roche, Das Motu Proprio „Magnum Principium“. Ein Leseschlüssel) den Begriff der confirmatio näher und erläutert, dass hiermit kein „weiterer Eingriff in den Übersetzungsvorgang mittels alternativer Übersetzungen [gemeint ist, sondern ein] autoritativer Akt, mit dem das zuständige Dikasterium die Approbation der Bischöfe ratifiziert. Voraussetzung ist selbstverständlich ein positives Urteil über die Treue und Übereinstimmung der Texte mit dem Original, auf dem die Einheit des Ritus gründet. Besonderes Augenmerk gilt dabei den wichtigsten Texten, wie etwa den sakramentalen Formeln, den eucharistischen Hochgebeten, den Weihegebeten oder dem Ordo Missae, etc.“ Dass dieser Begriffswechsel auch inhaltlicher Natur ist, bekräftigt auch Papst Franziskus selbst in seinem offenen Brief an Kardinal Sarah vom 15. Oktober 2017: So ist nicht mehr die Überprüfung der wortgetreuen Übersetzung Aufgabe der Gottesdienstkongregation, sondern vielmehr soll bei Bedenken seitens der Kongregation das Gespräch mit der entsprechenden Bischofskonferenz gesucht werden. Neben der im Sinne des II. Vatikanischen Konzils erneuerten Zuständigkeitsbereiche, heben der Papst und der Sekretär der Gottesdienstkongregation ebenso die Bedeutung der Einfügung des Adverbs fideliter hervor. Durch die Vorgabe der getreuen Übersetzung wird ein zentrales Anliegen von Liturgiam authenticam in den Gesetzestext aufgenommen, die zugleich die Frage nach der inhaltlichen Füllung dieses Begriffs hervorruft. Franziskus stellt die Treue der Übersetzung in ein größeres Spannungsfeld. Im Motu proprio selbst betont er die Treue gegenüber dem lateinischen Originaltext, gerade auch bezüglich bestimmter Begriffe (vgl. zu diesem Anliegen auch LA 30f.), die in Zusammenhang mit der Unversehrtheit des katholischen Glaubens zu betrachten seien. Zugleich hebt er aber hervor, dass ebenso die Eigenart der jeweiligen Sprache bei den Übersetzungen zu wahren ist. Dies konkretisiert er nochmals in seinem Brief an Kardinal Sarah: Es gehe um die Treue gegenüber dem lateinischen Text, aber darüber hinaus ebenso um die Treue zur jeweiligen Zielsprache und schließlich sei auch die Verständlichkeit des Textes auf Seiten der Adressat*innen getreu im Blick zu behalten. Eine getreue Übersetzung hat demnach das ganze Geschehen und die Beteiligten der Kommunikation zu bedenken und ihre Anliegen in den Übersetzungsvorgang mit hinein zu nehmen. Die Verantwortung für eine getreue Übersetzung liegt nun zentral bei den Bischofskonferenzen. Eine solche Übersetzung hat der Apostolische Stuhl grundsätzlich vorauszusetzen und nur bei gravierenden Abweichungen einzuschreiten. Hierin ist ein neuer Ansatz in der Zusammenarbeit zwischen den Bischofskonferenzen und dem Apostolischen Stuhl zu sehen, die nach Wunsch des Papstes in Zukunft leichter, dialogischer und fruchtbarer zu erfolgen habe.
Zum Abschluss des Motu proprio betont Franziskus, dass sowohl Pastor bonus Art. 64 § 3 als auch die anderen gesetzlichen Regelungen bezüglich der Übersetzung liturgischer Texte in Geltung blieben, diese aber zukünftig im Sinne des Motu proprio zu lesen und auszulegen seien. Sicher wäre es wünschenswerter gewesen, hier ebenfalls die entsprechenden rechtlichen Veränderungen vorzunehmen.
Zwei klare Akzentsetzungen werden aus der bisher letzten Änderung des CIC/1983, so klein sie auf den ersten Blick auch scheinen mag, deutlich: Zum einen haben die Bischofskonferenzen hier eine klare und auch inhaltlich bedeutsame Kompetenz erhalten, wie sie bereits das II. Vatikanische Konzil gefordert hatte. Hier verbindet sich eine Wiederbesinnung auf das Konzil mit dem besonderen Anliegen Franziskus‘, eine stärkere Dezentralisierung der kirchlichen Strukturen zu verwirklichen. Dies bedeutet aber zugleich, dass nun die Bischofskonferenzen angesprochen und herausgefordert sind, ihre Zuständigkeit eigenverantwortlich wahrzunehmen. Von Seiten der Deutschen Bischofskonferenz scheint hier aber bisher von der Gesetzänderung keine neue Aufbruchsstimmung ausgegangen zu sein. Dies mag auch am zweiten wichtigen Akzent liegen, denn zum anderen rückt Franziskus in den Vordergrund, was als vom II. Vatikanischen Konzil ausgehendes magnum principium zu betonen ist. Es geht um die Anpassung an das und das verständlich Machen des liturgischen Betens für das Auffassungsvermögen des Volkes. Hier greift Franziskus SC 34 auf, wo über die Riten im Ganzen gesagt wird, dass sie „dem Fassungsvermögen der Gläubigen angepasst sein und im Allgemeinen nicht vieler Erklärungen bedürfen“ sollen. Darin äußert sich zutiefst das Prinzip der participatio actuosa, das Franziskus mit neuer Aktualität hervorhebt und dabei zugleich verdeutlicht, dass dies in einem Spannungsfeld zu bedenken sei: Es geht um das Wohl der einzelnen Gläubigen sowie das konkrete Volk in seiner Sprache und Kultur, aber ebenso um das ganze Volk Gottes, dessen gemeinsames Beten und Feiern auch durch die Einheit im gemeinsamen Ritus gesichert werden soll. Daher muss diese substantielle Einheit des römischen Ritus ebenso Maßstab für die Übersetzungsarbeit sein wie das Auffassungsvermögen der und die Verständlichkeit für die Gläubigen. Im Blick der Gesetzesänderung steht letztlich die gelingende Kommunikation zwischen Gott und dem Volk Gottes, die zentral mit der Sprache der liturgischen und auch der biblischen Texte verbunden ist. Es geht um Glaubenskommunikation, die jeweils ein eigenes Volk in seiner je eigenen Sprache betrifft. Die Herausforderung ist demnach groß und es wird zweifelsohne spannend sein, die künftige Wirkungsgeschichte dieser Gesetzesänderung zu beobachten.
c. 207 § 1 CIC
„Ex divina institutione, inter christifideles sunt in Ecclesia ministri sacri, qui in iure et clerici vocantur; ceteri autem et laici nuncupantur.“
„Kraft göttlicher Weisung gibt es in der Kirche unter den Gläubigen geistliche Amtsträger, die im Recht auch Kleriker genannt werden; die übrigen dagegen heißen auch Laien.“
von Martin Rehak
Es braust ein Ruf wie Donnerhall: „Duo sunt genera christianorum (dt.: Es gibt zwei Arten von Christen)“ (C. 12 q. 1 c. 7). Einerseits die Kleriker, nach dem griechischen Wort „κλῆρος“, das „Los“, lateinisch „sors“, bedeutet; sie sind dadurch gekennzeichnet, dass sie von Gott gleichsam aus-sor-tiert, auserwählt sind (vgl. dazu auch Jos 13,14.33; 21,1–41; Apg 1,15–26) und ihr Leben vollständig dem Gottesdienst, der geistlichen Betrachtung und dem Gebet widmen. Das macht sie zu Königen des Himmelreiches, weil sie sich und andere aufgrund ihrer Tugenden regieren („Hi namque sunt reges, id est se et alios regentes in virtutibus, et ita in Deo regnum habent“ [ebd.]). Andererseits die Laien, nach dem griechischen Wort „λαὸς“, das „Volk“, lateinisch „populus“, bedeutet; für sie ist charakteristisch, dass sie sich um weltliche Angelegenheiten – etwa Landwirtschaft und Handel – kümmern und heiraten dürfen. So jedenfalls Magister Gratian (um 1140) mit einem wohl fälschlich dem Kirchenvater Hieronymus zugeschriebenen Kapitel seiner Concordia discordantium canonum.
Dagegen hat das Zweite Vatikanische Konzil zur Beschreibung des Subjekts der Kirche den traditionsreichen Sachbegriff „Volk Gottes“ in das Zentrum seiner Ekklesiologie gerückt und damit gegenüber dem eingangs referierten mittelalterlichen Kirchenverständnis eine grundlegende Verschiebung vorgenommen: Das Volk Gottes sind – gemäß der Lehre vom gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen (vgl. dazu 1 Petr 2,5.9.10) – alle Getauften, also nicht nur die Laien (vgl. dazu c. 204 § 1 CIC). In der Taufe wird sakramental eine fundamentale Gleichheit aller Gläubigen vermittelt, die die Kirche primär als eine societas aequalis, eine Gemeinschaft von Gleichberechtigten, konstituiert. Niemand wird hingegen als Kleriker geboren bzw. bereits als Kleriker zur Person in der Kirche (vgl. dazu c. 96 CIC).
Das geltende kanonische Recht greift die konziliare Ekklesiologie vor allem in der Weise auf, dass mit dem Begriff des christifidelis (dt.: Gläubiger [m/w/_/d]) in c. 204 § 1 CIC ein einheitlicher Oberbegriff gefunden wird, der erst gemäß c. 207 § 1 CIC in einem zweiten Schritt in christifidelis clerici (dt.: Kleriker) und christifidelis laici (dt.: Laien [m/w/_/d]) ausdifferenziert wird.
Dabei bilden die Kleriker gleichsam einen eigenen Stand in der Kirche, mit dem sich der Kodex des kanonischen Rechts in cc. 232–293 CIC (Buch II, Teil I, Titel III) näher befasst. In vier Kapiteln wird dort die Ausbildung der Kleriker, das Konzept der Inkardination, die Standesrechte und -pflichten der Kleriker, sowie der Verlust des klerikalen Standes näher behandelt.
Was das Verhältnis zwischen Klerikern und Laien anbelangt, so wird die christliche Theologie – eingedenk der Jesusworte zum Rangstreit seiner Jünger (vgl. Mk 9,33–37) – zwar nicht müde, den Dienstcharakter der kirchlichen Ämter zum Wohle des ganzen Volkes Gottes zu betonen. Aber ist dies im Realitätscheck zu verifizieren? Konstatiert doch schon Mephisto: „Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, Und grün des Lebens goldner Baum“ (Goethe, Faust I, 2038 f.), womit das schalkhafte Teufelchen übrigens versucht, für die unmittelbar zuvor geschilderten, eindeutig sexuell konnotierten Übergriffigkeiten (vgl. ebd., 2031–2036) eine positive Gesamtbewertung zu etablieren.
Unter dem Eindruck eines nach 2010 weiteren Horrorjahres für die katholische Kirche in Sachen sexueller Missbrauch durch Kleriker – zu dessen Tiefpunkten vor allem die Tragödie der chilenischen Kirche infolge des Karadima/Barros-Skandals sowie die zu Recht vom Apostolischen Stuhl forcierte Resignation des Altbischofs von Washington D.C., Theodor E. McCarrick, vom Kardinalat zählen – hat der Heilige Vater sich mit einem Schreiben vom 20.08.2018 an das ganze Volk Gottes gewandt (vgl. AAS 110 [2018] 1284–1288).
Der Papst spricht darin vom Schmerz der Opfer; aber auch von Scham und Reue, die er stellvertretend für die Gemeinschaft der Kirche verbalisiert, die es in der Vergangenheit an der gebotenen Solidarität mit den Schwachen und Kleinen habe fehlen lassen. Daher fordert der Papst alle Gläubigen dazu auf, durch persönliche und gemeinschaftliche Umkehr (vgl. Mk 1,15) eine kirchliche und soziale Umgestaltung herbeizuführen. Das ganze heilige gläubige Volk Gottes wird zu einer Bußübung des Gebets und des Fastens eingeladen, was eigentümlicher Weise mit Mt 17,21 begründet wird.
Die Notwendigkeit einer Einbeziehung aller Gläubigen in den Reinigungsprozess der Kirche wird durch die Überlegung begründet, dass ein sogenannter Klerikalismus als struktureller Wurzelgrund sexuellen Missbrauchs durch Kleriker anzusehen sei. (Ohne sich damit die Positionen des Ex-Nuntius in den Vereinigten Staaten von Amerika, Carlo M. Viganò, in seinem aufsehenerregenden Memorandum vom 22.08.2018 insgesamt zu eigen machen zu müssen, wird man die dort nachdrücklich formulierte Skepsis gegenüber einem derartigen monokausalen Erklärungsversuch wohl teilen können.)
Klerikalismus wird dabei in etwa als jene Haltung definiert, die die Persönlichkeit des Christen zunichte macht und dazu neigt, die Taufgnade zu mindern und unterzubewerten, die der Heilige Geist in das Herz jedes einzelnen Gliedes des Volkes Gottes eingegossen hat. Ein solcher Klerikalismus erzeuge eine Spaltung im Leib der Kirche. Der Papst, der noch im Vorkonklave vor einer Selbstreferentialität der Kirche gewarnt hatte, zitiert dabei sich selbst aus seinem Schreiben an Kardinal Marc Ouellet (in dessen Eigenschaft als Präsident der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika) vom 19.03.2016, wo Franziskus ebenfalls hart mit dem Phänomen des Klerikalismus ins Gericht gegangen war:
„Esta actitud no sólo anula la personalidad de los cristianos, sino que tiene una tendencia a disminuir y desvalorizar la gracia bautismal que el Espíritu Santo puso en el corazón de nuestra gente. El clericalismo lleva a la funcionalización del laicado; tratándolo como “mandaderos”, coarta las distintas iniciativas, esfuerzos y hasta me animo a decir, osadías necesarias para poder llevar la Buena Nueva del Evangelio a todos los ámbitos del quehacer social y especialmente político. El clericalismo lejos de impulsar los distintos aportes, propuestas, poco a poco va apagando el fuego profético que la Iglesia toda está llamada a testimoniar en el corazón de sus pueblos. El clericalismo se olvida de que la visibilidad y la sacramentalidad de la Iglesia pertenece a todo el Pueblo de Dios (cfr LG 9-14). Y no solo a unos pocos elegidos e iluminados.
(dt.: Diese Haltung macht nicht nur die Persönlichkeit der Christen zunichte, sondern sie neigt dazu, die Taufgnade zu mindern und abzuwerten, die der Heilige Geist in das Herz unseres Volkes eingegossen hat. Der Klerikalismus führt dazu, die Laien homogen zu machen; indem er sie als »Bittsteller« behandelt, beschneidet er die verschiedenen Initiativen, Bemühungen, ja ich wage sogar zu sagen die kühnen Taten, die notwendig sind, um die Frohbotschaft des Evangeliums in alle Bereiche des gesellschaftlichen und besonders des politischen Lebens zu tragen. Weit davon entfernt, den verschiedenen Beiträgen und Vorschlägen Impulse zu verleihen, löscht der Klerikalismus allmählich das prophetische Feuer aus, von dem die ganze Kirche in den Herzen ihrer Völker Zeugnis ablegen soll. Der Klerikalismus vergisst, dass die Sichtbarkeit und die Sakramentalität der Kirche zum ganzen Gottesvolk gehören (vgl. LG 9-14) und nicht zu einigen wenigen Auserwählten und Erleuchteten.)“ (AAS 108 [2016] 525–530, 526)
Das Schreiben des Heiligen Vaters vom 20.08.2018 hinterlässt damit zumindest beim ersten Lesen einen durchaus zwiespältigen Eindruck. Positiv ist zu bewerten, dass der Papst nachdrücklich die konziliare Ekklesiologie stark macht, die die Kirche vom Volk Gottes her denkt. Interessant ist die vorgelegte Umschreibung des Phänomens des Klerikalismus als einer Haltung, die die Taufgnade der Laien abwertet; sei es durch Kleriker, sei es durch die Laien selbst. Nicht ohne weiteres einsichtig ist hingegen, warum die an den Sünden und Straftaten einzelner Kleriker völlig unbeteiligten Glieder des Volkes Gottes sich jetzt in Fasten und Gebet üben sollen, um gerade dadurch die Kirche insgesamt zu erneuern. (Nach einem ebenfalls im Osservatore Romano veröffentlichten Kommentar von Lucetta Scaraffia sollen die primären Adressaten dieses Appells jene Opfer sein, die durch ihr Schweigen zu Komplizen werden, vgl. OssRomDt, Nr. 34 vom 24.08.2018, S. 4.)
Dies gilt umso mehr, als in diesem Schreiben die spezifische Dimension, die den Missbrauchsskandal in der Neuauflage des Jahres 2018 kennzeichnet, mit Stillschweigen übergangen wird: Es sind nicht mehr, wie bisher, nur Ordensleute und (einfache) Priester, die sich verfehlt haben; sondern die Täter (bzw. jene, die die Täter – mutmaßlicher Weise – gedeckt haben) sind nunmehr Bischöfe und Kardinäle. Dies wirft weitreichende Fragen auf: Wie objektiv und wie effektiv sind die Auswahlverfahren im Vorfeld von Bischofsernennungen, die doch die persönliche Qualität der Bischofselekten sichern sollen? Ist der Episkopat – bzw. der Apostolische Stuhl gemäß dem Motu Proprio Come una madre amorevole vom 04.06.2016 (AAS 108 [2016] 715–717) – überhaupt dazu in der Lage, sich von Straftätern bzw. objektiv untragbar gewordenen Amtskollegen abzuwenden und energisch gegen sie vorzugehen? Jedenfalls ist es unter dem eben genannten Gesichtspunkt nicht hilfreich, wenn die offiziöse deutsche Übersetzung des Papstbriefes vom 20.08.2018 im fünftletzten Absatz die „clérigos“ der spanischen Originalfassung mit „Priester“ wiedergibt; auch wenn es sich hierbei um eine absichtslose Flüchtigkeit des Übersetzers handeln dürfte.
Aber vielleicht ist es gerade diese Kompromittierung einiger durch die sakramentale Weihe zum Aufseherdienst bestellter Amtsträger, die den Appell des Heiligen Vaters an das ganze Volk Gottes erforderlich macht. Versuchen wir also, unseren Mut zu sammeln; uns zum geistlichen Kampf zu rüsten; und uns jenen Appell zu eigen zu machen, wie er – auch ohne die Gnade der Weihe allein kraft der Gnade der Taufe – einem mündigen Christen in Solidarität mit den Armen entspricht: „Wir Alle wollen Hüter sein!“
c. 283 § 2 CIC
„Ipsis [sc.: clericis] autem competit ut debito et sufficienti quotannis gaudeant feriarum tempore, iure universali vel particulari determinato.“
„Es steht ihnen [sc.: den Klerikern] aber eine gebührende und ausreichende jährliche Urlaubszeit zu, die nach allgemeinem oder partikularem Recht bestimmt ist.“
von Martin Rehak
Sommerzeit – Urlaubszeit. War die Sommerfrische im 19. Jh. und anfangs des 20. Jh. noch der Aristokratie und dem gehobenen Bürgertum vorbehalten, entwickelte sich zwischen den Weltkriegen und in der Ära des Wirtschaftswunders das Phänomen des Urlaubmachens, wie wir es heute kennen. Auch die Kirche ging hier mit der Zeit. Während dem CIC/1917 das Konzept eines Urlaubs der Geistlichen noch völlig fremd war, statuiert c. 283 § 2 CIC das Recht des Klerus auf einen angemessenen Urlaub. Motor der Modernisierung war auch hier das Zweite Vatikanische Konzil, das sich im Dekret Presbyterorum ordinis über Dienst und Leben der Priester, hier Nr. 20 (vgl. AAS 58 [1966] 991–1024, hier 1021) für eine gerechte Entlohnung der Priester ausspricht, die so zu bemessen ist, dass sie „Presbyteris permittat quotannis debitum et sufficiens habere feriarum tempus (dt.: den Priestern gestattet, jährlich den verdienten und notwendigen Urlaub zu nehmen)“. Das kodikarische Recht greift diesen konziliaren Programmsatz bis in den Wortlaut hinein auf, verweist für nähere Einzelheiten jedoch auf das allgemeine oder partikulare Recht. Wie ist nun dort der Urlaub, insbesondere dessen maximale Dauer, geregelt?
Ausdrückliche Festlegungen bietet der Kodex lediglich für die Pfarrer und Pfarrvikare, wobei dies kontextuell durch die Residenzpflicht beider Personengruppen in ihrer jeweiligen Pfarrei veranlasst ist. Gemäß c. 533 § 2 CIC wird einem Pfarrer die Abwesenheit von der Pfarrei zu Urlaubszwecken für bis zu einem Monat jährlich gestattet. Gemäß c. 550 § 3 CIC ist ein Pfarrvikar in Sachen Urlaubsanspruch einem Pfarrer gleichgestellt. Ein solcher Urlaub kann ohne Unterbrechung oder in mehreren Stücken genommen werden. Die Teilnahme an Einkehrtagen (Exerzitien) wird nicht auf diese einmonatige Urlaubszeit angerechnet. Die Frage, was die Zeitangabe „ein Monat“ umgerechnet in Tage bedeutet, lässt sich mithilfe des c. 202 § 1 CIC eindeutig beantworten: Sofern – wie hier – im Recht nichts anderes bestimmt wird, versteht man unter einem Monat einen Zeitraum von 30 Tagen. Das kodikarische Recht differenziert dabei nicht weiter nach Arbeits-, Werk-, Sonn- oder Feiertagen.
Für sonstige Priester enthält das allgemeine Recht des Kodex keine Urlaubsregelung. Eine partikularrechtliche Regelung bietet aber beispielsweise Art. 28 der Priesterbesoldungsordnung des Bistums Würzburg vom 01.07.2014 (vgl. Abl Würzburg 160 [2014] 263–280, hier 277). Dort wird ohne weitere Festlegungen die kodikarische Regelung des c. 533 § 2 CIC auf alle Priester ausgeweitet (ein Monat = 30 Tage Urlaub pro Jahr). In der Vorgängernorm (Art. 17 der Priesterbesoldungsordnung 1998, in: Abl Würzburg 144 [1998] 286–293, hier 292) war dazu noch erläutert worden, dass mindestens zwei Wochen des Gesamturlaubs zusammenhängend genommen werden sollen; dass Jugendkurse, -freizeiten und Exerzitien keinen Urlaub darstellen; dass hingegen etwaige Erholungstage, die sich ein Priester nach den Hochfesten gönnt, sehr wohl auf die besagten 30 Urlaubstage anzurechnen sind; und dass im Falle von Schulverpflichtungen der Urlaub während der Schulferien zu nehmen ist.
Für ständige Diakone differenziert § 17 der Rahmenordnung für Ständige Diakone in den Bistümern der Bundesrepublik Deutschland vom 19.05.2015 (vgl. Abdruck in: Die Deutschen Bischöfe 101) danach, ob der Diakon hauptberuflich oder nebenberuflich für die Kirche tätig ist. Ist ersteres der Fall, so verweist § 17 Abs. 1 Rahmenordnung auf das diözesane Recht. Für einen Diakon mit Zivilberuf ist hingegen der „kirchliche Urlaub“ mit dem Urlaub abgegolten, der ihm aufgrund seines jeweiligen Zivilberufs zusteht (vgl. ebd., § 17 Abs. 2). Selbiges dürfte defacto für „Priester mit Zivilberuf“ (Heribert Schmitz), nämlich mit dem Zivilberuf des Hochschullehrers, gelten. Die Dienst- und Vergütungsordnung für Ständige Diakone in den bayerischen Diözesen (vgl. Abdruck in: Abl Würzburg 162 [2016] 483–532) regelt das Thema Urlaub in § 15 Abs. 1 i.V.m. Anlage 2 Abs. 1: Hauptberufliche Diakone müssen demnach ihren Urlaub – in Absprache mit dem unmittelbaren Dienstvorgesetzten – im Ordinariat beantragen. In besagter Anlage 2 Abs. 1 Ziff. 1 heißt es dann: „Der hauptberufliche Diakon erhält in Anlehnung an can. 533 § 2 CIC in jedem Kalenderjahr 31 Kalendertage Erholungsurlaub.“ Dazu sei angemerkt, dass der hauptberufliche Diakon zwar keine festen Arbeitszeiten kennt, gleichwohl jedoch bei Tätigkeit in Vollzeit in etwa von sechs Arbeitstagen pro Woche auszugehen ist (vgl. dazu § 13 der Dienst- und Vergütungsordnung: „ein voller dienstfreier Tag in der Woche“).
Für nichtständige Diakone hingegen fehlt – jedenfalls, soweit ersichtlich, im Würzburger Partikularrecht – eine ausdrückliche Regelung. Sofern in den wenigen Monaten zwischen Diakonen- und Priesterweihe das Bedürfnis nach Erholungsurlaub zu befriedigen ist, wäre dieser wohl gemäß der zur Durchführung des Pastoralkurses etablierten Rechtspraxis zu gewähren (oder zu verweigern).
Obschon sie aus kirchenrechtlicher und weihetheologischer Sicht keine Kleriker sind, sei an dieser Stelle ein Seitenblick auf die Zunft der Pastoralreferent(inn)en geworfen. Soweit ersichtlich, ist hier zunächst § 26 des Allgemeinen Teils des Arbeitsvertragsrechts der Bayerischen (Erz-)Diözesen [ABD] maßgeblich, wonach den Dienstnehmern im kirchlichen Dienst ein Jahresurlaub von 30 Arbeitstagen, bezogen auf eine fünftägige Arbeitswoche, zusteht. Im Falle einer sechstägigen Arbeitswoche (und Tätigkeit in Vollzeit) mithin also ein Jahresurlaub von 36 Arbeitstagen. Dazu ergibt sich aus § 7 Abs. 1 der Dienstordnung für Pastoralreferenten/Pastoralreferentinnen in den Bayerischen (Erz-)Diözesen (publiziert in: ABD, Teil C,1), dass sich die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit – in Anlehnung an die Bestimmungen des TVöD in einem Umfang von 39 Stunden/Woche – in der Regel auf sechs Tage pro Woche verteilt, während gemäß § 9 der Dienstordnung jene Pastoralreferent(inn)en, die Religionsunterricht erteilen, dazu verpflichtet werden, ihren Urlaub in der unterrichtsfreien Zeit zu nehmen.
Wie ist es nach alledem um den Urlaub der Bischöfe bestellt? Hier fehlen ausdrückliche rechtliche Normierungen. Zwar behandelt c. 395 CIC ausführlich die Residenzpflicht der Diözesanbischöfe und die rechtmäßigen Gründe für Absenzen. Sofern die Absenzen nicht durch die pflichtgemäße Wahrnehmung bischöflicher Aufgaben auf überdiözesaner Ebene (Teilnahme an Konzilien, Bischofssynoden, Bischofskonferenzen) veranlasst sind (die hierfür aufgewandte Zeit gilt nicht als Absenz), kann sich ein Bischof – ähnlich wie ein Pfarrer oder Pfarrvikar – gemäß c. 395 § 2 CIC längstens einen Monat entfernen, sei es an einem Stück oder in mehreren Stücken. Dass diese Abwesenheit für Urlaub genutzt werden kann, ist nicht ausdrücklich gesagt. Müssen also Diözesanbischöfe immer arbeiten und haben nie Urlaub? Das wäre ein Fehlschluss, der an der Lebenswirklichkeit wie auch an der Rechtslage vorbeiginge. Denn es genügt für die maximal einmonatige bzw. 30-tägige Abwesenheit ein „angemessener Grund (aequa causa)“. Das Bedürfnis nach Urlaub ist hier ohne weiteres zu subsumieren. Dass c. 395 § 2 CIC hier allgemeiner formuliert ist, hängt vermutlich damit zusammen, dass zum einen die außerdiözesanen Aktivitäten des Diözesanbischofs nicht über Gebühr reglementiert werden sollen; und zum anderen das kodikarische Leitbild in Sachen Urlaubsrecht nun einmal – wie eingangs erwähnt – Vat. II, PO 20, und somit der Urlaub des einfachen Priesters ist.
-
KdM_4__283_2__Urlaub.pdf 152 KB
Treffen sich ein anglikanischer und ein orthodoxer Geistlicher. Sagt der Anglikaner: „Weißt Du schon das Neueste? Wir weihen jetzt auch Frauen zu Priestern!“ – Darauf der Orthodoxe, völlig fassungslos: „Ach, und wie macht ihr das???“ – „Ganz einfach, wir legen ihnen die Hände auf und sprechen das Weihegebet…“ – Darauf der Orthodoxe: „Jaja, das ist mir schon klar. Ich meine: Wie macht ihr das mit dem Bart?!?“
(nach einer wahren Begebenheit)
c. 1024 CIC
„Sacram ordinationem valide recipit solus vir baptizatus.“
„Die heilige Weihe empfängt gültig nur ein getaufter Mann.“
von Martin Rehak
Mit einem kürzlichen Beitrag „Il carattere definitivo della dottrina di Ordinatio sacerdotalis. A proposito di alcuni dubbi“ im L’Osservatore Romano hat der Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre, Kurienerzbischof P. Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ, die Lehre des ordentlichen Lehramts der Kirche in der Frage der Frauenordination in Erinnerung gerufen (vgl. OssRom, Nr. 121 vom 30.05.2018, S. 6; OssRomDt, Nr. 23/24 vom 08.06.2018, S. 7). Der Beitrag ist gerahmt von Ermahnungen zur Wahrung der innerkirchlichen Einheit (vgl. Joh 15,4; 15,10).
Der Präfekt erinnert daran – in Wiederholung des bereits in der Erklärung Inter insigniores, dort Nr. 4, Gesagten (vgl. AAS 69 [1977] 98–116, 107 f.) –, dass die Kirche gemäß der Lehre des Konzils von Trient die Substanz der Sakramente nicht ändern könne (vgl. DH 1728). Bei dieser Feststellung handelt es sich allerdings um einen im Kontext der Eucharistielehre formulierten Grundsatz der Allgemeinen Sakramentenlehre, der für sich allein noch nicht die Frage klärt, ob das männliche Geschlecht des Weihekandidaten zur Substanz des Sakraments zählt. Dabei ist auch zu sehen, dass die traditionelle Sakramentenlehre den Substanzbegriff allein auf Materie und Form der Sakramente bezog und nicht auch auf die Person des Empfängers, wobei in dogmengeschichtlicher Perspektive vor allem streitig war, ob Handauflegung oder Übergabe von Kelch und Patene die Materie des Weihesakraments darstellen (vgl. dazu DH 1326 mit DH 3857–3861).
Wenn nach alledem der Präfekt bemerkt, dass es hier „nicht nur um eine Frage der Disziplin, sondern der Lehre“ gehe, so mag dies Anlass zu folgenden Beobachtungen geben:
Sedes materiae im kanonischen Recht ist c. 1024 CIC. Eine strikt formallogische Analyse dieser Norm wird ergeben, dass hier die Rechtsfolge der Gültigkeit des Sakramenteempfangs („valide recipit“) denkbarer Weise entweder an die Taufe des Empfängers oder an seine Zugehörigkeit zum männlichen Geschlecht oder an beide Voraussetzungen geknüpft ist.
Betrachtet man die rechtsgeschichtlichen Quellen des c. 1024 CIC, so ist auffällig, dass ein beträchtlicher Teil der zahlenmäßig überschaubaren älteren kanonischen Quellentexte – wie sie etwa anhand des Quellenapparats zu can. 968 § 1 CIC/1917 oder bei Franz Xaver Wernz, Ius Decretalium, Bd. 2/1, Rom 1906, S. 124, leicht zu ermitteln sind – sich tatsächlich auf die Notwendigkeit der vorherigen Taufe des Weihekandidaten bezieht: Concilium Nicaenum, can. 19 = C. 1 q. 1 c. 52 („Rebaptizentur et ordinentur, qui de Paulianistis et Cathafrigis ad ecclesiam redeunt“); C. 1 q. 1 c. 60; X 3.43.1 und X 3.43.3 („Si non baptizatus ordinetur, ordinis characterem non recipit“).
Die Entscheidung des Hl. Offiziums vom 02.03.1842 (vgl. Pietro Gasparri [Hg.], Codicis Iuris Canonici Fontes, Bd. 4, Rom 1926, S. 165 f. [Nr. 887]) regelte die weitere Behandlung des kuriosen Falles, dass ein Kandidat die Weihen zum Subdiakon und zum Diakon zunächst aufgrund einer Mentalreservation ungültig, danach aber mit einwandfreier Intention die Priesterweihe empfangen hatte. Concilium Laodicaenum, can. 11 = D. 32 c. 19 bietet die für unsere weiherechtliche Thematik nur indirekt einschlägige Klarstellung, dass die Bezeichnung „presbytera“ für die Ehefrau eines Priesters nicht impliziert, dass ihr das Weihesakrament erteilt worden wäre. Soweit auf das liturgische Recht verwiesen wird, wie es im Pontificale Romanum, tit. De ordinibus conferendis, niedergelegt war, bietet dieses – soweit ersichtlich – nur den Hinweis, dass sich das Weiheskrutinium auch auf das Geschlecht der Weihekandidaten zu erstrecken hatte („Episcopus autem […] ordinandorum genus, personam, aetatem, institutionem, mores, doctrinam, et fidem diligenter investiget, et examinet.“).
Concilium Carthaginense IV, can. 98–99 = D. 23 c. 29, untersagte es Frauen, in der Versammlung Männer zu unterrichten („Mulieri in conventu viros docere non permittitur“). Concilium Carthaginense V, can. 99–100 = D. 4 c. 20 de cons., wiederholte dieses Verbot und ergänzte, dass es einer Frau ebenso verboten sei, irgendjemanden zu taufen; schon Gratian hat dies mit dem knappen Kommentar quittiert: „Nisi necessitate urgente“ (vgl. dazu auch c. 861 § 2 CIC). Meinungsprägend bis heute war und ist die Dekretale Nova quaedam Papst Innozenz’ III. (X 5.38.10), mit der der Papst die Bischöfe von Palencia und Burgos sowie den Abt von Morimond aufforderte, den Missbrauch abzustellen, dass Äbtissinnen ihre Nonnen segnen, deren Beichte hören und öffentlich predigen. Argumentativ stellte der Papst in diesem Zusammenhang fest, dass die Jungfrau Maria zwar würdiger und herausragender als alle Apostel gewesen sei, der Herr aber die Schlüssel des Himmelreiches nicht jener, sondern diesen anvertraut habe – eine vom exegetischen Standpunkt aus doch ziemlich freie Auslegung von Mt 16,19, wo der Evangelist nur von einer Übergabe an Simon Petrus berichtet.
Weder Gasparri in der fontium annotatione zum CIC/1917 noch Wernz erwähnen Concilium Chalcedonense, can. 15 = C. 27 q. 1 c. 23, wonach einer Diakonisse unter Androhung des Anathems geboten wurde, zölibatär zu leben („Diaconissa, quae post ordinationem nubit, anathema sit“). Selbiges gilt für Concilium Laodicaenum, can. 44, welches Frauen den Ministrantendienst verboten hatte (vgl. Hermann Theodor Bruns [Hg.], Canones apostolorum et conciliorum saeculorum IV., V., VI., VII., Bd. 1, Berlin 1839, 78; eine kompakte Zusammenfassung ähnlicher Kanones aus späterer Zeit bei Eduard Weigl, Messe ohne Messdiener, in: MThZ 1 [1950], Heft 4, 14–22, hier 19 f.).
Den Schwerpunkt des Beitrags von Kurienerzbischof Ladaria bilden im Weiteren lehrrechtliche Ausführungen. In sich widersprüchlich erscheinen dort die Angaben dazu, ob der Ausschluss der Frau vom Weihesakrament eine geoffenbarte Glaubenswahrheit („veritas de fide credenda“, vgl. c. 750 § 1 CIC) darstellt, oder eine kirchliche Lehre, die zur unversehrten Bewahrung und/oder getreuen Auslegung einer hierzu in Bezug stehenden Glaubenswahrheit erforderlich ist („propositio definitive tenenda“, vgl. c. 750 § 2 CIC). Bereits das responsum ad dubium der Glaubenskongregation vom 28.10.1995 hatte sich hierzu in doppeldeutigen Formulierungen geäußert (vgl. AAS 87 [1995] 1114). Für die erste Alternative scheint nunmehr der Präfekt einzutreten, wenn er schreibt, dass das ordentliche und allgemeine Lehramt die fragliche Lehre „in der ganzen Geschichte als zum Glaubensgut gehörend vorgetragen“ habe. Für die zweite Alternative treten beispielsweise ein: Kongregation für die Glaubenslehre, Lehrmäßiger Kommentar zur Schlussformel der Professio fidei, Nr. 11, in: VApSt 144 (1998) 17–25, 23 f.; Winfried Aymans, Veritas de fide tenenda. Kanonistische Erwägungen zu dem Apostolischen Schreiben „Ordination Sacerdotalis“ im Lichte des Motu Proprio „Ad tuendam fidem“, in: AfkKR 167 (1998) 368–388, hier 377–382; Ludger Müller, Christoph Ohly, Katholisches Kirchenrecht, Paderborn 2018, 77. Folgt man der zweiten Auffassung, so kann einem aufmerksamen Beobachter schwerlich entgehen, dass sich – soweit ersichtlich – das kirchliche Lehramt bislang zu der Frage ausschweigt, welches die zur definitiven Lehre in Bezug stehende Glaubenswahrheit wäre, die es – durch die Feststellung, dass die Kirche keine Vollmacht habe, Frauen die Priesterweihe zu spenden – zu bewahren und auszulegen gilt.
Wirklich neu ist wohl der Hinweis des Präfekten, Papst Johannes Paul II. habe sich vor der Abfassung seines Schreibens Ordinatio Sacerdotalis vom 22.05.1994, in: AAS 86 (1994) 545–548, mit den Vorsitzenden jener Bischofskonferenzen beraten, „die mit der Problematik besonders befasst waren“. Wenn der Präfekt festhält, dass „alle ohne Ausnahme […] mit voller Überzeugung [erklärten], dass die Kirche aus Gehorsam gegenüber dem Herrn keine Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu erteilen“, so sei dazu zunächst bemerkt, dass offenbar alle Befragten recht gut ihren Duns Scotus kannten: „Quod non est tenendum tamquam praecise per Ecclesiam determinatum, sed habetur hoc a Christo: non enim Ecclesia praesumpsisset sexum muliebrem privasse sine culpa sua actu qui posset sibi licite competere […]. Quia hoc esse videretur maximae iniustitiae, non solum in toto sexu, sed etiam in paucis personis“ (Johannes Duns Scotus, Quaestiones in librum IV. sententiarum, dist. 25 q. 2 = Ausgabe Lyon 1639, 570). Die besagte Weisung des Herrn entnimmt der schottische Franziskaner dabei 1 Tim 2,11 f.: Der Apostel habe hier ausgesprochen, was der Herr durch schlüssiges Verhalten – nämlich den Ausschluss seiner eigenen Mutter von den kirchlichen Weihen und Ämtern (womit Duns Scotus augenscheinlich Innozenz III. rezipiert) – vorgelebt habe. Nachdem unklar bleibt, welche Vorsitzenden damals im Einzelnen ihre Voten abgegeben haben, werden Kirchen- und Dogmengeschichtler sicher sehnsüchtig der künftigen Öffnung des einschlägigen Archivbestands entgegenfiebern. Ladarias Bemerkung lenkt jedoch bereits heute die Aufmerksamkeit darauf, dass der seinerzeitige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Karl Lehmann, dem man gewiss weder theologische Bildung, noch intellektuelle Brillanz, noch Freimut, noch Weitsicht absprechen kann, sich zeitlebens stets zurückhaltend bis skeptisch zur Frage der Möglichkeit der Frauenordination geäußert und so – beginnend mit seinem Kommentar zum Verständnis der römischen Erklärung über die Zulassung der Frau zum Priesteramt von 1977 (vgl. VApSt 117 [21995], 61–65) – in dieser Frage immer wieder seine Loyalität gegenüber der Kirche und ihrem Lehramt bewiesen hat.
c. 382 CIC
„§ 1. Episcopus promotus in exercitium officii sibi commissi sese ingerere nequit, ante captam dioecesis canonicam possessionem; […].
§ 2. Nisi legitimo detineatur impedimento, promotus ad officium Episcopi dioecesani debet canonicam suae dioecesis possessionem capere, si iam non sit consecratus Episcopus, intra quattuor menses a receptis apostolicis litteris; si iam sit consecratus, intra duos menses ab iisdem receptis.
§ 3. Canonicam dioecesis possessionem capit Episcopus simul ac in ipsa dioecesi, per se vel per procuratorem, apostolicas litteras collegio consultorum ostenderit, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat, […].
§ 4. Valde commendatur ut captio canonicae possessionis cum actu liturgico in ecclesia cathedrali fiat, clero et populo adstantibus.“
„§ 1 Der berufene Bischof darf sich nicht in die Ausübung des ihm übertragenen Amtes einmischen, bevor er nicht in kanonischer Form von der Diözese Besitz ergriffen hat; […].
§ 2 Wenn er nicht rechtmäßig daran gehindert ist, muss der in das Amt des Diözesanbischofs Berufene in kanonischer Form von seiner Diözese Besitz ergreifen, und zwar, wenn er noch nicht zum Bischof geweiht worden ist, innerhalb von vier Monaten nach Empfang des apostolischen Schreibens, wenn er bereits geweiht ist, innerhalb von zwei Monaten nach dessen Empfang.
§ 3 Der Bischof ergreift dadurch in kanonischer Form Besitz von der Diözese, dass er in der Diözese selbst in eigener Person oder durch einen Vertreter dem Konsultorenkollegium das apostolische Schreiben vorzeigt in Gegenwart des Kanzlers der Kurie, der hierüber ein Protokoll anzufertigen hat; […].
§ 4 Es wird sehr empfohlen, dass die kanonische Besitzergreifung mit einem liturgischen Akt in der Kathedralkirche geschieht, bei dem Klerus und Volk anwesend sind.“
von Martin Rehak
Am 16. Februar 2018 war zur Mittagsstunde in Rom, Speyer und Würzburg die Ernennung des Speyerer Diözesanpriesters, Domkapitulars und Generalvikars Dr. Franz Jung zum 89. Bischof von Würzburg bekanntgegeben worden. Diese Berufung in das Amt des Diözesanbischofs macht den Erwählten aber noch nicht zum Bischof von Würzburg. Hierfür ist vielmehr erforderlich, dass er – in einem feierlichen Weihegottesdienst am 10. Juni 2018 – das Sakrament der Bischofsweihe empfängt; und dass er die ihm aufgetragene Aufgabe auch annimmt, indem er in kanonischer Form von seinem Bistum Besitz ergreift.
Der Vorgang der kanonischen Besitzergreifung eines ernannten Bischofs von seinem Bistum ist Thema des c. 382 CIC.
Gemäß § 1 dieses Kanons markiert der Akt der kanonischen Besitzergreifung die zeitliche Grenze zwischen der Sedisvakanz des bischöflichen Stuhls und seiner Neubesetzung. Der Grundsatz der Veränderungssperre während der Sedisvakanz (vgl. c. 428 § 1 CIC: Sede vacante nihil innovetur – Während einer Sedisvakanz darf nichts verändert werden) gilt bis dahin auch für den künftigen, bereits ernannten Bischof.
§ 2 verlangt, dass der Ernannte nach Möglichkeit innerhalb von vier Monaten ab seiner Ernennung sein Amt ergreift – und dies im Weiteren zeichenhaft auch dadurch verdeutlicht, dass er bei Gottesdiensten im Würzburger Dom auf dem für ihn reservierten Stuhl, seiner bischöflichen Kathedra, Platz nimmt. Die Norm des c. 382 § 2 CIC bietet damit eine Konkretisierung des allgemeinen kirchenrechtlichen Grundsatzes, dass kirchliche Ämter, die der Seelsorge dienen, zeitnah zu besetzen sind (vgl. c. 151 CIC). Dabei bietet c. 151 CIC seinerseits eine Konkretisierung des allgemeinen kirchenrechtlichen Grundsatzes aus c. 1752 CIC, wonach die Sorge um das ewige Seelenheil der Gläubigen die oberste Richtschnur allen kirchlichen Handelns sein müsse. Zwar ist das Spektrum der Aufgaben und Verpflichtungen eines Bischofs in der heutigen Zeit anspruchsvoll und facettenreich. Es duldet aber keinen Zweifel, dass zu den Kernaufgaben eines Diözesanbischofs auf jeden Fall auch die Seelsorge zählt. Hiervon legt c. 383 CIC beredt Zeugnis ab, der dem Diözesanbischof ans Herz legt, sich unterschiedslos um alle seiner Hirtensorge anvertrauten Gläubigen zu kümmern; anstatt Einzelpersonen oder anhand soziologischer oder religiöser Kriterien diese oder jene Gruppe zu bevorzugen oder zu vernachlässigen. In einer Welt endlicher Ressourcen wird die so gestellte Aufgabe, allen alles zu werden (vgl. 1 Kor 9,22), freilich immer die Kunst des Möglichen bleiben.
Neben der Frist des c. 382 § 2 CIC hat ein ins Bischofsamt Berufener auch die Frist aus c. 379 CIC zu beachten: Gemäß diesem Kanon hat zunächst binnen dreier Monate ab Erhalt des päpstlichen Ernennungsschreibens die Bischofsweihe zu erfolgen und erst danach die kanonische Besitzergreifung. Damit ist dieser Kanon Ausdruck der vom Zweiten Vatikanischen Konzil betonten Einheit der geistlichen Gewalt, deren zwei Dimensionen der Weihegewalt und der Leitungsgewalt zwar unterscheidbar sind, aber nicht in der Weise voneinander getrennt werden dürfen, dass es Inhaber bischöflicher Leitungsgewalt gibt, die (noch) keine Bischofsweihe empfangen haben.
Die drei- bzw. viermonatige Frist des c. 379 CIC bzw. c. 368 § 2 CIC beginnt zu laufen, sobald der ins Bischofsamt Berufene das päpstliche Ernennungsschreiben erhalten hat. Wie zu vernehmen, wurde das Ernennungsschreiben für den designierten neuen Würzburger Diözesanbischof allerdings nicht bereits am oder um den 16. Februar 2018 ausgefertigt, sondern erst mehrere Wochen später, und soll dem Weihekandidaten im Original auch erst im Rahmen des Weihegottesdienstes vom Apostolischen Nuntius in Deutschland, Erzbischof Dr. Nikola Eterović, persönlich ausgehändigt werden. Eine Praxis, die die Fristsetzungen der cc. 379, 382 § 2 CIC letztlich entbehrlich macht.
Wie der Vorgang der kanonischen Besitzergreifung im Einzelnen abläuft, skizziert § 3: Der ins Amt berufene Bischof muss dem so genannten Konsultorenkollegium sein päpstliches Ernennungsschreiben vorlegen. Nach dem kodikarischen Recht wird das Konsultorenkollegium regelmäßig aus Mitgliedern des Priesterrats gebildet (vgl. c. 502 § 1 CIC). In Deutschland hat die Bischofskonferenz von der in c. 502 § 3 CIC eröffneten Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Aufgaben des Konsultorenkollegiums dem jeweiligen Domkapitel zu übertragen. Das päpstliche Ernennungsschreiben ist also hierzulande den Domkapitularen vorzuzeigen.
Dazu empfiehlt § 4 nachdrücklich, dass dieser Vorgang einen liturgischen Rahmen hat; in der Bischofskirche stattfindet; und außer den nach § 3 zwingend erforderlichen Personen auch Klerus und Volk anwesend sind.
Dieser kanonische Impuls ist vom liturgischen Recht aufgegriffen in der Liturgie der Bischofsweihe (siehe Anhang). Die Rubriken – also die traditionell in roter Farbe geschriebenen „Regieanweisungen“ für die liturgischen Akteure – des Pontifikale – also jenes liturgischen Buchs, in welchem die den Bischöfen vorbehaltenen gottesdienstlichen Handlungen zusammengefasst sind – sehen unmittelbar nach der Eröffnung des Weihegottesdienstes eine Vorstellung des Weihekandidaten vor. Im Zuge dieser Vorstellung wird das päpstliche Ernennungsschreiben dem Domkapitel vorgelegt, was vom Kanzler des Bischöflichen Ordinariats aktenkundig zu machen ist. Das Ernennungsschreiben enthält zugleich den vom kanonischen Weiherecht gemäß c. 1013 CIC geforderten Auftrag (mandatum) des Papstes an den Hauptkonsekrator der Bischofsweihe. Ohne päpstliches Mandat wäre die Weihespendung unerlaubt und beginge der weihende Bischof zugleich eine Straftat des kirchlichen Rechts (vgl. c. 1382 CIC a.F. = c. 1387 CIC n.F.). Die Aufforderung des Hauptzelebranten, das päpstliche Ernennungsschreiben vorzulesen, hat somit eine doppelte Funktion: Die Ernennung wird nochmals jenen Gottesdienstteilnehmern verdeutlicht, die das Schreiben (anders als das Domkapitel) nicht persönlich in Augenschein nehmen können. Zugleich verschafft sich der Spender der Bischofsweihe Gewissheit darüber, dass er im konkreten Fall und hinsichtlich des erwählten Kandidaten zur Weihespendung berechtigt ist.
Aufgrund dieser Doppelfunktion des päpstlichen Ernennungsschreibens wird zugleich verständlich, warum das Zeremoniell des Weihegottesdienstes – bei dem die kanonische Besitzergreifung des (noch ungeweihten) Bischofskandidaten also zeitlich vor der eigentlichen Weihespendung platziert ist – in Spannung zu der von c. 379 CIC aus gutem Grund geforderten zeitlichen Reihenfolge steht. Diese Spannung ist dadurch aufgehoben oder wenigstens gemildert, dass man die Liturgie des Weihegottesdienstes als eine (theo-)logische Einheit versteht. In dieser Perspektive spiegelt dann die Liturgie selbst die Differenz und wechselseitige Bezogenheit von Weihe und Amt bzw. von Leitungsgewalt – deren Ausübung die kanonische Besitzergreifung voraussetzt – und Weihegewalt – deren Ausübung den Empfang der Bischofsweihe voraussetzt – wider.
Anhang
Anhang:
Auszug aus:
Pontifikale
für die katholischen Bistümer des deutschen Sprachgebiets,
Bd. I: Die Weihe des Bischofs, der Priester und der Diakone
Die Feier der Bischofsweihe
[…]
Vorstellung des Erwählten
[…] Wird der Bischof in seiner Diözese geweiht, so legt einer der Priester, die dem Erwählten assistieren, nach der Begrüßung der Gemeinde dem Domkapitel das Apostolische Ernennungsschreiben vor. Der Kanzler der Diözese hält diesen Vorgang in den Akten fest.
Dann geleiten (der bisherige Bistumsadministrator und) die beiden assistierenden Priester den Erwählten vor den Hauptzelebranten, dem sie ihre Ehrerbietung bezeigen.
Der bisherige Bistumsadministrator oder einer der beiden Priester wendet sich mit folgenden oder ähnlichen Worten an den Hauptzelebranten.
Bistumsadministrator / Assistierender Priester:
Hochwürdiger Vater, die Kirche von [Würzburg] bittet dich, den Priester [Franz Jung], der unserem Domkapitel das Ernennungsschreiben vorgelegt hat, zu ihrem Bischof zu weihen.
Der Hauptzelebrant spricht mit folgenden oder ähnlichen Worten:
Hauptzelebrant:
Ich bitte, das Schreiben des Papstes vorzulesen.
Das Schreiben wird verlesen. Alle setzen sich, um es anzuhören, und bekunden zum Schluss ihre Zustimmung zur Erwählung des Bischofs mit
Dank sei Gott, dem Herrn
oder auf andere passende Weise. Wenn die liturgische Ordnung den Gloria-Hymnus vorsieht, kann eine eigene Zustimmung entfallen.
Der Erwählte und die beiden assistierenden Priester begeben sich an ihre Plätze.
[…]
„Canones huius Codicis unam Ecclesiam latinam respiciunt.“
„Die Canones dieses Codex betreffen allein die lateinische Kirche.“
von Martin Rehak
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ (Hermann Hesse). Ob der erste Kanon des geltenden Kodex des kanonischen Rechts (lateinisch: Corpus Iuris Canonici, kurz CIC) aus dem Jahr 1983 diesem Anspruch gerecht zu werden vermag, ist allerdings ungewiss.
Vielleicht liegt dies daran, dass c. 1 CIC keine „creatio ex nihilo“, keine voraussetzungslose Neuschöpfung ist, sondern in einer rechtlichen Kultur und Tradition steht, die in einzelnen Rechtssätzen bis in neutestamentliche Zeit zurückreicht? Oder daran, dass c. 1 CIC mit wenigen fachsprachlichen Worten direkt zur Sache kommt?
C. 1 des CIC/1983 hat erkennbar eine zweifache Funktion: Zum einen dient er einer Selbstvorstellung des Gesamtwerks, insofern – allerdings ohne nähere Erläuterung – die Begriffe „Kanon“ und „Kodex“ eingeführt werden. Zum anderen wird in sehr allgemeiner Form der hauptsächliche Adressatenkreis des CIC benannt, nämlich die katholischen Christen, die der „lateinischen Kirche“ zugehören.
Der Begriff der „lateinischen Kirche“ wirft grundsätzliche und weitreichende Fragen nach der Struktur und dem Verfassungsrecht der Kirche auf. Für eine genaue Erklärung sind komplexe geschichtliche Entwicklungen und Zusammenhänge zu beleuchten (siehe dazu auch die Langfassung dieses Beitrags):
Schon seit der Spätantike haben sich innerhalb des Römischen Reiches in der Kirche gewisse Unterschiede in Fragen der Theologie, der Liturgie und des Kirchenrechts bemerkbar gemacht, die auch ganz banal mit der in der Liturgie und von den Theologen benutzten Sprache – Latein oder Griechisch – zusammenhingen. Die Termini „lateinische Kirche“, „Lateiner“ (mit den ursprünglichen Gegenbegriffen: „griechische Kirche“, „Griechen“) erinnern an dieses Phänomen, insofern sie jenen Teil der katholischen Kirche bezeichnen, der sich ursprünglich in der Westhälfte des Römischen Reiches inkulturiert hat.
Während des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962–1965) hat sich die Überzeugung gebildet, dass nicht nur der Gesamtkirche und den einzelnen Ortskirchen (Diözesen, Bistümern) eine spezifische ekklesiale Qualität und ekklesiologische Bedeutung zukommt, sondern auch den so genannten Rituskirchen. Hierunter haben die Konzilsväter die Summe jener Ortskirchen verstanden, die jeweils durch den in ihnen gepflegten Ritus – also die gleichen liturgischen Praktiken, kirchenrechtlichen Regelungen und Traditionen des geistlichen Lebens – und aufgrund einer eigenen Hierarchie eine abgrenzbare Einheit bilden. Die Eigenständigkeit der verschiedenen Riten begründet dabei zugleich eine relative Autonomie (nicht: Autokephalie) der einzelnen Rituskirchen, die daher in der kirchenrechtlichen Fachsprache heute passender mit dem Begriff der Eigenberechtigten Kirche (Ecclesia sui iuris, Kirche eigenen Rechts) bezeichnet werden. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rituskirche wird dabei nicht mehr territorial – d.h. über den Wohnsitz dort, wo sich ein bestimmter Ritus ursprünglich inkulturiert hatte – bestimmt, sondern personal. Die Zugehörigkeit wird gemäß den Regelungen des c. 111 CIC = cc. 29–30 CCEO bei der Taufe festgelegt.
Die lateinische Kirche ist in dieser Ekklesio-Logik eine Eigenberechtigte Kirche neben mehr als 20 weiteren Ecclesiae sui iuris in der katholischen Kirche. Sie ist zugleich aber eine Eigenberechtigte Kirche sui generis, weil sie über eine Reihe von Alleinstellungsmerkmalen verfügt:
Sie ist die einzige Eigenberechtigte Kirche, bei der die Unterscheidung zwischen dem ursprünglichen Stammterritorium und der Diaspora im Laufe der Kirchen(rechts)geschichte aufgegeben wurde.
Sie ist die einzige Eigenberechtigte Kirche, der sich der gesamtkirchliche Gesetzgeber mit einem eigenen Gesetzbuch angenommen hat.
Sie ist, gemessen an der Zahl der zu ihr gehörigen Gläubigen, um ein Vielfaches größer als alle anderen Eigenberechtigten Kirchen zusammengenommen.
Sie ist schließlich die einzige Eigenberechtigte Kirche, deren Ersthierarch zugleich Inhaber eines spezifischen Petrusamtes ist, dessen Konturen das Erste Vatikanische Konzil mit den beiden Papstdogmen über die Unfehlbarkeit des Papstes bei der Verkündigung des Glaubens der Kirche sowie vom päpstlichen Jurisdiktionsprimat aufzuzeigen versucht hat. Im Anschluss an den damaligen Münchener Kirchenrechtler Klaus Mörsdorf hat in diesem Zusammenhang Joseph Ratzinger als junger Konzilsperitus zu bedenken gegeben, dass im Laufe der Geschichte die besondere patriarchale Jurisdiktion der Bischöfe Roms den Blick auf den eigentlichen Sinngehalt des petrinischen Amtes verstellt und die Personalunion beider Ämter zu einer Vermischung des jeweiligen Amtsprofils geführt habe. Ratzinger sprach sich daher auch für eine Entflechtung der Ämter des Papstes und des Patriarchen des Abendlandes aus, die sich dann auch in der Struktur der Römischen Kurie spiegeln müsste. Ob dazu der Verzicht Benedikts XVI. auf den traditionellen Papsttitel „Patriarch des Abendlandes“ ein Schritt in die richtige Richtung war, ist umstritten. Denn der Titel mag sekundär und historisch überholt sein. Das damit bezeichnete Amt des Ersthierarchen der lateinischen Kirche hingegen ist geblieben.
Wie ist nach alledem die Aussage des c. 1 CIC in einer knappen, aber kritischen kanonistischen Reflexion zu bewerten?
Es sei bemerkt, dass der Kanon bei genauem Hinsehen die Inhalte des CIC/1983 nur verkürzt bzw. idealisierend beschreibt. Denn tatsächlich finden sich dort etliche Normen, die durchaus das Verhältnis der lateinischen zu den nichtlateinischen Katholiken betreffen; und darüber hinaus Normen, die auch direkt oder indirekt nichtkatholische Christen oder sogar Ungetaufte betreffen.
Umgekehrt sind in c. 838 § 2 CIC der Begriff „Gesamtkirche (Ecclesia universa)“ und in c. 135 § 2 CIC der Begriff „Kirche (Ecclesia)“ restriktiv auszulegen, da in Anbetracht der Autonomie der katholischen Ostkirchen hier sachlich jeweils die Lateinische Kirche gemeint ist.
Der Umstand, dass die im CIC/1983 statuierte innerkirchliche Disziplin nicht das einzige existierende Gesetz in der katholischen Kirche ist, schärft den Sinn für die innere Fülle und Weite des Katholischen und lenkt die Aufmerksamkeit darauf, dass die Einheit der Kirche nicht aus der Uniformität der kirchlichen Rechtsordnung resultiert. Eine gewisse Pluralität sollte vielmehr der Normalzustand des Katholischen sein – gemäß dem bekannten Merksatz: „In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. (Im Notwendigen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in Allem Liebe)“.
-
KdM_1__1__Kurzfassung_MR.pdf 643 KB
-
KdM_1__1__Langfassung_MR.pdf 675 KB