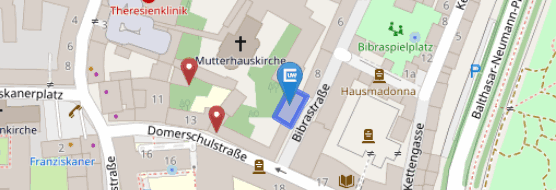Rahner-Preis an Agnes Slunitschek verliehen
23.01.2025Agnes Slunitschek erhält renommierten Rahner-Preis 2024 für ihre Dissertation.
Für ihre Dissertation „Der Glaubenssinn. Begründung – Beschreibung – Beurteilung – Beziehungen“ (Münster 2023) wurde Dr. Agnes Slunitschek am 23. Januar 2025 an der Katholisch-theologischen Fakultät Innsbruck der Karl-Rahner-Preis 2024 verliehen. Prof. Roman Siebenrock betont die große Bedeutsamkeit der Dissertation für die Kirche: „Die Arbeit hat höchste Bedeutung für eine synodale Kirche, weil alle, auch der Papst, zunächst aus dieser Entwicklung und Struktur eines gemeinsamen Glaubenssinnes in der jeweiligen kulturellen und geschichtlichen Brechung zu einem persönlichen bzw. gereiften Glauben kommen. Alle, auch Theolog:innen, sind im Glaubenssinn verankert. Wie der Glaubenssinn „geprüft“ oder gar „festgemacht“ werden kann, bleibt offen, jedenfalls sind Meinungsumfragen etc. nicht immer hilfreich. Hier gilt wohl auch das Wagnis einer Option, weil die realen Glaubensüberzeugungen der Menschen immer heterogen und plural sind. Aber die Arbeit gibt Kriterien an die Hand, wie damit gut umgegangen werden kann.”
P. Christian Marte, der den Preis im Namen der Karl-Rahner-Stiftung übergibt, erläutert bei der Verleihung die Aktualität der Theologie Karl Rahners: „Der Preis, der Frau Dr. Slunitschek verliehen wird, trägt den Namen von Karl Rahner. Er hat als Jesuit und Theologe mit seinen Predigten, Büchern und Vorträgen einen weiten Horizont aufgespannt, auch mit seinem Einsatz beim II. Vatikanischen Konzil. Und das ist auch unsere Aufgabe heute: dass wir selbst nicht eng werden, dass wir weit denken und weiter denken.“
Der Karl Rahner-Preis wird jährlich durch die Karl-Rahner-Stiftung ausgeschrieben; er wird vergeben, wenn eine preiswürdige Arbeit vorliegt. Er beinhaltet einen Zuschuss für die Drucklegung der Arbeit bis zum Höchstwert von €5.000.
Ass. Prof. Mag. Dr. Michaela Quast-Neulinger MA (Katholisch-Theologische Fakultät Innsbruck) im Gespräch mit der Preisträgerin:
Wie erklären Sie den „Glaubenssinn der Gläubigen“ den Gläubigen?
Alle Gläubigen haben als Gläubige je für sich (sensus fidei fidelis) die Fähigkeit, den Glauben zu erkennen und zu bezeugen (Sinn für den Glauben). Die Gläubigen erkennen vor allem aus der Praxis und dem Leben heraus, was der Glaube bedeutet, wie er auszulegen und zu verstehen ist. Sie erschließen also in Auseinandersetzung mit der Welt den Sinn des Glaubens – und bekennen ihn ebenso praktisch im Tun und Leben. Der Glaubenssinn ist somit das Vermögen und dessen Ergebnis. Die Sinndeutungen sind zwar begrenzt und zuerst einmal subjektiv, aber genau damit leisten die Gläubigen einen wichtigen Dienst, weil sie den Glauben mit dem Leben verbinden und ihn in verschiedene Kontexte hinein übersetzen. So bleibt der Glaube lebendig und im ursprünglichen Sinn katholisch.
In welchem Verhältnis stehen der Glaubenssinn des Einzelnen und das Lehramt?
Idealerweise in einem gegenseitigen Wechselverhältnis. Faktisch haben einzelne Gläubige selten Kontakt zu einem Bischof oder gar dem Papst und sind deren Mitsprache- und Mitgestaltungsrechte insgesamt in der Kirche beschränkt; ebenso die Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen. Und zuletzt können realistischerweise nicht alle Gläubigen in direktem Kontakt mit den Vertretern des Lehramts stehen, dafür sind es schlicht zu viele. Alle Gläubigen haben aber eine grundsätzliche Wahrheitsfähigkeit und sind dazu berufen, an der Sendung der Kirche mitzuwirken. Repräsentative Formen würden es ermöglichen, dass die Gläubigen sich und ihren Glauben selbst vertreten und in die Prozesse von Lehrentscheidungen einbringen können, ohne dass jeder selbst beteiligt ist. Papst Franziskus hat hier Veränderungen angestoßen, die für die Gläubigen aber noch partizipativer und verbindlich festgeschrieben werden müssten.
Sie beschreiben die Gemeinschaft der Gläubigen als eigenständigen „locus theologicus“. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Theologie bzw. die Gestaltung von Kirche?
Ich möchte an einem Beispiel aus der Ökumene, einem meiner Forschungsschwerpunkte, veranschaulichen, was ich mit “eigenständig” meine: Viele Gläubige wünschen sich, dass die Eucharistiegemeinschaft zugelassen wird. Sie erleben vor allem das Gemeinsame im Glauben und es wiegt für sie schwerer als die Unterschiede im Amtsverständnis, was vonseiten des Lehramts als Haupthinderungsgrund angeführt wird. Zudem verweisen sie darauf, dass ein konkreter Ausschluss einzelner vom Hauptteil des Gottesdienstes der Einladung zur Teilnahme und der Zuwendung Jesu zu allen Menschen widerspreche. Die Gläubigen kommen damit aus der Glaubenspraxis heraus zu anderen Ergebnissen als das Lehramt oder die Theologie, die aber nicht einfach als untheologisch oder ungläubig abgetan werden können. Es ist außerdem nicht ihre Aufgabe, ihre Positionen wissenschaftlich darzulegen zu begründen; darin besteht die Eigenheit der Theologie. Aus der Theorie der verschiedenen Zeugnis- und Erkenntnisinstanzen, die je eigenständig, voneinander verschieden, aber dennoch gleichwertig sind, folgt, dass jeder dieser Zugänge einen eigenen Wert hat und Anderssein noch nicht Falschheit bedeutet. Der Glaube wird an verschiedenen Orten gefunden und ausgelegt – die alle auch einseitig sind. Durch deren Zusammenspiel kann der Glaube der Kirche gefunden und ganzheitlicher gefasst werden. Das verläuft aufgrund der Verschiedenheit nicht reibungslos, ist aufgrund der Gleichwertigkeit aber unumgänglich.
Der Theologe Martin Breul unterscheidet Lüge, Bullshit und Propaganda in den gegenwärtigen öffentlichen Debatten. Welche Rolle spielt der „Glaubenssinn“, wenn die kirchliche und breite gesellschaftliche Öffentlichkeit immer stärker von reinen Machtinteressen geprägt sind, jenseits eines Anspruchs auf Wahrheit?
Machtstreben und Machtmissbrauch beschränken sich nicht auf Kleriker, sondern sind ebenfalls ein Problem unter Laien – egal welchen Geschlechts oder Alters. Ich fände es aber falsch, den Gläubigen – und auch Klerikern – grundsätzlich Machtstreben und fehlendes Interesse an der Wahrheit zu unterstellen. Vielmehr heißt den Glaubenssinn aller Gläubigen anzuerkennen, einander mit einem grundlegenden Vertrauen und der Wahrheitsvermutung zu begegnen. Das ist nicht naiv gemeint, aber eine positive Grundhaltung statt einer negativen. Ich erlebe viele Gläubige, denen es sehr ernsthaft um den Glauben geht – meist unter der Perspektive, wie der Glaube von der Liebe Gottes her gedeutet und gelebt werden kann.
Sie erhalten für Ihre Arbeit den Karl-Rahner-Preis. Welche Bedeutung hat Karl Rahner für Ihre Theologie?
Karl Rahner hat keinen Text zum Glaubenssinn geschrieben und er nennt den Begriff auch nur gelegentlich. Er hat aber mit den Weg dafür bereitet, dass der Glaubenssinn heute als bedeutsam anerkannt ist. Am wichtigsten dafür ist sein Beitrag zur anthropologischen Wende, im engeren Sinn stimmt seine Wertschätzung des „Katechismus im Kopf und im Herzen eines einzelnen Gläubigen“ mit dem überein, was unter dem Glaubenssinn verhandelt wird. Der für mich persönlich beeindruckendste Text Rahners ist aber ein geistlicher: Das Gebet „Gott der Erkenntnis“, in dem dieser große Theologe seine Grenzen der Erkenntnis benennt und auch eingesteht, wie viel er von dem vergessen hat, was er einmal wusste. Das ist tröstlich und gebe ich gerne auch Studierenden mit.